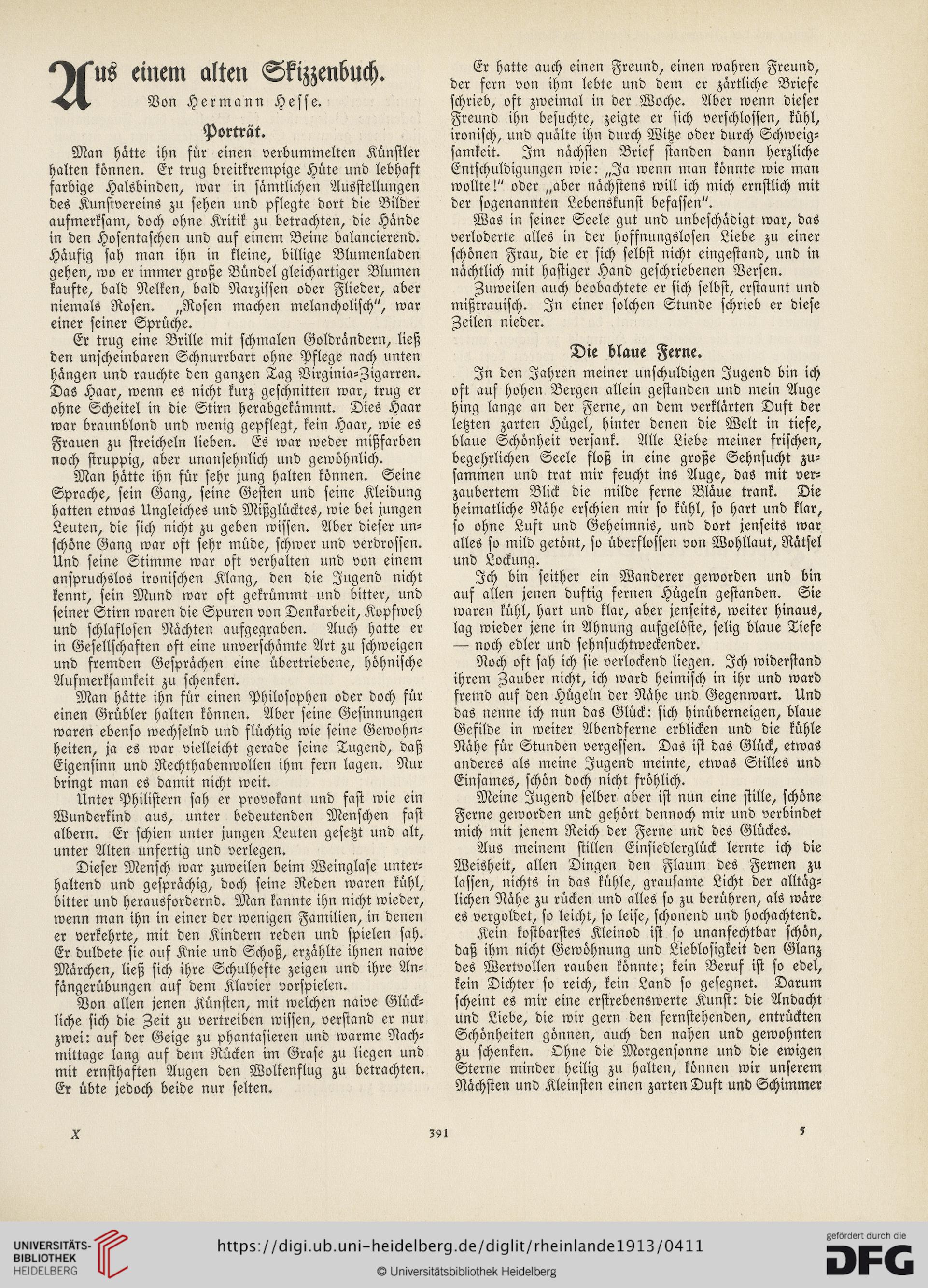us einem alten Skizzenbuch.
Von Hermann Hesse.
Porträt.
Man hätte ihn für einen verbummelten Künstler
halten können. Er trug breitkrempige Hüte und lebhaft
farbige Halsbinden, war in sämtlichen Ausstellungen
des Kunstvereins zu sehen und pflegte dort die Bilder
aufmerksam, doch ohne Kritik zu betrachten, die Hände
in den Hosentaschen und auf einem Beine balancierend.
Häufig sah man ihn in kleine, billige Blumenladen
gehen, wo er immer große Bündel gleichartiger Blumen
kaufte, bald Nelken, bald Narzissen oder Flieder, aber
niemals Rosen. „Rosen machen melancholisch", war
einer seiner Sprüche.
Er trug eine Brille mit schmalen Goldrändern, ließ
den unscheinbaren Schnurrbart ohne Pflege nach unten
hängen und rauchte den ganzen Tag Virginia-Zigarren.
Das Haar, wenn es nicht kurz geschnitten war, trug er
ohne Scheitel in die Stirn herabgekämmt. Dies Haar
war braunblond und wenig gepflegt, kein Haar, wie es
Frauen zu streicheln lieben. Es war weder mißfarben
noch struppig, aber unansehnlich und gewöhnlich.
Man hätte ihn für sehr jung halten können. Seine
Sprache, sein Gang, seine Gesten und seine Kleidung
hatten etwas Ungleiches und Mißglücktes, wie bei jungen
Leuten, die sich nicht zu geben wissen. Aber dieser un-
schöne Gang war oft sehr müde, schwer und verdrossen.
Und seine Stimme war oft verhallen und von einem
anspruchslos ironischen Klang, den die Jugend nicht
kennt, sein Mund war oft gekrümmt und bitter, und
seiner Stirn waren die Spuren von Denkarbeit, Kopsweh
und schlaflosen Nächten aufgegraben. Auch hatte er
in Gesellschaften oft eine unverschämte Art zu schweigen
und fremden Gesprächen eine übertriebene, höhnische
Aufmerksamkeit zu schenken.
Man hätte ihn für einen Philosophen oder doch für
einen Grübler halten können. Aber seine Gesinnungen
waren ebenso wechselnd und flüchtig wie seine Gewohn-
heiten, ja es war vielleicht gerade seine Tugend, daß
Eigensinn und Rechthabenwollen ihm fern lagen. Nur
bringt man es damit nicht weit.
Unter Philistern sah er provokant und fast wie ein
Wunderkind aus, unter bedeutenden Menschen fast
albern. Er schien unter jungen Leuten gesetzt und alt,
unter Alten unfertig und verlegen.
Dieser Mensch war zuweilen beim Weinglase unter-
haltend und gesprächig, doch seine Reden waren kühl,
bitter und herausfordernd. Man kannte ihn nicht wieder,
wenn man ihn in einer der wenigen Familien, in denen
er verkehrte, mit den Kindern reden und spielen sah.
Er duldete sie auf Knie und Schoß, erzählte ihnen naive
Märchen, ließ sich ihre Schulhefte zeigen und ihre An-
fängerübungen auf dem Klavier vorspielen.
Von allen jenen Künsten, mit welchen naive Glück-
liche sich die Zeit zu vertreiben wissen, verstand er nur
zwei: auf der Geige zu phantasieren und warme Nach-
mittage lang auf dem Rücken im Grase zu liegen und
mit ernsthaften Augen den Wolkenflug zu betrachten.
Er übte jedoch beide nur selten.
Er hatte auch einen Freund, einen wahren Freund,
der fern von ihm lebte und dem er zärtliche Briefe
schrieb, oft zweimal in der Woche. Aber wenn dieser
Freund ihn besuchte, zeigte er sich verschlossen, kühl,
ironisch, und quälte ihn durch Witze oder durch Schweig-
samkeit. Im nächsten Brief standen dann herzliche
Entschuldigungen wie: „Ja wenn man könnte wie man
wollte!" oder „aber nächstens will ich mich ernstlich mit
der sogenannten Lebenskunst befassen".
Was in seiner Seele gut und unbeschädigt war, das
verloderte alles in der hoffnungslosen Liebe zu einer
schönen Frau, die er sich selbst nicht eingestand, und in
nächtlich mit hastiger Hand geschriebenen Versen.
Zuweilen auch beobachtete er sich selbst, erstaunt und
mißtrauisch. In einer solchen Stunde schrieb er diese
Zeilen nieder.
Die blaue Ferne.
In den Jahren meiner unschuldigen Jugend bin ich
oft auf hohen Bergen allein gestanden und mein Auge
hing lange an der Ferne, an dem verklärten Duft der
letzten zarten Hügel, hinter denen die Welt in tiefe,
blaue Schönheit versank. Alle Liebe meiner frischen,
begehrlichen Seele floß in eine große Sehnsucht zu-
sammen und trat mir feucht ins Auge, das mit ver-
zaubertem Blick die milde ferne Bläue trank. Die
heimatliche Nähe erschien mir so kühl, so hart und klar,
so ohne Luft und Geheimnis, und dort jenseits war
alles so mild getönt, so Überflossen von Wohllaut, Rätsel
und Lockung.
Ich bin seither ein Wanderer geworden und bin
auf allen jenen duftig fernen Hügeln gestanden. Sie
waren kühl, hart und klar, aber jenseits, weiter hinaus,
lag wieder jene in Ahnung aufgelöste, selig blaue Tiefe
— noch edler und sehnsuchtweckender.
Noch oft sah ich sie verlockend liegen. Ich widerstand
ihrem Zauber nicht, ich ward heimisch in ihr und ward
fremd auf den Hügeln der Nähe und Gegenwart. Und
das nenne ich nun das Glück: sich hinüberneigen, blaue
Gefilde in weiter Abendferne erblicken und die kühle
Nähe für Stunden vergessen. Das ist das Glück, etwas
anderes als meine Jugend meinte, etwas Stilles und
Einsames, schön doch nicht fröhlich.
Meine Jugend selber aber ist nun eine stille, schöne
Ferne geworden und gehört dennoch mir und verbindet
mich mit jenem Reich der Ferne und des Glückes.
Aus meinem stillen Einsiedlerglück lernte ich die
Weisheit, allen Dingen den Flaum des Fernen zu
lassen, nichts in das kühle, grausame Licht der alltäg-
lichen Nähe zu rücken und alles so zu berühren, als wäre
es vergoldet, so leicht, so leise, schonend und hochachtend.
Kein kostbarstes Kleinod ist so unanfechtbar schön,
daß ihm nicht Gewöhnung und Lieblosigkeit den Glanz
des Wertvollen rauben könnte; kein Beruf ist so edel,
kein Dichter so reich, kein Land so gesegnet. Darum
scheint es mir eine erstrebenswerte Kunst: die Andacht
und Liebe, die wir gern den fernstehenden, entrückten
Schönheiten gönnen, auch den nahen und gewohnten
zu schenken. Ohne die Morgensonne und die ewigen
Sterne minder heilig zu halten, können wir unserem
Nächsten und Kleinsten einen zarten Duft und Schimmer
Z91
5
Von Hermann Hesse.
Porträt.
Man hätte ihn für einen verbummelten Künstler
halten können. Er trug breitkrempige Hüte und lebhaft
farbige Halsbinden, war in sämtlichen Ausstellungen
des Kunstvereins zu sehen und pflegte dort die Bilder
aufmerksam, doch ohne Kritik zu betrachten, die Hände
in den Hosentaschen und auf einem Beine balancierend.
Häufig sah man ihn in kleine, billige Blumenladen
gehen, wo er immer große Bündel gleichartiger Blumen
kaufte, bald Nelken, bald Narzissen oder Flieder, aber
niemals Rosen. „Rosen machen melancholisch", war
einer seiner Sprüche.
Er trug eine Brille mit schmalen Goldrändern, ließ
den unscheinbaren Schnurrbart ohne Pflege nach unten
hängen und rauchte den ganzen Tag Virginia-Zigarren.
Das Haar, wenn es nicht kurz geschnitten war, trug er
ohne Scheitel in die Stirn herabgekämmt. Dies Haar
war braunblond und wenig gepflegt, kein Haar, wie es
Frauen zu streicheln lieben. Es war weder mißfarben
noch struppig, aber unansehnlich und gewöhnlich.
Man hätte ihn für sehr jung halten können. Seine
Sprache, sein Gang, seine Gesten und seine Kleidung
hatten etwas Ungleiches und Mißglücktes, wie bei jungen
Leuten, die sich nicht zu geben wissen. Aber dieser un-
schöne Gang war oft sehr müde, schwer und verdrossen.
Und seine Stimme war oft verhallen und von einem
anspruchslos ironischen Klang, den die Jugend nicht
kennt, sein Mund war oft gekrümmt und bitter, und
seiner Stirn waren die Spuren von Denkarbeit, Kopsweh
und schlaflosen Nächten aufgegraben. Auch hatte er
in Gesellschaften oft eine unverschämte Art zu schweigen
und fremden Gesprächen eine übertriebene, höhnische
Aufmerksamkeit zu schenken.
Man hätte ihn für einen Philosophen oder doch für
einen Grübler halten können. Aber seine Gesinnungen
waren ebenso wechselnd und flüchtig wie seine Gewohn-
heiten, ja es war vielleicht gerade seine Tugend, daß
Eigensinn und Rechthabenwollen ihm fern lagen. Nur
bringt man es damit nicht weit.
Unter Philistern sah er provokant und fast wie ein
Wunderkind aus, unter bedeutenden Menschen fast
albern. Er schien unter jungen Leuten gesetzt und alt,
unter Alten unfertig und verlegen.
Dieser Mensch war zuweilen beim Weinglase unter-
haltend und gesprächig, doch seine Reden waren kühl,
bitter und herausfordernd. Man kannte ihn nicht wieder,
wenn man ihn in einer der wenigen Familien, in denen
er verkehrte, mit den Kindern reden und spielen sah.
Er duldete sie auf Knie und Schoß, erzählte ihnen naive
Märchen, ließ sich ihre Schulhefte zeigen und ihre An-
fängerübungen auf dem Klavier vorspielen.
Von allen jenen Künsten, mit welchen naive Glück-
liche sich die Zeit zu vertreiben wissen, verstand er nur
zwei: auf der Geige zu phantasieren und warme Nach-
mittage lang auf dem Rücken im Grase zu liegen und
mit ernsthaften Augen den Wolkenflug zu betrachten.
Er übte jedoch beide nur selten.
Er hatte auch einen Freund, einen wahren Freund,
der fern von ihm lebte und dem er zärtliche Briefe
schrieb, oft zweimal in der Woche. Aber wenn dieser
Freund ihn besuchte, zeigte er sich verschlossen, kühl,
ironisch, und quälte ihn durch Witze oder durch Schweig-
samkeit. Im nächsten Brief standen dann herzliche
Entschuldigungen wie: „Ja wenn man könnte wie man
wollte!" oder „aber nächstens will ich mich ernstlich mit
der sogenannten Lebenskunst befassen".
Was in seiner Seele gut und unbeschädigt war, das
verloderte alles in der hoffnungslosen Liebe zu einer
schönen Frau, die er sich selbst nicht eingestand, und in
nächtlich mit hastiger Hand geschriebenen Versen.
Zuweilen auch beobachtete er sich selbst, erstaunt und
mißtrauisch. In einer solchen Stunde schrieb er diese
Zeilen nieder.
Die blaue Ferne.
In den Jahren meiner unschuldigen Jugend bin ich
oft auf hohen Bergen allein gestanden und mein Auge
hing lange an der Ferne, an dem verklärten Duft der
letzten zarten Hügel, hinter denen die Welt in tiefe,
blaue Schönheit versank. Alle Liebe meiner frischen,
begehrlichen Seele floß in eine große Sehnsucht zu-
sammen und trat mir feucht ins Auge, das mit ver-
zaubertem Blick die milde ferne Bläue trank. Die
heimatliche Nähe erschien mir so kühl, so hart und klar,
so ohne Luft und Geheimnis, und dort jenseits war
alles so mild getönt, so Überflossen von Wohllaut, Rätsel
und Lockung.
Ich bin seither ein Wanderer geworden und bin
auf allen jenen duftig fernen Hügeln gestanden. Sie
waren kühl, hart und klar, aber jenseits, weiter hinaus,
lag wieder jene in Ahnung aufgelöste, selig blaue Tiefe
— noch edler und sehnsuchtweckender.
Noch oft sah ich sie verlockend liegen. Ich widerstand
ihrem Zauber nicht, ich ward heimisch in ihr und ward
fremd auf den Hügeln der Nähe und Gegenwart. Und
das nenne ich nun das Glück: sich hinüberneigen, blaue
Gefilde in weiter Abendferne erblicken und die kühle
Nähe für Stunden vergessen. Das ist das Glück, etwas
anderes als meine Jugend meinte, etwas Stilles und
Einsames, schön doch nicht fröhlich.
Meine Jugend selber aber ist nun eine stille, schöne
Ferne geworden und gehört dennoch mir und verbindet
mich mit jenem Reich der Ferne und des Glückes.
Aus meinem stillen Einsiedlerglück lernte ich die
Weisheit, allen Dingen den Flaum des Fernen zu
lassen, nichts in das kühle, grausame Licht der alltäg-
lichen Nähe zu rücken und alles so zu berühren, als wäre
es vergoldet, so leicht, so leise, schonend und hochachtend.
Kein kostbarstes Kleinod ist so unanfechtbar schön,
daß ihm nicht Gewöhnung und Lieblosigkeit den Glanz
des Wertvollen rauben könnte; kein Beruf ist so edel,
kein Dichter so reich, kein Land so gesegnet. Darum
scheint es mir eine erstrebenswerte Kunst: die Andacht
und Liebe, die wir gern den fernstehenden, entrückten
Schönheiten gönnen, auch den nahen und gewohnten
zu schenken. Ohne die Morgensonne und die ewigen
Sterne minder heilig zu halten, können wir unserem
Nächsten und Kleinsten einen zarten Duft und Schimmer
Z91
5