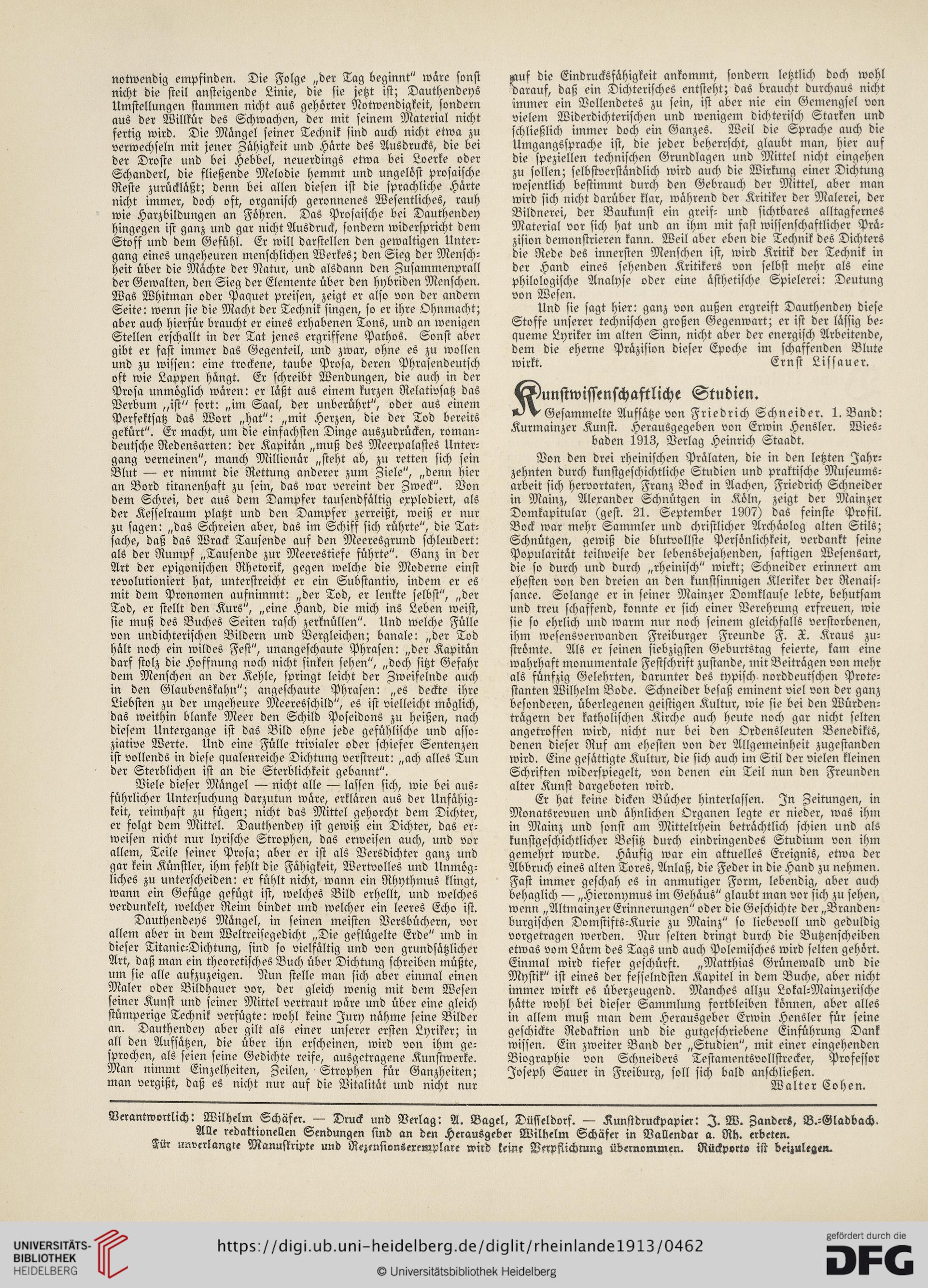notwendig empfinden. Die Folge „der Tag beginnt" wäre sonst
nicht die steil ansteigende Linie, die sie jetzt ist; Dauthendeys
Umstellungen stammen nicht aus gehörter Notwendigkeit, sondern
aus der Willkür des Schwachen, der mit seinem Material nicht
fertig wird. Die Mängel seiner Technik sind auch nicht etwa zu
verwechseln mit jener Zähigkeit und Härte des Ausdrucks, die bei
der Droste und bei Hebbel, neuerdings etwa bei Loerke oder
Schanderl, die fließende Melodie hemmt und ungelöst prosaische
Reste zurückläßt; denn bei allen diesen ist die sprachliche Härte
nicht immer, doch oft, organisch geronnenes Wesentliches, rauh
wie Harzbildungen an Föhren. Das Prosaische bei Dauthendey
hingegen ist ganz und gar nicht Ausdruck, sondern widerspricht dem
Stoff und dem Gefühl. Er will darstellen den gewaltigen Unter-
gang eines ungeheuren menschlichen Werkes; den Sieg der Mensch-
heit über die Mächte der Natur, und alsdann den Zusammenprall
der Gewalten, den Sieg der Clemente über den hybriden Menschen.
Was Whitman oder Paquet preisen, zeigt er also von der andern
Seite: wenn sie die Macht der Technik singen, so er ihre Ohnmacht;
aber auch hierfür braucht er eines erhabenen Tons, und an wenigen
Stellen erschallt in der Tat jenes ergriffene Pathos. Sonst aber
gibt er fast immer das Gegenteil, und zwar, ohne es zu wollen
und zu wissen: eine trockene, taube Prosa, deren Phrasendeutsch
oft wie Lappen hängt. Er schreibt Wendungen, die auch in der
Prosa unmöglich wären: er läßt aus einem kurzen Relativsatz das
Verbum „ist" fort: „im Saal, der unberührt", oder aus einem
Perfektsatz das Wort „hat": „mit Herzen, die der Tod bereits
gekürt". Er macht, um die einfachsten Dinge auszudrücken, roman-
deutsche Redensarten: der Kapitän „muß des Meerpalastes Unter-
gang verneinen", manch Millionär „steht ab, zu retten sich sein
Blut — er nimmt die Rettung anderer zum Ziele", „denn hier
an Bord titanenhaft zu sein, das war vereint der Zweck". Von
dem Schrei, der aus dem Dampfer tausendfältig explodiert, als
der Kesselraum platzt und den Dampfer zerreißt, weiß er nur
zu sagen: „das Schreien aber, das im Schiff sich rührte", die Tat-
sache, daß das Wrack Tausende auf den Meeresgrund schleudert:
als der Rumpf „Tausende zur Meerestiefe führte". Ganz in der
Art der epigonischen Rhetorik, gegen welche die Moderne einst
revolutioniert hat, unterstreicht er ein Substantiv, indem er es
mit dem Pronomen aufnimmt: „der Tod, er lenkte selbst", „der
Tod, er stellt den Kurs", „eine Hand, die mich ins Leben weist,
sie muß des Buches Seiten rasch zerknüllen". Und welche Fülle
von undichterischen Bildern und Dergleichen; banale: „der Tod
hält noch ein wildes Fest", unangeschaute Phrasen: „der Kapitän
darf stolz die Hoffnung noch nicht sinken sehen", „doch sitzt Gefahr
dem Menschen an der Kehle, springt leicht der Zweifelnde auch
in den Glaubenskahn"; angeschaute Phrasen: „es deckte ihre
Liebsten zu der ungeheure Meeresschild", es ist vielleicht möglich,
das weithin blanke Meer den Schild Poseidons zu heißen, nach
diesem Untergange ist das Bild ohne jede gefühlische und asso-
ziative Werte. Und eine Fülle trivialer oder schiefer Sentenzen
ist vollends in diese qualenreiche Dichtung verstreut: „ach alles Tun
der Sterblichen ist an die Sterblichkeit gebannt".
Viele dieser Mängel — nicht alle — lassen sich, wie bei aus-
führlicher Untersuchung darzutun wäre, erklären aus der Unfähig-
keit, reimhaft zu fügen; nicht das Mittel gehorcht dem Dichter,
er folgt dem Mittel. Dauthendey ist gewiß ein Dichter, das er-
weisen nicht nur lyrische Strophen, das erweisen auch, und vor
allem, Teile seiner Prosa; aber er ist als Versdichter ganz und
gar kein Künstler, ihm fehlt die Fähigkeit, Wertvolles und Unmög-
liches zu unterscheiden: er fühlt nicht, wann ein Rhythmus klingt,
wann ein Gefüge gefügt ist, welches Bild erhellt, und welches
verdunkelt, welcher Reim bindet und welcher ein leeres Echo ist.
Dauthendeys Mängel, in seinen meisten Versbüchern, vor
allem aber in dem Weltreisegedicht „Die geflügelte Erde" und in
dieser Titanic-Dichtung, sind so vielfältig und von grundsätzlicher
Art, daß man ein theoretisches Buch über Dichtung schreiben müßte,
um sie alle aufzuzeigen. Nun stelle man sich aber einmal einen
Maler oder Bildhauer vor, der gleich wenig mit dem Wesen
seiner Kunst und seiner Mittel vertraut wäre und über eine gleich
stümperige Technik verfügte: wohl keine Jury nähme seine Bilder
an. Dauthendey aber gilt als einer unserer ersten Lyriker; in
all den Aufsätzen, die über ihn erscheinen, wird von ihm ge-
sprochen, als seien seine Gedichte reife, ausgetragene Kunstwerke.
Man nimmt Einzelheiten, Zeilen, Strophen für Ganzheiten;
man vergißt, daß es nicht nur auf die Vitalität und nicht nur
Mf die Eindrucksfähigkeit ankommt, sondern letztlich doch wohl
'darauf, daß ein Dichterisches entsteht; das braucht durchaus nicht
immer ein Vollendetes zu sein, ist aber nie ein Gemengsel von
vielem Widerdichterischen und wenigem dichterisch Starken und
schließlich immer doch ein Ganzes. Weil die Sprache auch die
Umgangssprache ist, die jeder beherrscht, glaubt man, hier auf
die speziellen technischen Grundlagen und Mittel nicht eingehen
zu sollen; selbstverständlich wird auch die Wirkung einer Dichtung
wesentlich bestimmt durch den Gebrauch der Mittel, aber man
wird sich nicht darüber klar, während der Kritiker der Malerei, der
Bildnerei, der Baukunst ein greif- und sichtbares alltagfernes
Material vor sich hat und an ihm mit fast wissenschaftlicher Prä-
zision demonstrieren kann. Weil aber eben die Technik des Dichters
die Rede des innersten Menschen ist, wird Kritik der Technik in
der Hand eines sehenden Kritikers von selbst mehr als eine
philologische Analyse oder eine ästhetische Spielerei: Deutung
von Wesen.
Und sie sagt hier: ganz von außen ergreift Dauthendey diese
Stoffe unserer technischen großen Gegenwart; er ist der lässig be-
queme Lyriker im alten Sinn, nicht aber der energisch Arbeitende,
dem die eherne Präzision dieser Epoche im schaffenden Blute
wirkt. Ernst Lissauer.
unstwissenschaftliche Studien.
Gesammelte Aufsätze von Friedrich Schneider. 1. Band:
Kurmainzer Kunst. Herausgegeben von Erwin Hensler. Wies-
baden 1913, Verlag Heinrich Staadt.
Von den drei rheinischen Prälaten, die in den letzten Jahr-
zehnten durch kunstgeschichtliche Studien und praktische Museums-
arbeit sich hervortaten, Franz Bock in Aachen, Friedrich Schneider
in Mainz, Alexander Schnütgen in Köln, zeigt der Mainzer
Domkapitular (gest. 21. September 1907) das feinste Profil.
Bock war mehr Sammler und christlicher Archäolog alten Stils;
Schnütgen, gewiß die blutvollste Persönlichkeit, verdankt seine
Popularität teilweise der lebensbejahenden, saftigen Wesensart,
die so durch und durch „rheinisch" wirkt; Schneider erinnert am
ehesten von den dreien an den kunstsinnigen Kleriker der Renais-
sance. Solange er in seiner Mainzer Domklause lebte, behutsam
und treu schaffend, konnte er sich einer Verehrung erfreuen, wie
sie so ehrlich und warm nur noch seinem gleichfalls verstorbenen,
ihm wesensverwanden Freiburger Freunde F. T. Kraus zu-
strömte. Als er seinen siebzigsten Geburtstag feierte, kam eine
wahrhaft monumentale Festschrift zustande, mit Beiträgen von mehr
als fünfzig Gelehrten, darunter des typisch norddeutschen Prote-
stanten Wilhelm Bode. Schneider besaß eminent viel von der ganz
besonderen, überlegenen geistigen Kultur, wie sie bei den Würden-
trägern der katholischen Kirche auch heute noch gar nicht selten
angetroffen wird, nicht nur bei den Ordensleuten Benedikts,
denen dieser Ruf am ehesten von der Allgemeinheit zugestanden
wird. Eine gesättigte Kultur, die sich auch im Stil der vielen kleinen
Schriften widerspiegelt, von denen ein Teil nun den Freunden
alter Kunst dargeboten wird.
Er hat keine dicken Bücher hinterlassen. In Zeitungen, in
Monatsrevuen und ähnlichen Organen legte er nieder, was ihm
in Mainz und sonst am Mittelrhein beträchtlich schien und als
kunstgeschichtlicher Besitz durch eindringendes Studium von ihm
gemehrt wurde. Häufig war ein aktuelles Ereignis, etwa der
Abbruch eines alten Tores, Anlaß, die Feder in die Hand zu nehmen.
Fast immer geschah es in anmutiger Form, lebendig, aber auch
behaglich — „Hieronymus im Gehäus" glaubt man vor sich zu sehen,
wenn „Altmainzer Erinnerungen" oder die Geschichte der „Branden-
burgischen Domstifts-Kurie zu Mainz" so liebevoll und geduldig
vorgetragen werden. Nur selten dringt durch die Butzenscheiben
etwas vom Lärm des Tags und auch Polemisches wird selten gehört.
Einmal wird tiefer geschürft. „Matthias Grünewald und die
Mystik" ist eines der fesselndsten Kapitel in dem Buche, aber nicht
immer wirkt es überzeugend. Manches allzu Lokal-Mainzerische
hätte wohl bei dieser Sammlung fortbleiben können, aber alles
in allem muß man dem Herausgeber Erwin Hensler für seine
geschickte Redaktion und die gutgeschriebene Einführung Dank
wissen. Ein zweiter Band der „Studien", mit einer eingehenden
Biographie von Schneiders Testamentsvollstrecker, Professor
Joseph Sauer in Freiburg, soll sich bald anschließen.
Walter Cohen.
Verantwortlich: Wilhelm Schäfer. — Druck und Verlag: A. Bagel, Düsseldorf. — Kunstdruckpapier: I. W. Zanders, B.-Gladbach.
Alle redaktionellen Sendungen sind an den Herausgeber Wilhelm Schäfer in Vallendar a. Rh. erbeten.
Tür unverlangte Manuskripte und Rezensionsexemplare wird keine Verpflichtung übernommen. Rückporto ist beizulegen.
nicht die steil ansteigende Linie, die sie jetzt ist; Dauthendeys
Umstellungen stammen nicht aus gehörter Notwendigkeit, sondern
aus der Willkür des Schwachen, der mit seinem Material nicht
fertig wird. Die Mängel seiner Technik sind auch nicht etwa zu
verwechseln mit jener Zähigkeit und Härte des Ausdrucks, die bei
der Droste und bei Hebbel, neuerdings etwa bei Loerke oder
Schanderl, die fließende Melodie hemmt und ungelöst prosaische
Reste zurückläßt; denn bei allen diesen ist die sprachliche Härte
nicht immer, doch oft, organisch geronnenes Wesentliches, rauh
wie Harzbildungen an Föhren. Das Prosaische bei Dauthendey
hingegen ist ganz und gar nicht Ausdruck, sondern widerspricht dem
Stoff und dem Gefühl. Er will darstellen den gewaltigen Unter-
gang eines ungeheuren menschlichen Werkes; den Sieg der Mensch-
heit über die Mächte der Natur, und alsdann den Zusammenprall
der Gewalten, den Sieg der Clemente über den hybriden Menschen.
Was Whitman oder Paquet preisen, zeigt er also von der andern
Seite: wenn sie die Macht der Technik singen, so er ihre Ohnmacht;
aber auch hierfür braucht er eines erhabenen Tons, und an wenigen
Stellen erschallt in der Tat jenes ergriffene Pathos. Sonst aber
gibt er fast immer das Gegenteil, und zwar, ohne es zu wollen
und zu wissen: eine trockene, taube Prosa, deren Phrasendeutsch
oft wie Lappen hängt. Er schreibt Wendungen, die auch in der
Prosa unmöglich wären: er läßt aus einem kurzen Relativsatz das
Verbum „ist" fort: „im Saal, der unberührt", oder aus einem
Perfektsatz das Wort „hat": „mit Herzen, die der Tod bereits
gekürt". Er macht, um die einfachsten Dinge auszudrücken, roman-
deutsche Redensarten: der Kapitän „muß des Meerpalastes Unter-
gang verneinen", manch Millionär „steht ab, zu retten sich sein
Blut — er nimmt die Rettung anderer zum Ziele", „denn hier
an Bord titanenhaft zu sein, das war vereint der Zweck". Von
dem Schrei, der aus dem Dampfer tausendfältig explodiert, als
der Kesselraum platzt und den Dampfer zerreißt, weiß er nur
zu sagen: „das Schreien aber, das im Schiff sich rührte", die Tat-
sache, daß das Wrack Tausende auf den Meeresgrund schleudert:
als der Rumpf „Tausende zur Meerestiefe führte". Ganz in der
Art der epigonischen Rhetorik, gegen welche die Moderne einst
revolutioniert hat, unterstreicht er ein Substantiv, indem er es
mit dem Pronomen aufnimmt: „der Tod, er lenkte selbst", „der
Tod, er stellt den Kurs", „eine Hand, die mich ins Leben weist,
sie muß des Buches Seiten rasch zerknüllen". Und welche Fülle
von undichterischen Bildern und Dergleichen; banale: „der Tod
hält noch ein wildes Fest", unangeschaute Phrasen: „der Kapitän
darf stolz die Hoffnung noch nicht sinken sehen", „doch sitzt Gefahr
dem Menschen an der Kehle, springt leicht der Zweifelnde auch
in den Glaubenskahn"; angeschaute Phrasen: „es deckte ihre
Liebsten zu der ungeheure Meeresschild", es ist vielleicht möglich,
das weithin blanke Meer den Schild Poseidons zu heißen, nach
diesem Untergange ist das Bild ohne jede gefühlische und asso-
ziative Werte. Und eine Fülle trivialer oder schiefer Sentenzen
ist vollends in diese qualenreiche Dichtung verstreut: „ach alles Tun
der Sterblichen ist an die Sterblichkeit gebannt".
Viele dieser Mängel — nicht alle — lassen sich, wie bei aus-
führlicher Untersuchung darzutun wäre, erklären aus der Unfähig-
keit, reimhaft zu fügen; nicht das Mittel gehorcht dem Dichter,
er folgt dem Mittel. Dauthendey ist gewiß ein Dichter, das er-
weisen nicht nur lyrische Strophen, das erweisen auch, und vor
allem, Teile seiner Prosa; aber er ist als Versdichter ganz und
gar kein Künstler, ihm fehlt die Fähigkeit, Wertvolles und Unmög-
liches zu unterscheiden: er fühlt nicht, wann ein Rhythmus klingt,
wann ein Gefüge gefügt ist, welches Bild erhellt, und welches
verdunkelt, welcher Reim bindet und welcher ein leeres Echo ist.
Dauthendeys Mängel, in seinen meisten Versbüchern, vor
allem aber in dem Weltreisegedicht „Die geflügelte Erde" und in
dieser Titanic-Dichtung, sind so vielfältig und von grundsätzlicher
Art, daß man ein theoretisches Buch über Dichtung schreiben müßte,
um sie alle aufzuzeigen. Nun stelle man sich aber einmal einen
Maler oder Bildhauer vor, der gleich wenig mit dem Wesen
seiner Kunst und seiner Mittel vertraut wäre und über eine gleich
stümperige Technik verfügte: wohl keine Jury nähme seine Bilder
an. Dauthendey aber gilt als einer unserer ersten Lyriker; in
all den Aufsätzen, die über ihn erscheinen, wird von ihm ge-
sprochen, als seien seine Gedichte reife, ausgetragene Kunstwerke.
Man nimmt Einzelheiten, Zeilen, Strophen für Ganzheiten;
man vergißt, daß es nicht nur auf die Vitalität und nicht nur
Mf die Eindrucksfähigkeit ankommt, sondern letztlich doch wohl
'darauf, daß ein Dichterisches entsteht; das braucht durchaus nicht
immer ein Vollendetes zu sein, ist aber nie ein Gemengsel von
vielem Widerdichterischen und wenigem dichterisch Starken und
schließlich immer doch ein Ganzes. Weil die Sprache auch die
Umgangssprache ist, die jeder beherrscht, glaubt man, hier auf
die speziellen technischen Grundlagen und Mittel nicht eingehen
zu sollen; selbstverständlich wird auch die Wirkung einer Dichtung
wesentlich bestimmt durch den Gebrauch der Mittel, aber man
wird sich nicht darüber klar, während der Kritiker der Malerei, der
Bildnerei, der Baukunst ein greif- und sichtbares alltagfernes
Material vor sich hat und an ihm mit fast wissenschaftlicher Prä-
zision demonstrieren kann. Weil aber eben die Technik des Dichters
die Rede des innersten Menschen ist, wird Kritik der Technik in
der Hand eines sehenden Kritikers von selbst mehr als eine
philologische Analyse oder eine ästhetische Spielerei: Deutung
von Wesen.
Und sie sagt hier: ganz von außen ergreift Dauthendey diese
Stoffe unserer technischen großen Gegenwart; er ist der lässig be-
queme Lyriker im alten Sinn, nicht aber der energisch Arbeitende,
dem die eherne Präzision dieser Epoche im schaffenden Blute
wirkt. Ernst Lissauer.
unstwissenschaftliche Studien.
Gesammelte Aufsätze von Friedrich Schneider. 1. Band:
Kurmainzer Kunst. Herausgegeben von Erwin Hensler. Wies-
baden 1913, Verlag Heinrich Staadt.
Von den drei rheinischen Prälaten, die in den letzten Jahr-
zehnten durch kunstgeschichtliche Studien und praktische Museums-
arbeit sich hervortaten, Franz Bock in Aachen, Friedrich Schneider
in Mainz, Alexander Schnütgen in Köln, zeigt der Mainzer
Domkapitular (gest. 21. September 1907) das feinste Profil.
Bock war mehr Sammler und christlicher Archäolog alten Stils;
Schnütgen, gewiß die blutvollste Persönlichkeit, verdankt seine
Popularität teilweise der lebensbejahenden, saftigen Wesensart,
die so durch und durch „rheinisch" wirkt; Schneider erinnert am
ehesten von den dreien an den kunstsinnigen Kleriker der Renais-
sance. Solange er in seiner Mainzer Domklause lebte, behutsam
und treu schaffend, konnte er sich einer Verehrung erfreuen, wie
sie so ehrlich und warm nur noch seinem gleichfalls verstorbenen,
ihm wesensverwanden Freiburger Freunde F. T. Kraus zu-
strömte. Als er seinen siebzigsten Geburtstag feierte, kam eine
wahrhaft monumentale Festschrift zustande, mit Beiträgen von mehr
als fünfzig Gelehrten, darunter des typisch norddeutschen Prote-
stanten Wilhelm Bode. Schneider besaß eminent viel von der ganz
besonderen, überlegenen geistigen Kultur, wie sie bei den Würden-
trägern der katholischen Kirche auch heute noch gar nicht selten
angetroffen wird, nicht nur bei den Ordensleuten Benedikts,
denen dieser Ruf am ehesten von der Allgemeinheit zugestanden
wird. Eine gesättigte Kultur, die sich auch im Stil der vielen kleinen
Schriften widerspiegelt, von denen ein Teil nun den Freunden
alter Kunst dargeboten wird.
Er hat keine dicken Bücher hinterlassen. In Zeitungen, in
Monatsrevuen und ähnlichen Organen legte er nieder, was ihm
in Mainz und sonst am Mittelrhein beträchtlich schien und als
kunstgeschichtlicher Besitz durch eindringendes Studium von ihm
gemehrt wurde. Häufig war ein aktuelles Ereignis, etwa der
Abbruch eines alten Tores, Anlaß, die Feder in die Hand zu nehmen.
Fast immer geschah es in anmutiger Form, lebendig, aber auch
behaglich — „Hieronymus im Gehäus" glaubt man vor sich zu sehen,
wenn „Altmainzer Erinnerungen" oder die Geschichte der „Branden-
burgischen Domstifts-Kurie zu Mainz" so liebevoll und geduldig
vorgetragen werden. Nur selten dringt durch die Butzenscheiben
etwas vom Lärm des Tags und auch Polemisches wird selten gehört.
Einmal wird tiefer geschürft. „Matthias Grünewald und die
Mystik" ist eines der fesselndsten Kapitel in dem Buche, aber nicht
immer wirkt es überzeugend. Manches allzu Lokal-Mainzerische
hätte wohl bei dieser Sammlung fortbleiben können, aber alles
in allem muß man dem Herausgeber Erwin Hensler für seine
geschickte Redaktion und die gutgeschriebene Einführung Dank
wissen. Ein zweiter Band der „Studien", mit einer eingehenden
Biographie von Schneiders Testamentsvollstrecker, Professor
Joseph Sauer in Freiburg, soll sich bald anschließen.
Walter Cohen.
Verantwortlich: Wilhelm Schäfer. — Druck und Verlag: A. Bagel, Düsseldorf. — Kunstdruckpapier: I. W. Zanders, B.-Gladbach.
Alle redaktionellen Sendungen sind an den Herausgeber Wilhelm Schäfer in Vallendar a. Rh. erbeten.
Tür unverlangte Manuskripte und Rezensionsexemplare wird keine Verpflichtung übernommen. Rückporto ist beizulegen.