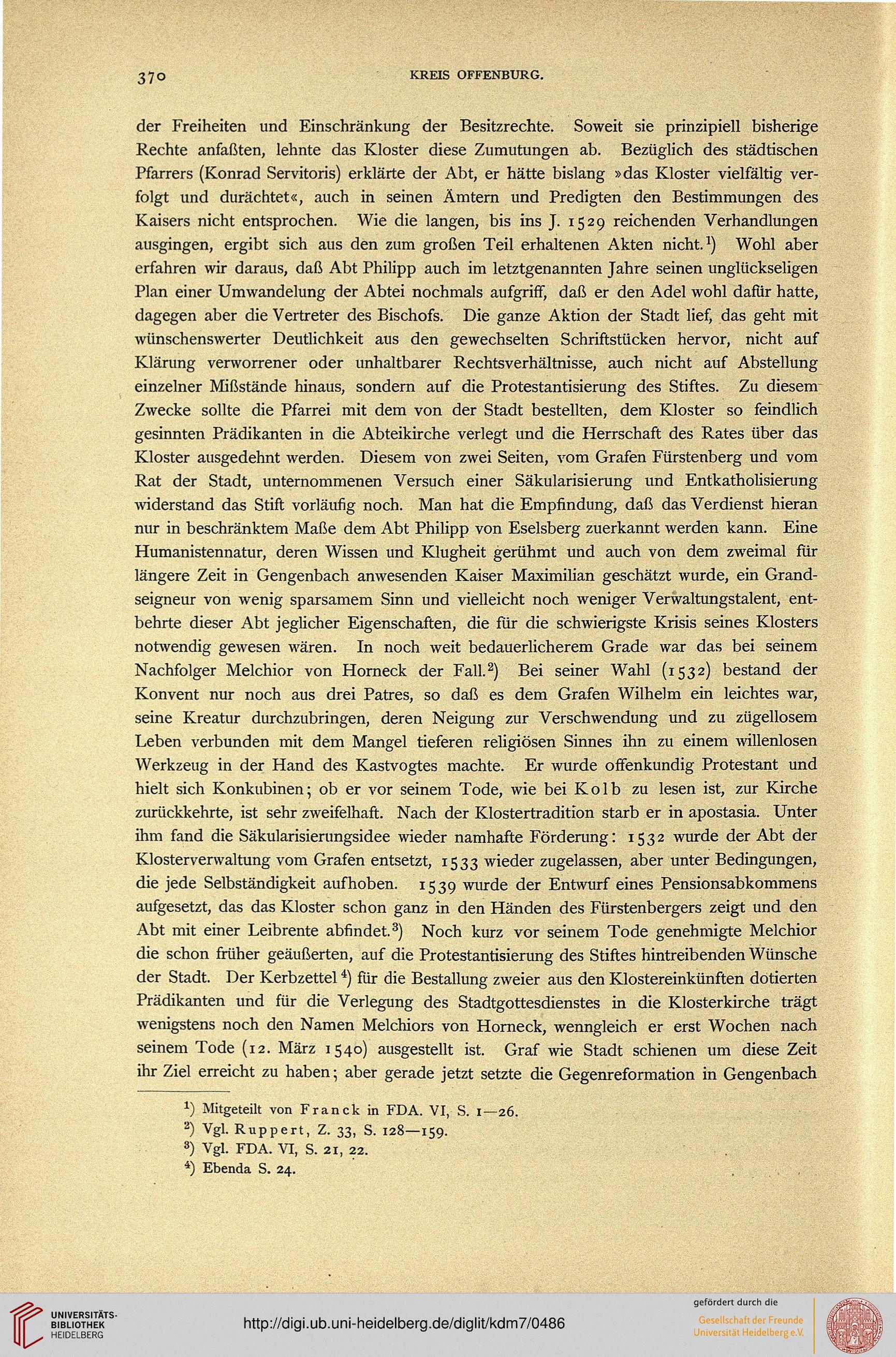370 KREIS OFFENBURG.
der Freiheiten und Einschränkung der Besitzrechte. Soweit sie prinzipiell bisherige
Rechte anfaßten, lehnte das Kloster diese Zumutungen ab. Bezüglich des städtischen
Pfarrers (Konrad Servitoris) erklärte der Abt, er hätte bislang »das Kloster vielfältig ver-
folgt und durächtet«, auch in seinen Ämtern und Predigten den Bestimmungen des
Kaisers nicht entsprochen. Wie die langen, bis ins J. 1529 reichenden Verhandlungen
ausgingen, ergibt sich aus den zum großen Teil erhaltenen Akten nicht.1) Wohl aber
erfahren wir daraus, daß Abt Philipp auch im letztgenannten Jahre seinen unglückseligen
Plan einer Umwandelung der Abtei nochmals aufgriff, daß er den Adel wohl dafür hatte,
dagegen aber die Vertreter des Bischofs. Die ganze Aktion der Stadt lief, das geht mit
wünschenswerter Deutlichkeit aus den gewechselten Schriftstücken hervor, nicht auf
Klärung verworrener oder unhaltbarer Rechtsverhältnisse, auch nicht auf Abstellung
einzelner Mißstände hinaus, sondern auf die Protestantisierung des Stiftes. Zu diesem
Zwecke sollte die Pfarrei mit dem von der Stadt bestellten, dem Kloster so feindlich
gesinnten Prädikanten in die Abteikirche verlegt und die Herrschaft des Rates über das
Kloster ausgedehnt werden. Diesem von zwei Seiten, vom Grafen Fürstenberg und vom
Rat der Stadt, unternommenen Versuch einer Säkularisierung und Entkatholisierung
widerstand das Stift vorläufig noch. Man hat die Empfindung, daß das Verdienst hieran
nur in beschränktem Maße dem Abt Philipp von Eselsberg zuerkannt werden kann. Eine
Humanistennatur, deren Wissen und Klugheit gerühmt und auch von dem zweimal für
längere Zeit in Gengenbach anwesenden Kaiser Maximilian geschätzt wurde, ein Grand-
seigneur von wenig sparsamem Sinn und vielleicht noch weniger Verwaltungstalent, ent-
behrte dieser Abt jeglicher Eigenschaften, die für die schwierigste Krisis seines Klosters
notwendig gewesen wären. In noch weit bedauerlicherem Grade war das bei seinem
Nachfolger Melchior von Horneck der Fall.2) Bei seiner Wahl (1532) bestand der
Konvent nur noch aus drei Patres, so daß es dem Grafen Wilhelm ein leichtes war,
seine Kreatur durchzubringen, deren Neigung zur Verschwendung und zu zügellosem
Leben verbunden mit dem Mangel tieferen religiösen Sinnes ihn zu einem willenlosen
Werkzeug in der Hand des Kastvogtes machte. Er wurde offenkundig Protestant und
hielt sich Konkubinen; ob er vor seinem Tode, wie bei Kolb zu lesen ist, zur Kirche
zurückkehrte, ist sehr zweifelhaft. Nach der Klostertradition starb er in apostasia. Unter
ihm fand die Säkularisierungsidee wieder namhafte Förderung: 1532 wurde der Abt der
Klosterverwaltung vom Grafen entsetzt, 1533 wieder zugelassen, aber unter Bedingungen,
die jede Selbständigkeit aufhoben. 1539 wurde der Entwurf eines Pensionsabkommens
aufgesetzt, das das Kloster schon ganz in den Händen des Fürstenbergers zeigt und den
Abt mit einer Leibrente abfindet.3) Noch kurz vor seinem Tode genehmigte Melchior
die schon früher geäußerten, auf die Protestantisierung des Stiftes hintreibenden Wünsche
der Stadt. Der Kerbzettel4) für die Bestallung zweier aus den Klostereinkünften dotierten
Prädikanten und für die Verlegung des Stadtgottesdienstes in die Klosterkirche trägt
wenigstens noch den Namen Melchiors von Horneck, wenngleich er erst Wochen nach
seinem Tode (12. März 1540) ausgestellt ist. Graf wie Stadt schienen um diese Zeit
ihr Ziel erreicht zu haben; aber gerade jetzt setzte die Gegenreformation in Gengenbach
*) Mitgeteilt von Franck in FDA. VI, S. 1—26.
a) Vgl. Ruppert, Z. 33, S. 128—159.
8) Vgl. FDA. VI, S. 21, 22.
*) Ebenda S. 24.
der Freiheiten und Einschränkung der Besitzrechte. Soweit sie prinzipiell bisherige
Rechte anfaßten, lehnte das Kloster diese Zumutungen ab. Bezüglich des städtischen
Pfarrers (Konrad Servitoris) erklärte der Abt, er hätte bislang »das Kloster vielfältig ver-
folgt und durächtet«, auch in seinen Ämtern und Predigten den Bestimmungen des
Kaisers nicht entsprochen. Wie die langen, bis ins J. 1529 reichenden Verhandlungen
ausgingen, ergibt sich aus den zum großen Teil erhaltenen Akten nicht.1) Wohl aber
erfahren wir daraus, daß Abt Philipp auch im letztgenannten Jahre seinen unglückseligen
Plan einer Umwandelung der Abtei nochmals aufgriff, daß er den Adel wohl dafür hatte,
dagegen aber die Vertreter des Bischofs. Die ganze Aktion der Stadt lief, das geht mit
wünschenswerter Deutlichkeit aus den gewechselten Schriftstücken hervor, nicht auf
Klärung verworrener oder unhaltbarer Rechtsverhältnisse, auch nicht auf Abstellung
einzelner Mißstände hinaus, sondern auf die Protestantisierung des Stiftes. Zu diesem
Zwecke sollte die Pfarrei mit dem von der Stadt bestellten, dem Kloster so feindlich
gesinnten Prädikanten in die Abteikirche verlegt und die Herrschaft des Rates über das
Kloster ausgedehnt werden. Diesem von zwei Seiten, vom Grafen Fürstenberg und vom
Rat der Stadt, unternommenen Versuch einer Säkularisierung und Entkatholisierung
widerstand das Stift vorläufig noch. Man hat die Empfindung, daß das Verdienst hieran
nur in beschränktem Maße dem Abt Philipp von Eselsberg zuerkannt werden kann. Eine
Humanistennatur, deren Wissen und Klugheit gerühmt und auch von dem zweimal für
längere Zeit in Gengenbach anwesenden Kaiser Maximilian geschätzt wurde, ein Grand-
seigneur von wenig sparsamem Sinn und vielleicht noch weniger Verwaltungstalent, ent-
behrte dieser Abt jeglicher Eigenschaften, die für die schwierigste Krisis seines Klosters
notwendig gewesen wären. In noch weit bedauerlicherem Grade war das bei seinem
Nachfolger Melchior von Horneck der Fall.2) Bei seiner Wahl (1532) bestand der
Konvent nur noch aus drei Patres, so daß es dem Grafen Wilhelm ein leichtes war,
seine Kreatur durchzubringen, deren Neigung zur Verschwendung und zu zügellosem
Leben verbunden mit dem Mangel tieferen religiösen Sinnes ihn zu einem willenlosen
Werkzeug in der Hand des Kastvogtes machte. Er wurde offenkundig Protestant und
hielt sich Konkubinen; ob er vor seinem Tode, wie bei Kolb zu lesen ist, zur Kirche
zurückkehrte, ist sehr zweifelhaft. Nach der Klostertradition starb er in apostasia. Unter
ihm fand die Säkularisierungsidee wieder namhafte Förderung: 1532 wurde der Abt der
Klosterverwaltung vom Grafen entsetzt, 1533 wieder zugelassen, aber unter Bedingungen,
die jede Selbständigkeit aufhoben. 1539 wurde der Entwurf eines Pensionsabkommens
aufgesetzt, das das Kloster schon ganz in den Händen des Fürstenbergers zeigt und den
Abt mit einer Leibrente abfindet.3) Noch kurz vor seinem Tode genehmigte Melchior
die schon früher geäußerten, auf die Protestantisierung des Stiftes hintreibenden Wünsche
der Stadt. Der Kerbzettel4) für die Bestallung zweier aus den Klostereinkünften dotierten
Prädikanten und für die Verlegung des Stadtgottesdienstes in die Klosterkirche trägt
wenigstens noch den Namen Melchiors von Horneck, wenngleich er erst Wochen nach
seinem Tode (12. März 1540) ausgestellt ist. Graf wie Stadt schienen um diese Zeit
ihr Ziel erreicht zu haben; aber gerade jetzt setzte die Gegenreformation in Gengenbach
*) Mitgeteilt von Franck in FDA. VI, S. 1—26.
a) Vgl. Ruppert, Z. 33, S. 128—159.
8) Vgl. FDA. VI, S. 21, 22.
*) Ebenda S. 24.