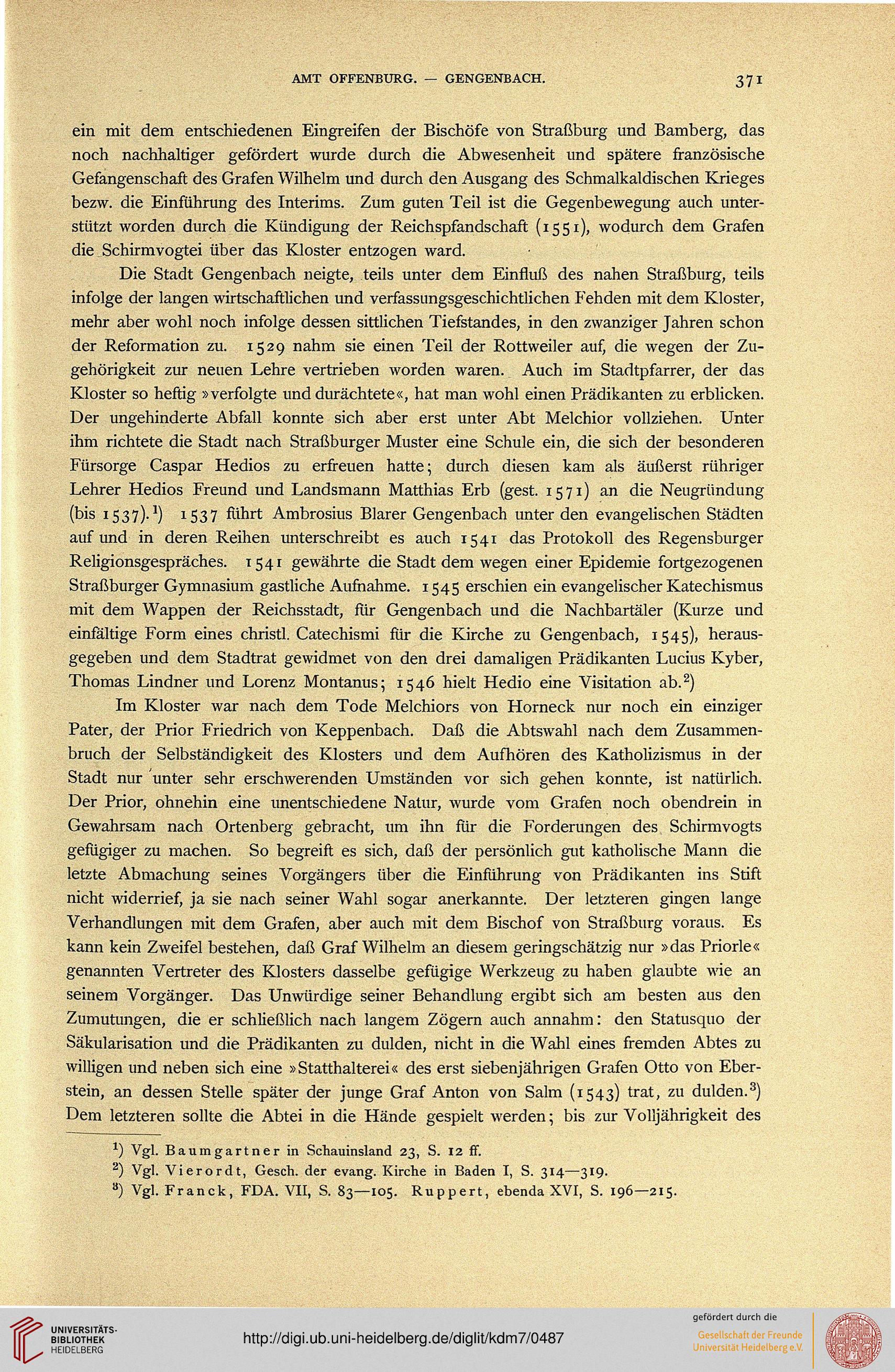AMT OFFENBURG. — GENGENBACH. 37 I
ein mit dem entschiedenen Eingreifen der Bischöfe von Straßburg und Bamberg, das
noch nachhaltiger gefördert wurde durch die Abwesenheit und spätere französische
Gefangenschaft des Grafen Wilhelm und durch den Ausgang des Schmalkaldischen Krieges
bezw. die Einführung des Interims. Zum guten Teil ist die Gegenbewegung auch unter-
stützt worden durch die Kündigung der Reichspfandschaft (1551), wodurch dem Grafen
die Schirmvogtei über das Kloster entzogen ward.
Die Stadt Gengenbach neigte, teils unter dem Einfluß des nahen Straßburg, teils
infolge der langen wirtschaftlichen und verfassungsgeschichtlichen Fehden mit dem Kloster,
mehr aber wohl noch infolge dessen sittlichen Tiefstandes, in den zwanziger Jahren schon
der Reformation zu. 1529 nahm sie einen Teil der Rottweiler auf, die wegen der Zu-
gehörigkeit zur neuen Lehre vertrieben worden waren. Auch im Stadtpfarrer, der das
Kloster so heftig »verfolgte und durächtete«, hat man wohl einen Prädikanten zu erblicken.
Der ungehinderte Abfall konnte sich aber erst unter Abt Melchior vollziehen. Unter
ihm richtete die Stadt nach Straßburger Muster eine Schule ein, die sich der besonderen
Fürsorge Caspar Hedios zu erfreuen hatte; durch diesen kam als äußerst rühriger
Lehrer Hedios Freund und Landsmann Matthias Erb (gest. 1571) an die Neugründung
(bis 1537)-1) 1537 fuhrt Ambrosius Blarer Gengenbach unter den evangelischen Städten
auf und in deren Reihen unterschreibt es auch 15 41 das Protokoll des Regensburger
Religionsgespräches. 1541 gewährte die Stadt dem wegen einer Epidemie fortgezogenen
Straßburger Gymnasium gastliche Aufnahme. 1545 erschien ein evangelischer Katechismus
mit dem Wappen der Reichsstadt, für Gengenbach und die Nachbartäler (Kurze und
einfältige Form eines christl. Catechismi für die Kirche zu Gengenbach, 1545), heraus-
gegeben und dem Stadtrat gewidmet von den drei damaligen Prädikanten Lucius Kyber,
Thomas Lindner und Lorenz Montanus; 1546 hielt Hedio eine Visitation ab.2)
Im Kloster war nach dem Tode Melchiors von Horneck nur noch ein einziger
Pater, der Prior Friedrich von Keppenbach. Daß die Abtswahl nach dem Zusammen-
bruch der Selbständigkeit des Klosters und dem Aufhören des Katholizismus in der
Stadt nur unter sehr erschwerenden Umständen vor sich gehen konnte, ist natürlich.
Der Prior, ohnehin eine unentschiedene Natur, wurde vom Grafen noch obendrein in
Gewahrsam nach Ortenberg gebracht, um ihn für die Forderungen des Schirmvogts
gefügiger zu machen. So begreift es sich, daß der persönlich gut katholische Mann die
letzte Abmachung seines Vorgängers über die Einführung von Prädikanten ins Stift
nicht widerrief, ja sie nach seiner Wahl sogar anerkannte. Der letzteren gingen lange
Verhandlungen mit dem Grafen, aber auch mit dem Bischof von Straßburg voraus. Es
kann kein Zweifel bestehen, daß Graf Wilhelm an diesem geringschätzig nur »das Priorle«
genannten Vertreter des Klosters dasselbe gefügige Werkzeug zu haben glaubte wie an
seinem Vorgänger. Das Unwürdige seiner Behandlung ergibt sich am besten aus den
Zumutungen, die er schließlich nach langem Zögern auch annahm: den Statusquo der
Säkularisation und die Prädikanten zu dulden, nicht in die Wahl eines fremden Abtes zu
willigen und neben sich eine »Statthalterei« des erst siebenjährigen Grafen Otto von Eber-
stein, an dessen Stelle später der junge Graf Anton von Salm (1543) trat, zu dulden.3)
Dem letzteren sollte die Abtei in die Hände gespielt werden; bis zur Volljährigkeit des
y Vgl. Baumgartner in Schauinsland 23, S. 12 ff.
2) Vgl. Vierordt, Gesch. der evang. Kirche in Baden I, S. 314—319.
8) Vgl. Franck, FDA. VII, S. 83—105. Ruppert, ebenda XVI, S. 196—215.
.
ein mit dem entschiedenen Eingreifen der Bischöfe von Straßburg und Bamberg, das
noch nachhaltiger gefördert wurde durch die Abwesenheit und spätere französische
Gefangenschaft des Grafen Wilhelm und durch den Ausgang des Schmalkaldischen Krieges
bezw. die Einführung des Interims. Zum guten Teil ist die Gegenbewegung auch unter-
stützt worden durch die Kündigung der Reichspfandschaft (1551), wodurch dem Grafen
die Schirmvogtei über das Kloster entzogen ward.
Die Stadt Gengenbach neigte, teils unter dem Einfluß des nahen Straßburg, teils
infolge der langen wirtschaftlichen und verfassungsgeschichtlichen Fehden mit dem Kloster,
mehr aber wohl noch infolge dessen sittlichen Tiefstandes, in den zwanziger Jahren schon
der Reformation zu. 1529 nahm sie einen Teil der Rottweiler auf, die wegen der Zu-
gehörigkeit zur neuen Lehre vertrieben worden waren. Auch im Stadtpfarrer, der das
Kloster so heftig »verfolgte und durächtete«, hat man wohl einen Prädikanten zu erblicken.
Der ungehinderte Abfall konnte sich aber erst unter Abt Melchior vollziehen. Unter
ihm richtete die Stadt nach Straßburger Muster eine Schule ein, die sich der besonderen
Fürsorge Caspar Hedios zu erfreuen hatte; durch diesen kam als äußerst rühriger
Lehrer Hedios Freund und Landsmann Matthias Erb (gest. 1571) an die Neugründung
(bis 1537)-1) 1537 fuhrt Ambrosius Blarer Gengenbach unter den evangelischen Städten
auf und in deren Reihen unterschreibt es auch 15 41 das Protokoll des Regensburger
Religionsgespräches. 1541 gewährte die Stadt dem wegen einer Epidemie fortgezogenen
Straßburger Gymnasium gastliche Aufnahme. 1545 erschien ein evangelischer Katechismus
mit dem Wappen der Reichsstadt, für Gengenbach und die Nachbartäler (Kurze und
einfältige Form eines christl. Catechismi für die Kirche zu Gengenbach, 1545), heraus-
gegeben und dem Stadtrat gewidmet von den drei damaligen Prädikanten Lucius Kyber,
Thomas Lindner und Lorenz Montanus; 1546 hielt Hedio eine Visitation ab.2)
Im Kloster war nach dem Tode Melchiors von Horneck nur noch ein einziger
Pater, der Prior Friedrich von Keppenbach. Daß die Abtswahl nach dem Zusammen-
bruch der Selbständigkeit des Klosters und dem Aufhören des Katholizismus in der
Stadt nur unter sehr erschwerenden Umständen vor sich gehen konnte, ist natürlich.
Der Prior, ohnehin eine unentschiedene Natur, wurde vom Grafen noch obendrein in
Gewahrsam nach Ortenberg gebracht, um ihn für die Forderungen des Schirmvogts
gefügiger zu machen. So begreift es sich, daß der persönlich gut katholische Mann die
letzte Abmachung seines Vorgängers über die Einführung von Prädikanten ins Stift
nicht widerrief, ja sie nach seiner Wahl sogar anerkannte. Der letzteren gingen lange
Verhandlungen mit dem Grafen, aber auch mit dem Bischof von Straßburg voraus. Es
kann kein Zweifel bestehen, daß Graf Wilhelm an diesem geringschätzig nur »das Priorle«
genannten Vertreter des Klosters dasselbe gefügige Werkzeug zu haben glaubte wie an
seinem Vorgänger. Das Unwürdige seiner Behandlung ergibt sich am besten aus den
Zumutungen, die er schließlich nach langem Zögern auch annahm: den Statusquo der
Säkularisation und die Prädikanten zu dulden, nicht in die Wahl eines fremden Abtes zu
willigen und neben sich eine »Statthalterei« des erst siebenjährigen Grafen Otto von Eber-
stein, an dessen Stelle später der junge Graf Anton von Salm (1543) trat, zu dulden.3)
Dem letzteren sollte die Abtei in die Hände gespielt werden; bis zur Volljährigkeit des
y Vgl. Baumgartner in Schauinsland 23, S. 12 ff.
2) Vgl. Vierordt, Gesch. der evang. Kirche in Baden I, S. 314—319.
8) Vgl. Franck, FDA. VII, S. 83—105. Ruppert, ebenda XVI, S. 196—215.
.