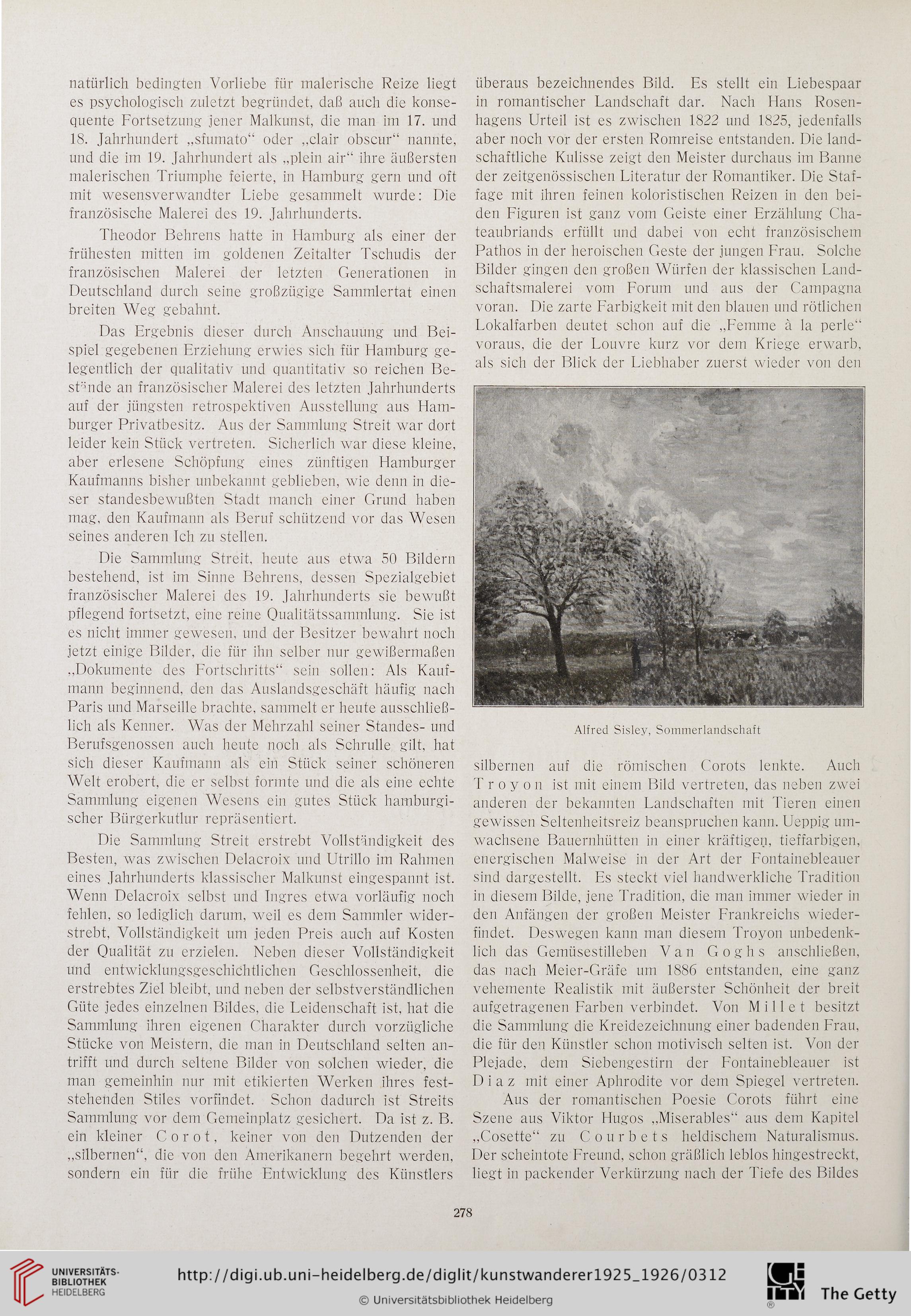natürlich bedingten Vorliebe für malerische Reize liegt
es psychologisch zuletzt begründet, daß auch die konse-
quente Fortsetzung jener Malkunst, die man im 17. und
18. Jahrhundert „sfumato“ oder „clair obscur“ nannte,
und die im 19. Jahrhundert als „plein air“ ihre äußersten
malerischen Triumphe feierte, in Hamburg gern und oft
mit wesensverwandter Liebe gesammelt wurde: Die
französische Malerei des 19. Jahrhunderts.
Theodor Behrens hatte in Hamburg als einer der
frühesten mitten im goldenen Zeitalter Tschudis der
französischen Malerei der letzten Generationen in
Deutschland durch seine großzügige Sammlertat einen
breiten Weg gebahnt.
Das Ergebnis dieser durch Anschauung und Bei-
spiel gegebenen Erziehung jerwies sich für Hamburg ge-
legentlich der qualitativ und quantitativ so reichen Be-
stmde an französischer Malerei des letzten Jahrhunderts
auf der jüngsten retrospektiven Ausstellung aus Ham-
burger Privatbesitz. Aus der Sammlung Streit war dort
leider kein Stück vertreten. Sicherlich war diese kleine,
aber erlesene Schöpfung eines zünftigen Hamburger
Kaufmanns bisher unbekannt geblieben, wie denn in die-
ser standesbewußten Stadt manch einer Grund haben
mag, den Kaufmann als Beruf schützend vor das Wesen
seines anderen Ich zu stellen.
Die Sammlung Streit, heute aus etwa 50 Bildern
bestehend, ist im Sinne Behrens, dessen Spezialgebiet
französischer Malerei des 19. Jahrhunderts sie bewnßt
pflegend fortsetzt, eine reine Qualitätssammlung. Sie ist
es nicht immer gewesen, und der Besitzer bewahrt noch
jetzt einige Bilder, die für ihn selber nur gewißermaßen
„Dokumente des Fortschritts“ sein sollen: Als Kauf-
mann beginnend, den das Auslandsgeschäft häufig nach
Paris und Marseille brachte, sammelt er heute ausschließ-
lich als Kenner. Was der Mehrzahl seiner Standes- und
Berufsgenossen auch heute noch als Schrulle gilt, hat
sich dieser Kaufmann als ein Stück seiner schöneren
Welt erobert, die er selbst formte und die als eine echte
Sammlung eigenen Wesens ein gutes Stück hamburgi-
scher Bürgerkutlur repräsentiert.
Die Sammlung Streit erstrebt Vollständigkeit des
Besten, was zwischen Delacroix und Utrillo im Rahmen
eines Jahrhunderts klassischer Malkunst eingespannt ist.
Wenn Delacroix selbst und Ingres etwa vorläufig noch
fehlen, so lediglich darum, weil es dem Sammler wider-
strebt, Vollständigkeit um jeden Preis auch auf Kosten
der Qualität zu erzielen. Neben dieser Vollständigkeit
und entwicklungsgeschichtlichen Geschlossenheit, die
erstrebtes Ziel bleibt, und neben der selbstverständlichen
Güte jedes einzelnen Bildes, die Leidenschaft ist, hat die
Sammlung ihren eigenen Charakter durch vorzügliche
Stücke von Meistern, die man in Deutschland selten an-
trifft und durch seltene Bilder von solchen wieder, die
man gemeinhin nur mit etikierten Werken ihres fest-
stehenden Stiles vorfindet. Schon dadurch ist Streits
Sammlung vor dem Gemeinplatz gesichert. Da ist z. B.
ein kleiner C o r o t, keiner von den Dutzenden der
„silbernen“, die von den Amerikanern begehrt werden,
sondern ein für die friihe Entwicklung des Künstlers
überaus bezeichnendes Bild. Es stellt ein Liebespaar
in romantischer Landschaft dar. Nach Hans Rosen-
hagens Urteil ist es zwischen 1822 und 1825, jedenfalls
aber noch vor der ersten Romreise entstanden. Die land-
schaftliche Kulisse zeigt den Meister durchaus im Banne
der zeitgenössischen Literatur der Romantiker. Die Staf-
fage mit ihren feinen koloristischen Reizen in den bei-
den Figuren ist ganz vom Geiste einer Erzählung Cha-
teaubriands erfüllt und dabei von echt französischem
Pathos in der heroischen Geste der jungen Frau. Solche
Bilder gingen den großen Würfen der klassischen Land-
schaftsmalerei vom Forum und aus der Campagna
voran. Die zarte Farbigkeit mit den blauen und rötlichen
Lokalfarben deutet schon auf die „Femme ä la perle“
voraus, die der Louvre kurz vor dem Kriege erwarb,
als sich der Blick der Liebhaber zuerst wieder von den
Alfred Sislej^, Sommerlandschaft
silbernen auf die römischen Corots lenkte. Auch
T r o y o n ist mit einem Bild vertreten, das neben zwei
anderen der bekannten Landschaften mit Tieren einen
gewissen Seltenheitsreiz beanspruchen kann. Ueppig um-
wachsene Bauernhütten in einer kräftigen, tieffarbigen,
energischen Malweise in der Art der Fontainebleauer
sind dargestellt. Es steckt viel handwerkliche Tradition
in diesem Bilde, jene Tradition, die man immer wieder in
den Anfängen der großen Meister Frankreichs wieder-
findet. Deswegen kann man diesem Troyon unbedenk-
lich das Gemüsestilleben Van Goghs anschließen,
das nach Meier-Gräfe um 1886 entstanden, eine ganz
vehemente Realistik mit äußerster Schönheit der breit
aufgetragenen Farben verbindet. Von M i 11 e t besitzt
die Sammlung die Kreidezeichnung einer badenden Frau,
die für den Künstler schon motivisch selten ist. Von der
Plejade, dem Siebengestirn der Fontainebleauer ist
D i a z mit einer Aphrodite vor dem Spiegel vertreten.
Aus der romantischen Poesie Corots führt eine
Szene aus Viktor Hugos „Miserables“ aus dem Kapitel
„Cosette“ zu C- o u r b e t s heldischem Naturalismus.
Der scheintote Freund, schon gräßlicli leblos hingestreckt,
liegt in packender Verkürzung nach der Tiefe des Bildes
278
es psychologisch zuletzt begründet, daß auch die konse-
quente Fortsetzung jener Malkunst, die man im 17. und
18. Jahrhundert „sfumato“ oder „clair obscur“ nannte,
und die im 19. Jahrhundert als „plein air“ ihre äußersten
malerischen Triumphe feierte, in Hamburg gern und oft
mit wesensverwandter Liebe gesammelt wurde: Die
französische Malerei des 19. Jahrhunderts.
Theodor Behrens hatte in Hamburg als einer der
frühesten mitten im goldenen Zeitalter Tschudis der
französischen Malerei der letzten Generationen in
Deutschland durch seine großzügige Sammlertat einen
breiten Weg gebahnt.
Das Ergebnis dieser durch Anschauung und Bei-
spiel gegebenen Erziehung jerwies sich für Hamburg ge-
legentlich der qualitativ und quantitativ so reichen Be-
stmde an französischer Malerei des letzten Jahrhunderts
auf der jüngsten retrospektiven Ausstellung aus Ham-
burger Privatbesitz. Aus der Sammlung Streit war dort
leider kein Stück vertreten. Sicherlich war diese kleine,
aber erlesene Schöpfung eines zünftigen Hamburger
Kaufmanns bisher unbekannt geblieben, wie denn in die-
ser standesbewußten Stadt manch einer Grund haben
mag, den Kaufmann als Beruf schützend vor das Wesen
seines anderen Ich zu stellen.
Die Sammlung Streit, heute aus etwa 50 Bildern
bestehend, ist im Sinne Behrens, dessen Spezialgebiet
französischer Malerei des 19. Jahrhunderts sie bewnßt
pflegend fortsetzt, eine reine Qualitätssammlung. Sie ist
es nicht immer gewesen, und der Besitzer bewahrt noch
jetzt einige Bilder, die für ihn selber nur gewißermaßen
„Dokumente des Fortschritts“ sein sollen: Als Kauf-
mann beginnend, den das Auslandsgeschäft häufig nach
Paris und Marseille brachte, sammelt er heute ausschließ-
lich als Kenner. Was der Mehrzahl seiner Standes- und
Berufsgenossen auch heute noch als Schrulle gilt, hat
sich dieser Kaufmann als ein Stück seiner schöneren
Welt erobert, die er selbst formte und die als eine echte
Sammlung eigenen Wesens ein gutes Stück hamburgi-
scher Bürgerkutlur repräsentiert.
Die Sammlung Streit erstrebt Vollständigkeit des
Besten, was zwischen Delacroix und Utrillo im Rahmen
eines Jahrhunderts klassischer Malkunst eingespannt ist.
Wenn Delacroix selbst und Ingres etwa vorläufig noch
fehlen, so lediglich darum, weil es dem Sammler wider-
strebt, Vollständigkeit um jeden Preis auch auf Kosten
der Qualität zu erzielen. Neben dieser Vollständigkeit
und entwicklungsgeschichtlichen Geschlossenheit, die
erstrebtes Ziel bleibt, und neben der selbstverständlichen
Güte jedes einzelnen Bildes, die Leidenschaft ist, hat die
Sammlung ihren eigenen Charakter durch vorzügliche
Stücke von Meistern, die man in Deutschland selten an-
trifft und durch seltene Bilder von solchen wieder, die
man gemeinhin nur mit etikierten Werken ihres fest-
stehenden Stiles vorfindet. Schon dadurch ist Streits
Sammlung vor dem Gemeinplatz gesichert. Da ist z. B.
ein kleiner C o r o t, keiner von den Dutzenden der
„silbernen“, die von den Amerikanern begehrt werden,
sondern ein für die friihe Entwicklung des Künstlers
überaus bezeichnendes Bild. Es stellt ein Liebespaar
in romantischer Landschaft dar. Nach Hans Rosen-
hagens Urteil ist es zwischen 1822 und 1825, jedenfalls
aber noch vor der ersten Romreise entstanden. Die land-
schaftliche Kulisse zeigt den Meister durchaus im Banne
der zeitgenössischen Literatur der Romantiker. Die Staf-
fage mit ihren feinen koloristischen Reizen in den bei-
den Figuren ist ganz vom Geiste einer Erzählung Cha-
teaubriands erfüllt und dabei von echt französischem
Pathos in der heroischen Geste der jungen Frau. Solche
Bilder gingen den großen Würfen der klassischen Land-
schaftsmalerei vom Forum und aus der Campagna
voran. Die zarte Farbigkeit mit den blauen und rötlichen
Lokalfarben deutet schon auf die „Femme ä la perle“
voraus, die der Louvre kurz vor dem Kriege erwarb,
als sich der Blick der Liebhaber zuerst wieder von den
Alfred Sislej^, Sommerlandschaft
silbernen auf die römischen Corots lenkte. Auch
T r o y o n ist mit einem Bild vertreten, das neben zwei
anderen der bekannten Landschaften mit Tieren einen
gewissen Seltenheitsreiz beanspruchen kann. Ueppig um-
wachsene Bauernhütten in einer kräftigen, tieffarbigen,
energischen Malweise in der Art der Fontainebleauer
sind dargestellt. Es steckt viel handwerkliche Tradition
in diesem Bilde, jene Tradition, die man immer wieder in
den Anfängen der großen Meister Frankreichs wieder-
findet. Deswegen kann man diesem Troyon unbedenk-
lich das Gemüsestilleben Van Goghs anschließen,
das nach Meier-Gräfe um 1886 entstanden, eine ganz
vehemente Realistik mit äußerster Schönheit der breit
aufgetragenen Farben verbindet. Von M i 11 e t besitzt
die Sammlung die Kreidezeichnung einer badenden Frau,
die für den Künstler schon motivisch selten ist. Von der
Plejade, dem Siebengestirn der Fontainebleauer ist
D i a z mit einer Aphrodite vor dem Spiegel vertreten.
Aus der romantischen Poesie Corots führt eine
Szene aus Viktor Hugos „Miserables“ aus dem Kapitel
„Cosette“ zu C- o u r b e t s heldischem Naturalismus.
Der scheintote Freund, schon gräßlicli leblos hingestreckt,
liegt in packender Verkürzung nach der Tiefe des Bildes
278