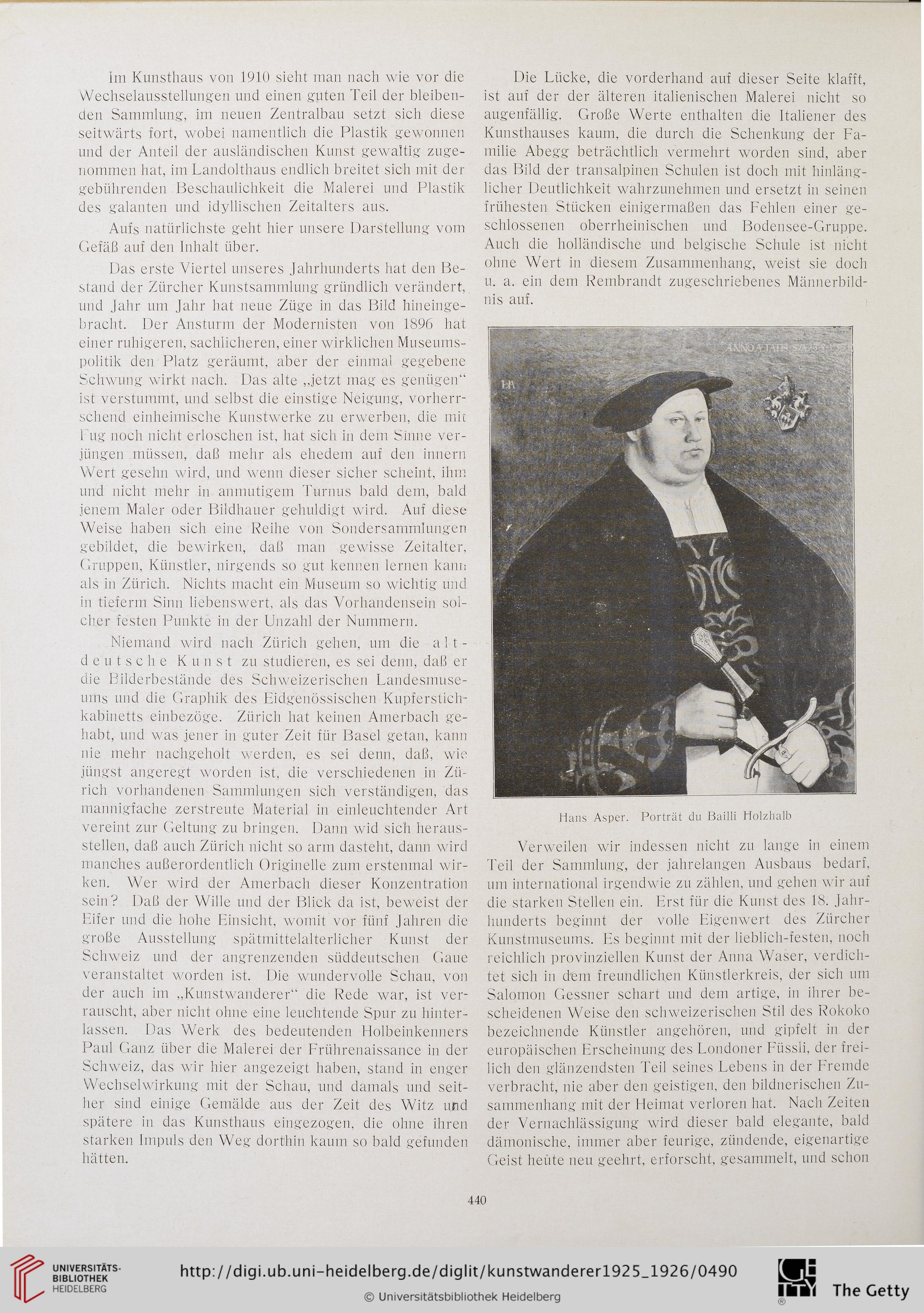Im Kunsthaus von 1910 sieht man nach wie vor die
Wechselausstellungen und einen guten Teil der bleiben-
den Sammlung, im neuen Zentralbau setzt sich diese
seitwärts fort, wobei namentlich die Plastik gewonnen
und der Anteil der ausländischen Kunst gewaltig zuge-
nommen hat, im Landolthaus endlich breitet sich init der
gebührenden Beschanlichkeit die Malerei und Plastik
des galanten und idyllischen Zeitalters aus.
Aufs natürlichste geht hier unsere Darstellung vom
Gefäß auf den Inhalt über.
Das erste Viertel unseres Jahrhunderts hat den Be-
stand der Zürcher Kunstsammlung gründlich verändert,
und Jahr um Jahr hat neue Züge in das Bild hineinge-
braclit. Der Ansturm der Modernisten von 1896 hat
einer ruhigeren, sachlicheren, einer wirklichen Museums-
politik den Platz geräumt, aber der eirimal gegebene
Schwung wirkt nach. Das alte „jetzt mag es genügen“
ist verstummt, und selbst die einstige Neigung, vorherr-
scliend einheimische Kunstwerke zu erwerben, die mii
Fug noch nicht erloschen ist, hat sich in dem Sinne ver-
jüngen müssen, daß mehr als ehedem auf den innern
Wert gesehn wird, und wenn dieser sicher scheint, ihm
und nicht mehr in amnutigem Turnus bald dem, bald
jenem Maler oder Bildhauer geliuldigt wird. Auf diese
Weise haben sich eine Reihe von Sondersarnrnlungen
gebildet, die bewirken, daß man gewisse Zeitalter,
Gruppen, Künstler, nirgends so gut kennen lernen kann
als in Zürich. Nichts macht ein Museum so wichtig und
in tieferm Sinn liebenswert, als das Vorhandensein soi-
cher festen Punkte in der Unzahl der Nummern.
Niemand wird nach Zürich gehen, um die a 11 -
d e u t s c h e K u n s t zu studieren, es sei denn, daß er
die Bilderbestände des Schweizerischen Landesmuse-
ums und die Graphik des Eldgenössischen Kupferstich-
kabinetts einbezöge. Zürich hat keinen Amerbach ge-
habt, und was jener in guter Zeit für Basel getan, kann
nie mehr nachgeholt werden, es sei denn, daß, wie
jüngst angeregt worden ist, die verschiedenen in ZtL
rich vorhandenen Sammlungen sich verständigen, das
mannigfache zerstreute Material in einleuchtender Art
vereint zur Geltung zu bringen. Dann wid sich heraus-
stellen, daß auch Zürich nicht so arm dasteht, dann wird
manches außerordentlich Originelle züm erstenmal wir-
ken. Wer wird der Amerbach dieser Konzentration
sein? Daß der Wille und der Blick da ist, beweist der
Eifer und die hohe Einsicht, womit vor fiinf Jaliren die
große Ausstellung spätmittelalterlicher Kunst der
Schweiz und der angrenzenden süddeutschen Gaue
veranstaltet worden ist. Die wundervolle Schau, von
der auch im „Kunstwanderer“ die Rede war, ist ver-
rauscht, aber nicht ohne eine leuchtende Spur zu hinter-
lassen. Das Werk des bedeutenden Holbeinkenners
Paul Gauz über die Malerei der Frührenaissance in der
Schweiz, das wir hier angezeigt haben, stand in enger
Wechselwirkung mit der Schau, und damals und seit-
her sind einige Gemälde aus der Zeit des Witz iind
spätere iu das Kunsthaus eingezogen, die ohne ihren
starken Impuls den Weg dorthin kaum so bald gefunden
hätten.
Die Lücke, die vorderhand auf dieser Seite klafft,
ist auf der der älteren italienischen Malerei nicht so
augenfällig. Große Werte enthalten die Italiener des
Kunsthauses kaum, die durch die Schenkung der Fa-
milie Abegg beträchtlich vermehrt worden sind, aber
das Bild der transalpinen Schulen ist doch mit hinläng-
licher Deutlichkeit wahrzunehmen und ersetzt in seinen
frühesten Stücken einigermaßen das Fehlen einer ge-
schlossenen oberrheinischen und Bodensee-Gruppe.
Auch die holländische und belgische Schule ist nicht
ohne Wert in diesem Zusammenhang, weist sie doch
u. a. ein dem Rembrandt zugeschriebenes Männerbild-
nis auf.
Hans Asper. Porträt du Bailli Holzhalb
Verweilen wir indessen nicht zu lauge in einem
Teil der Sammlung, der jahrelangen Ausbaus bedarf,
um international irgendwie zu zählen, und gehen wir auf
die starken Stellen ein. Erst fiir die Kunst des 18. Jahr-
hunderts beginnt der volle Eigenwert des Zürcher
Kunstmuseums. Es beginnt mit der lieblich-festen, noch
reichlich provinziellen Kunst der Anna Waser, verdich-
tet sich in dem freundlichen Künstlerkreis, der sich um
Salomon Gessner schart und dem artige, in ihrer be-
scheidenen Weise den schweizerischen Stil des Rokoko
bezeichnende Künstler angehören, und gipfelt in der
europäischen Erscheinung des Londoner Fiissli, der frei-
lich den glänzendsten Teil seines Lebens in der Fremde
verbracht, nie aber den geistigen, den bildnerischen Zn-
sammenhang mit der Heimat verloren hat. Nach Zeiten
der Vernachlässigung wird dieser bald elegante, bald
dämonische, immer aber feurige, zündeude, eigenartige
Geist heute neu geehrt, erforscht, gesammelt, und schon
440
Wechselausstellungen und einen guten Teil der bleiben-
den Sammlung, im neuen Zentralbau setzt sich diese
seitwärts fort, wobei namentlich die Plastik gewonnen
und der Anteil der ausländischen Kunst gewaltig zuge-
nommen hat, im Landolthaus endlich breitet sich init der
gebührenden Beschanlichkeit die Malerei und Plastik
des galanten und idyllischen Zeitalters aus.
Aufs natürlichste geht hier unsere Darstellung vom
Gefäß auf den Inhalt über.
Das erste Viertel unseres Jahrhunderts hat den Be-
stand der Zürcher Kunstsammlung gründlich verändert,
und Jahr um Jahr hat neue Züge in das Bild hineinge-
braclit. Der Ansturm der Modernisten von 1896 hat
einer ruhigeren, sachlicheren, einer wirklichen Museums-
politik den Platz geräumt, aber der eirimal gegebene
Schwung wirkt nach. Das alte „jetzt mag es genügen“
ist verstummt, und selbst die einstige Neigung, vorherr-
scliend einheimische Kunstwerke zu erwerben, die mii
Fug noch nicht erloschen ist, hat sich in dem Sinne ver-
jüngen müssen, daß mehr als ehedem auf den innern
Wert gesehn wird, und wenn dieser sicher scheint, ihm
und nicht mehr in amnutigem Turnus bald dem, bald
jenem Maler oder Bildhauer geliuldigt wird. Auf diese
Weise haben sich eine Reihe von Sondersarnrnlungen
gebildet, die bewirken, daß man gewisse Zeitalter,
Gruppen, Künstler, nirgends so gut kennen lernen kann
als in Zürich. Nichts macht ein Museum so wichtig und
in tieferm Sinn liebenswert, als das Vorhandensein soi-
cher festen Punkte in der Unzahl der Nummern.
Niemand wird nach Zürich gehen, um die a 11 -
d e u t s c h e K u n s t zu studieren, es sei denn, daß er
die Bilderbestände des Schweizerischen Landesmuse-
ums und die Graphik des Eldgenössischen Kupferstich-
kabinetts einbezöge. Zürich hat keinen Amerbach ge-
habt, und was jener in guter Zeit für Basel getan, kann
nie mehr nachgeholt werden, es sei denn, daß, wie
jüngst angeregt worden ist, die verschiedenen in ZtL
rich vorhandenen Sammlungen sich verständigen, das
mannigfache zerstreute Material in einleuchtender Art
vereint zur Geltung zu bringen. Dann wid sich heraus-
stellen, daß auch Zürich nicht so arm dasteht, dann wird
manches außerordentlich Originelle züm erstenmal wir-
ken. Wer wird der Amerbach dieser Konzentration
sein? Daß der Wille und der Blick da ist, beweist der
Eifer und die hohe Einsicht, womit vor fiinf Jaliren die
große Ausstellung spätmittelalterlicher Kunst der
Schweiz und der angrenzenden süddeutschen Gaue
veranstaltet worden ist. Die wundervolle Schau, von
der auch im „Kunstwanderer“ die Rede war, ist ver-
rauscht, aber nicht ohne eine leuchtende Spur zu hinter-
lassen. Das Werk des bedeutenden Holbeinkenners
Paul Gauz über die Malerei der Frührenaissance in der
Schweiz, das wir hier angezeigt haben, stand in enger
Wechselwirkung mit der Schau, und damals und seit-
her sind einige Gemälde aus der Zeit des Witz iind
spätere iu das Kunsthaus eingezogen, die ohne ihren
starken Impuls den Weg dorthin kaum so bald gefunden
hätten.
Die Lücke, die vorderhand auf dieser Seite klafft,
ist auf der der älteren italienischen Malerei nicht so
augenfällig. Große Werte enthalten die Italiener des
Kunsthauses kaum, die durch die Schenkung der Fa-
milie Abegg beträchtlich vermehrt worden sind, aber
das Bild der transalpinen Schulen ist doch mit hinläng-
licher Deutlichkeit wahrzunehmen und ersetzt in seinen
frühesten Stücken einigermaßen das Fehlen einer ge-
schlossenen oberrheinischen und Bodensee-Gruppe.
Auch die holländische und belgische Schule ist nicht
ohne Wert in diesem Zusammenhang, weist sie doch
u. a. ein dem Rembrandt zugeschriebenes Männerbild-
nis auf.
Hans Asper. Porträt du Bailli Holzhalb
Verweilen wir indessen nicht zu lauge in einem
Teil der Sammlung, der jahrelangen Ausbaus bedarf,
um international irgendwie zu zählen, und gehen wir auf
die starken Stellen ein. Erst fiir die Kunst des 18. Jahr-
hunderts beginnt der volle Eigenwert des Zürcher
Kunstmuseums. Es beginnt mit der lieblich-festen, noch
reichlich provinziellen Kunst der Anna Waser, verdich-
tet sich in dem freundlichen Künstlerkreis, der sich um
Salomon Gessner schart und dem artige, in ihrer be-
scheidenen Weise den schweizerischen Stil des Rokoko
bezeichnende Künstler angehören, und gipfelt in der
europäischen Erscheinung des Londoner Fiissli, der frei-
lich den glänzendsten Teil seines Lebens in der Fremde
verbracht, nie aber den geistigen, den bildnerischen Zn-
sammenhang mit der Heimat verloren hat. Nach Zeiten
der Vernachlässigung wird dieser bald elegante, bald
dämonische, immer aber feurige, zündeude, eigenartige
Geist heute neu geehrt, erforscht, gesammelt, und schon
440