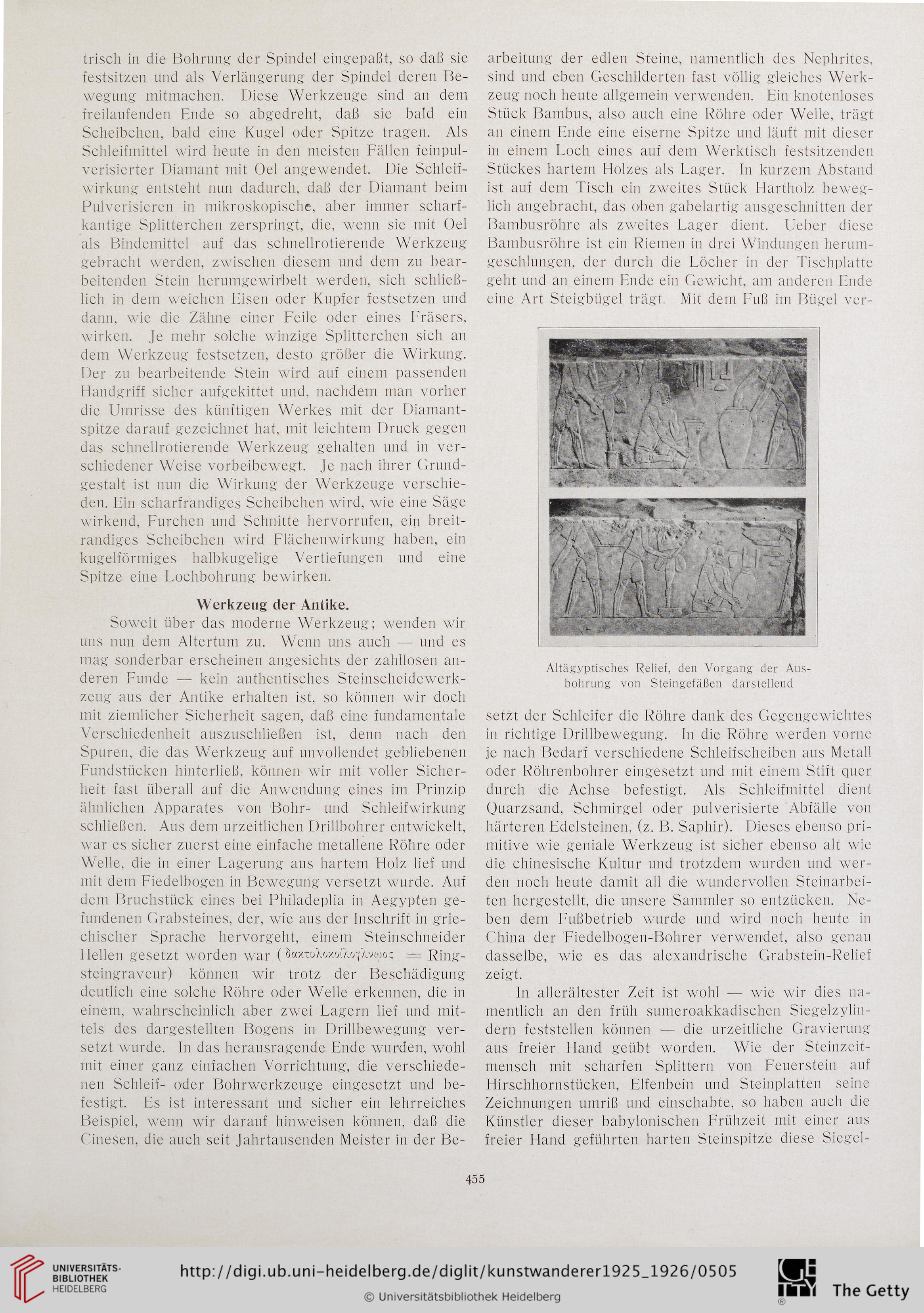trisch in die Bohrung der Spindel eingepaßt, so daß sie
festsitzen und als Yfrlängerung der Spindel deren Be-
wegung mitmachen. Diese Werkzeuge sind an dem
freilaufenden Ende so abgedreht, daß sie bald ein
Scheibchen, bald eine Kugel oder Spitze tragen. Als
Schleifmittel wird heute in den meisten Fällen feinpul-
verisierter Diamant mit Oel angewendet. Die Schleif-
wirkung entsteht nun dadurch, daß der Diamant beim
Pulverisieren in mikroskopische, aber immer scharf-
kantige Splitterchen zerspringt, die, wenn sie mit Oel
als Bindemittel auf das schnellrotierende Werkzeug
gebracht werden, zwischen diesem und dem zu bear-
beiteuden Stein herumgewirbelt werden, sich schließ-
lich in dem weichen Eisen oder Kupfer festsetzen und
dann, wie die Zähne einer Feile oder eines Fräsers,
wirken. Je mehr solche winzige Splitterchen sich an
dem Werkzeug festsetzen, desto größer die Wirkung.
Der zu bearbeitende Stein wird auf einem passeuden
Handgriff sicher aufgekittet und. nachdem man vorher
die Umrisse des künftigen Werkes mit der Diamant-
spitze darauf gezeichnet hat, mit leichtem Druck gegen
das schnellrotierende Werkzeug gehalten und in ver-
schiedener Weise vorbeibewegt. Je nach ihrer Grund-
gestalt ist nun die Wirkung der Werkzeuge verschie-
den. Ein scharfrandiges Scheibchen wird, wie eine Säge
wirkend, Furchen und Schnitte hervorrufen, ein breit-
randiges Scheibchen wird Flächenwirkung haben, ein
kugelförmiges halbkugelige Vertiefungen und eine
Spitze eine Fochbohrung bewirken.
Werkzeug der Aiitike.
Soweit über das moderne Werkzeug; wenden wir
uns nun dem Altertum zu. Wenn uns auch — und es
mag sonderbar erscheinen angesichts der zahllosen an-
deren Funde — kein authentisches Steinscheidewerk-
zeug aus der Antike erhalten ist, so können wir doch
mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß eine fundamentale
Verschiedenheit auszuschließen ist, denn nach den
Spuren, die das Werkzeug auf unvollendet gebliebenen
Fundstücken hinterließ, können wir mit voller Sicher-
heit fast überall auf die Anwendung eines im Prinzip
ähnlichen Apparates von Bohr- und Schleifwirkung
schließen. Aus dem urzeitlichen Drillbohrer entwickelt,
war es sicher zuerst eine einfache metallene Röhre oder
Welle, die in einer Fagerung aus hartem Holz lief und
mit dem Fiedelbogen in Bewegung versetzt wurde. Auf
dem Bruchstück eines bei Philadeplia in Aegypten ge-
fundenen Grabsteines, der, wie aus der Inschrift in grie-
chischer Sprache hervorgeht, einem Steinschneider
Hellen gesetzt worden war ('fc'uXoxoAcqhviooc; = Rmg-
steingraveur) können wir trotz der Beschädigung
deutlich eine solche Röhre oder Welle erkennen, die in
einem, wahrscheinlich aber zwei Fagern lief und mit-
tels des dargestellten Bogens in Drillbewegung ver-
setzt wurde. In das herausragende Ende wurden, wohl
mit einer ganz einfachen Vorrichtung, die verschiede-
nen Schleif- oder Bohrwerkzeuge eingesetzt und be-
festigt. Es ist interessant und sicher ein lehrreiches
Beispiel, wenn wir darauf hinweisen können, daß die
Ginesen, die auch seit Jahrtausenden Meister in der Be-
arbeitung der edlen Steine, namentlich des Nephrites,
sind und eben Geschilderten fast völlig gleiches Werk-
zeug noch heute allgemein verwenden. Ein knotenloses
Stück Barnbus, also auch eine Röhre oder Welle, trägt
an einem Ende eine eiserne Spitze und läuft mit dieser
iu einem Foch eines auf dem Werktisch festsitzenden
Stückes hartem Holzes als Fager. In kurzem Abstand
ist auf dem Tlsch ein zweites Stück Hartholz beweg-
lich angebracht, das oben gabelartig ausgeschnitten der
Bambusröhre als zweites Fager dient. Ueber diese
Bambusröhre ist ein Riemen in drei Windungen herum-
geschlungen, der durch die Föcher in der Tischplatte
geht und an einem Ende ein Gewicht, am anderen Ende
eine Art Steigbügel trägt. Mit dem Fuß im Bügel ver-
Altägyptisches Relief, den Vorgang der Aus-
bohrung von Steingefäßen darstellend
setzt der Schleifer die Röhre dank des Gegengewichtes
in richtige Drillbewegung. In die Röhre werden vorne
je nach Bedarf verschiedene Schleifscheiben aus Metall
oder Röhrenbohrer eingesetzt und mit einem Stift quer
durch die Achse befestigt. Als Schleifmittel dient
Quarzsand, Schmirgel oder pulverisierte Abfälle von
härteren Edelsteinen, (z. B. Saphir). Dieses ebenso pri-
mitive wie geniale Werkzeug ist siclier ebenso alt wie
die chinesische Kultur uud trotzdem wurden und wer-
den noch heute damit all die wundervollen Steinarbei-
ten hergestellt, die unsere Sammler so entzücken. Ne-
ben dem Fußbetrieb wurde und wird noch heute iu
China der Fiedelbogen-Bohrer verwendet, also genau
dasseibe, wie es das alexandrische Grabstein-Relief
zeigt.
In allerältester Zeit ist wohl — wie wir dies na-
mentlich an den früh sumeroakkadischen Siegelzylin-
dern feststellen können — die urzeitliche Gravierung
aus freier Hand geübt worden. Wie der Steinzeit-
mensch mit scharfen Splittern von Feuerstein auf
Hirschhornstücken, Elfenbein und Steinplatten seine
Zeichnungen umriß und einschabte, so haben auch die
Künstler dieser babylonischen Frühzeit mit einer aus
freier Hand geführten harten Steinspitze diese Siegel-
455
festsitzen und als Yfrlängerung der Spindel deren Be-
wegung mitmachen. Diese Werkzeuge sind an dem
freilaufenden Ende so abgedreht, daß sie bald ein
Scheibchen, bald eine Kugel oder Spitze tragen. Als
Schleifmittel wird heute in den meisten Fällen feinpul-
verisierter Diamant mit Oel angewendet. Die Schleif-
wirkung entsteht nun dadurch, daß der Diamant beim
Pulverisieren in mikroskopische, aber immer scharf-
kantige Splitterchen zerspringt, die, wenn sie mit Oel
als Bindemittel auf das schnellrotierende Werkzeug
gebracht werden, zwischen diesem und dem zu bear-
beiteuden Stein herumgewirbelt werden, sich schließ-
lich in dem weichen Eisen oder Kupfer festsetzen und
dann, wie die Zähne einer Feile oder eines Fräsers,
wirken. Je mehr solche winzige Splitterchen sich an
dem Werkzeug festsetzen, desto größer die Wirkung.
Der zu bearbeitende Stein wird auf einem passeuden
Handgriff sicher aufgekittet und. nachdem man vorher
die Umrisse des künftigen Werkes mit der Diamant-
spitze darauf gezeichnet hat, mit leichtem Druck gegen
das schnellrotierende Werkzeug gehalten und in ver-
schiedener Weise vorbeibewegt. Je nach ihrer Grund-
gestalt ist nun die Wirkung der Werkzeuge verschie-
den. Ein scharfrandiges Scheibchen wird, wie eine Säge
wirkend, Furchen und Schnitte hervorrufen, ein breit-
randiges Scheibchen wird Flächenwirkung haben, ein
kugelförmiges halbkugelige Vertiefungen und eine
Spitze eine Fochbohrung bewirken.
Werkzeug der Aiitike.
Soweit über das moderne Werkzeug; wenden wir
uns nun dem Altertum zu. Wenn uns auch — und es
mag sonderbar erscheinen angesichts der zahllosen an-
deren Funde — kein authentisches Steinscheidewerk-
zeug aus der Antike erhalten ist, so können wir doch
mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß eine fundamentale
Verschiedenheit auszuschließen ist, denn nach den
Spuren, die das Werkzeug auf unvollendet gebliebenen
Fundstücken hinterließ, können wir mit voller Sicher-
heit fast überall auf die Anwendung eines im Prinzip
ähnlichen Apparates von Bohr- und Schleifwirkung
schließen. Aus dem urzeitlichen Drillbohrer entwickelt,
war es sicher zuerst eine einfache metallene Röhre oder
Welle, die in einer Fagerung aus hartem Holz lief und
mit dem Fiedelbogen in Bewegung versetzt wurde. Auf
dem Bruchstück eines bei Philadeplia in Aegypten ge-
fundenen Grabsteines, der, wie aus der Inschrift in grie-
chischer Sprache hervorgeht, einem Steinschneider
Hellen gesetzt worden war ('fc'uXoxoAcqhviooc; = Rmg-
steingraveur) können wir trotz der Beschädigung
deutlich eine solche Röhre oder Welle erkennen, die in
einem, wahrscheinlich aber zwei Fagern lief und mit-
tels des dargestellten Bogens in Drillbewegung ver-
setzt wurde. In das herausragende Ende wurden, wohl
mit einer ganz einfachen Vorrichtung, die verschiede-
nen Schleif- oder Bohrwerkzeuge eingesetzt und be-
festigt. Es ist interessant und sicher ein lehrreiches
Beispiel, wenn wir darauf hinweisen können, daß die
Ginesen, die auch seit Jahrtausenden Meister in der Be-
arbeitung der edlen Steine, namentlich des Nephrites,
sind und eben Geschilderten fast völlig gleiches Werk-
zeug noch heute allgemein verwenden. Ein knotenloses
Stück Barnbus, also auch eine Röhre oder Welle, trägt
an einem Ende eine eiserne Spitze und läuft mit dieser
iu einem Foch eines auf dem Werktisch festsitzenden
Stückes hartem Holzes als Fager. In kurzem Abstand
ist auf dem Tlsch ein zweites Stück Hartholz beweg-
lich angebracht, das oben gabelartig ausgeschnitten der
Bambusröhre als zweites Fager dient. Ueber diese
Bambusröhre ist ein Riemen in drei Windungen herum-
geschlungen, der durch die Föcher in der Tischplatte
geht und an einem Ende ein Gewicht, am anderen Ende
eine Art Steigbügel trägt. Mit dem Fuß im Bügel ver-
Altägyptisches Relief, den Vorgang der Aus-
bohrung von Steingefäßen darstellend
setzt der Schleifer die Röhre dank des Gegengewichtes
in richtige Drillbewegung. In die Röhre werden vorne
je nach Bedarf verschiedene Schleifscheiben aus Metall
oder Röhrenbohrer eingesetzt und mit einem Stift quer
durch die Achse befestigt. Als Schleifmittel dient
Quarzsand, Schmirgel oder pulverisierte Abfälle von
härteren Edelsteinen, (z. B. Saphir). Dieses ebenso pri-
mitive wie geniale Werkzeug ist siclier ebenso alt wie
die chinesische Kultur uud trotzdem wurden und wer-
den noch heute damit all die wundervollen Steinarbei-
ten hergestellt, die unsere Sammler so entzücken. Ne-
ben dem Fußbetrieb wurde und wird noch heute iu
China der Fiedelbogen-Bohrer verwendet, also genau
dasseibe, wie es das alexandrische Grabstein-Relief
zeigt.
In allerältester Zeit ist wohl — wie wir dies na-
mentlich an den früh sumeroakkadischen Siegelzylin-
dern feststellen können — die urzeitliche Gravierung
aus freier Hand geübt worden. Wie der Steinzeit-
mensch mit scharfen Splittern von Feuerstein auf
Hirschhornstücken, Elfenbein und Steinplatten seine
Zeichnungen umriß und einschabte, so haben auch die
Künstler dieser babylonischen Frühzeit mit einer aus
freier Hand geführten harten Steinspitze diese Siegel-
455