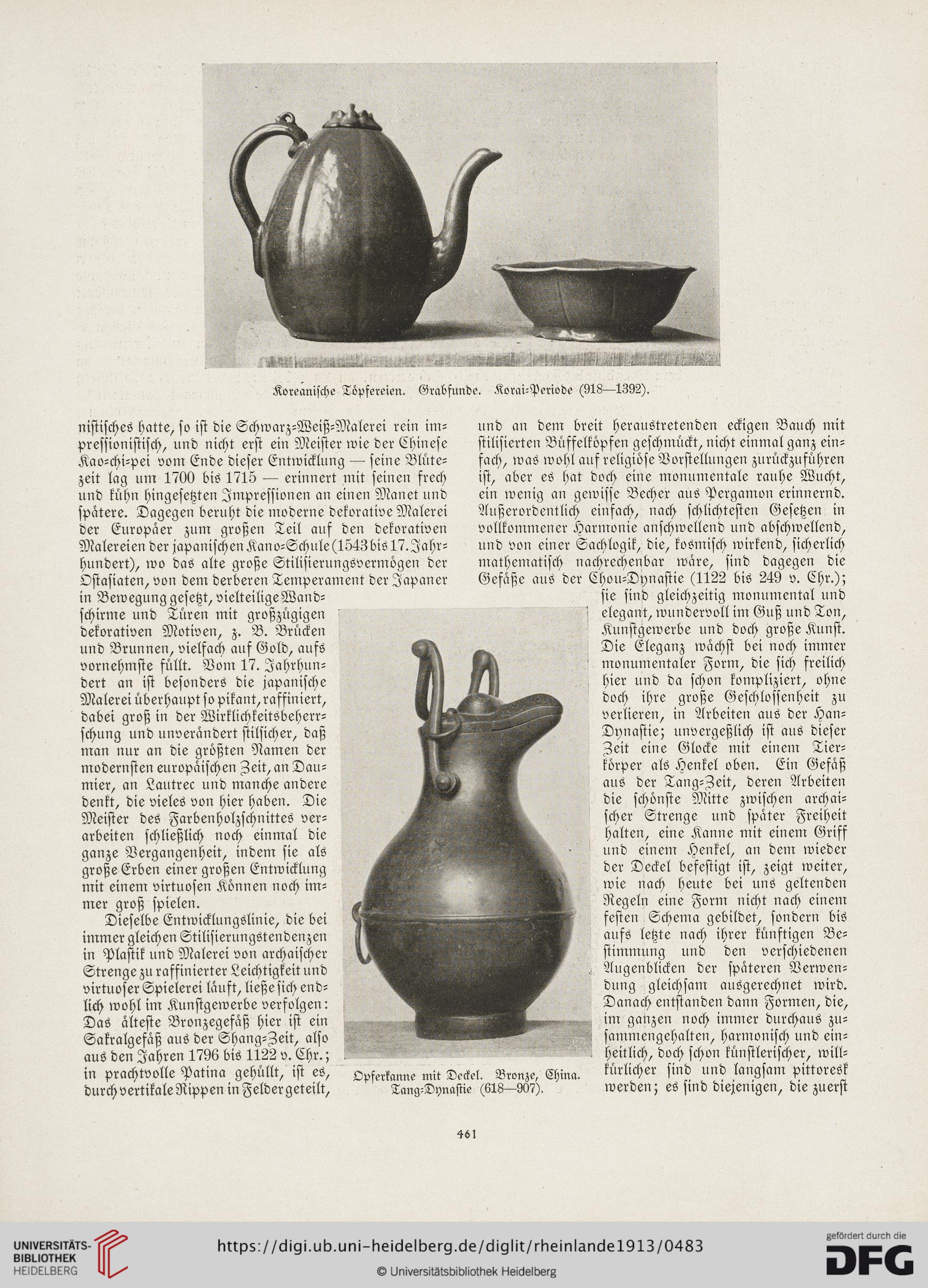Koreanische Töpfereien. Grabfunde. Korai-Periode (918—1392).
nistisches hatte, so ist die Schwarz-Weiß-Malerei rein im-
pressionistisch, und nicht erst ein Meister wie der Chinese
Kao-chi-pei vom Ende dieser Entwicklung — seine Blüte-
zeit lag um 1700 bis 1715 — erinnert mit seinen frech
und kühn hingesetzten Impressionen an einen Manet und
spätere. Dagegen beruht die moderne dekorative Malerei
der Europäer zum großen Teil auf den dekorativen
Malereien der japanischen Kano-Schule(1543bis ^.Jahr-
hundert), wo das alte große Stilisierungsvermögen der
Ostasiaten, von dem derberen Temperament der Japaner-
in Bewegung gesetzt, vielteiligeWand-
schirme und Türen mit großzügigen
dekorativen Motiven, z. B. Brücken
und Brunnen, vielfach auf Gold, aufs
vornehmste füllt. Vom 17. Jahrhun-
dert an ist besonders die japanische
Malerei überhaupt so pikant, raffiniert,
dabei groß in der Wirklichkeitsbeherr-
schung und unverändert stilsicher, daß
man nur an die größten Namen der
modernsten europäischen Aeit, an Dau-
mier, an Lautrec und manche andere
denkt, die vieles von hier haben. Die
Meister des Farbenholzschnittes ver-
arbeiten schließlich noch einmal die
ganze Vergangenheit, indem sie als
große Erben einer großen Entwicklung
mit einem virtuosen Können noch im-
mer groß spielen.
Dieselbe Entwicklungslinie, die bei
immer gleichen Stilisierungstendenzen
in Plastik und Malerei von archaischer
Strenge zu raffinierter Leichtigkeit und
virtuoser Spielerei läuft, ließe sich end-
lich wohl im Kunstgewerbe verfolgen:
Das älteste Bronzegefäß hier ist ein
Sakralgefäß aus der Shang-Aeit, also
aus den Jahren 1796 bis 1122 v. Chr.;
in prachtvolle Patina gehüllt, ist es,
durch vertikale Rippen in Felder geteilt.
und an dem breit heraustretenden eckigen Bauch mit
stilisierten Büffelköpfen geschmückt, nicht einmal ganz ein-
fach, was wohl auf religiöse Vorstellungen zurückzuführen
ist, aber es hat doch eine monumentale rauhe Wucht,
ein wenig an gewisse Becher aus Pergamon erinnernd.
Außerordentlich einfach, nach schlichtesten Gesetzen in
vollkommener Harmonie anschwellend und abschwellend,
und von einer Sachlogik, die, kosmisch wirkend, sicherlich
mathematisch nachrechenbar wäre, sind dagegen die
Gefäße aus der Chou-Dynastie (1122 bis 249 v. Ehr.);
sie sind gleichzeitig monumental und
elegant, wundervoll im Guß und Ton,
Kunstgewerbe und doch große Kunst.
Die Eleganz wächst bei noch immer-
monumentaler Form, die sich freilich
hier und da schon kompliziert, ohne
doch ihre große Geschlossenheit zu
verlieren, in Arbeiten aus der Han-
Dynastie; unvergeßlich ist aus dieser
Zeit eine Glocke mit einen: Tier-
körper als Henkel oben. Ein Gefäß
aus der Tang-Aeit, deren Arbeiten
die schönste Mitte zwischen archai-
scher Strenge und später Freiheit
halten, eine Kanne mit einen: Griff
und einem Henkel, an den: wieder
der Deckel befestigt ist, zeigt weiter,
wie nach heute bei uns geltenden
Regeln eine Form nicht nach einen:
festen Schema gebildet, sondern bis
aufs letzte nach ihrer künftigen Be-
stimmung und den verschiedenen
Augenblicken der späteren Verwen-
dung gleichsam ausgerechnet wird.
Danach entstanden dann Formen, die,
in: ganzen noch immer durchaus zu-
sammengehalten, harmonisch und ein-
heitlich, doch schon künstlerischer, will-
kürlicher sind und langsam pittoresk
werden; es sind diejenigen, die zuerst
Opferkanne mit Deckel. Bronze, China.
Tang-Dynastie (618—907).
461