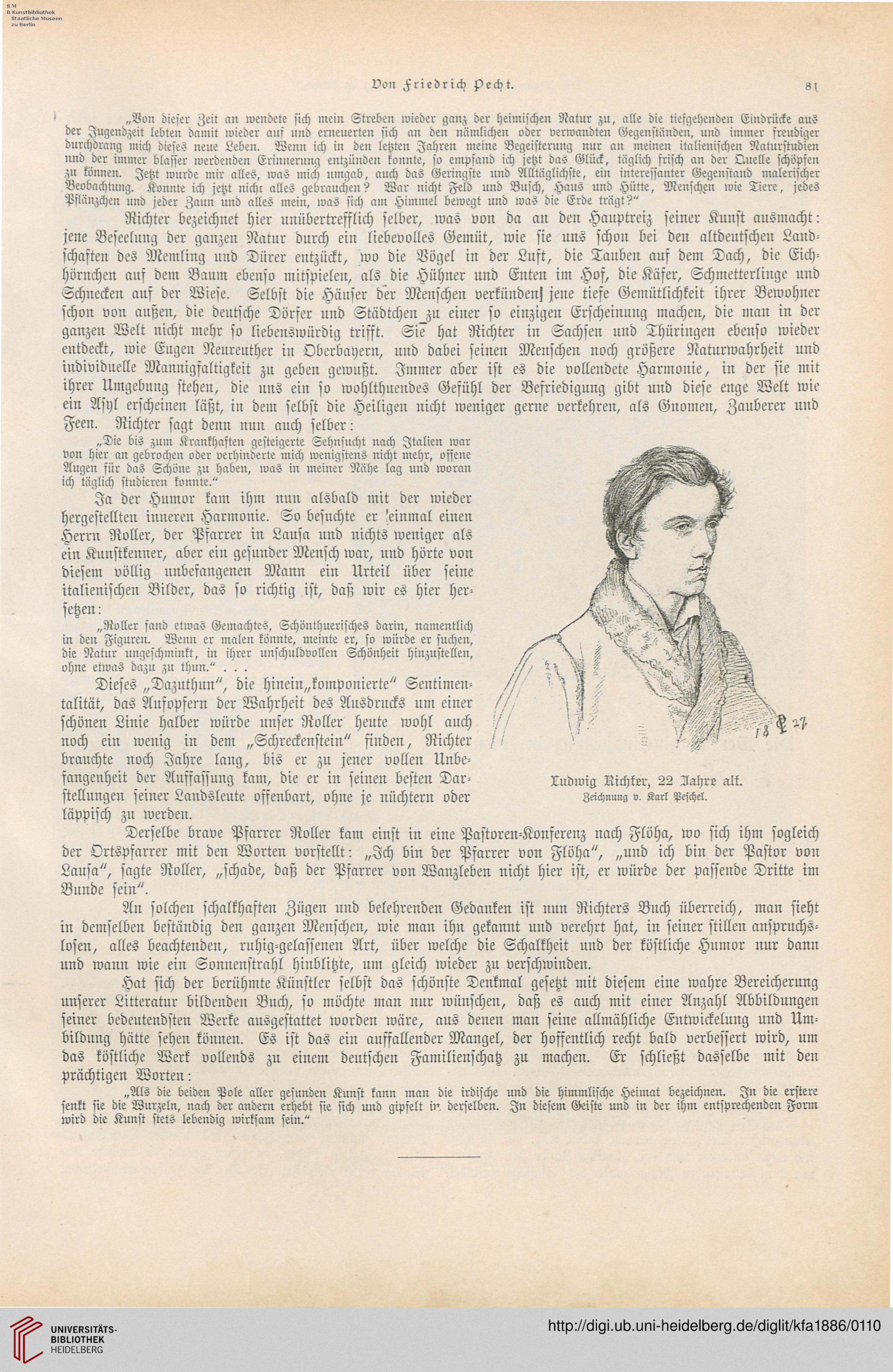Von Friedrich jdecht.
„Vvn dieser Zeit an wendete sich mein Streben wieder ganz der heimischen Natur zu, alle die tiefgehenden Eindrücke aus
der Jugendzeit lebten damit wieder auf und erneuerten sich an den nämlichen oder verwandten Gegenständen, und immer freudiger
durchdrang mich dieses neue Leben. Wenn ich in den letzten Jahren meine Begeisterung nur an meinen italienischen Naturstudien
nnd der immer blasser werdenden Erinnerung entziinden lonnte, so enipfand ich jetzt das Glück, täglich frisch an der Quelle schöpfen
zu können. Jetzt wurde mir alles, was nüch nmgab, auch das Geringste und Alltäglichste, ein interessanter Gegenstand malerischer
Beobachtung. Konnte ich jetzt nichr alles gebrauchen? War nicht Feld und Busch, Haus und Hütte, Menschen wie Tiere, jedes
Pflänzchen und jeder Zaun und alles mein, was sich am Himmel bewegt und was die Erde trägt?"
Richter bezeichnet hier umibertrefflich selber, was von da an den Hauptreiz seiner Knnst ausmacht:
jene Beseelnng der ganzen Natnr durch ein liebevolles Gemüt, wie sie uns schon bei den altdeutschen Land-
schaften des Memling und Dürer entzückt, wo die Vögel in der Luft, die Tanben auf dem Dach, die Eich-
hörnchen aus dem Baum ebenso mitspielen, als die Hühner und Enten im Hof, die Käfer, Schmetterlinge und
Schnecken aus der Wiese. Selbst die Häuser der Menschen verkündenj jene tiefe Gemütlichkeit ihrer Bewohner
schon von außen, die deutsche Dörfer und Städtchen zu einer so einzigen Erscheinnng machen, die man in der
ganzen Welt nicht mehr so liebenswürdig trifft. Sie hat Richter in Sachsen und Thüringen ebenso wieder
entdeckt, wie Engen Nenreuther in Oberbayern, und dabei seinen Menschen noch größere Naturwahrheit und
individuelle Mannigfaltigkeit zu geben gewußt. Jmmer aber ist es die vollendete Harmonie, in der sie mit
ihrer Umgebung stehen, die uns ein so wohlthuendes Gefühl der Besriedigung gibt und diese enge Welt wie
ein Asyl erscheinen läßt, in dem selbst die Heiligen nicht weniger gerne verkehren, als Gnomen, Zauberer und
Feen. Richter sagt denn nun auch selber:
„Die bis zum Krankhasten gesteigerte Sehnsucht nach Jtalien war
von hier an gebrochen oder verhinderte mich wenigstens nicht mehr, ofsene
Augen für das Schöne zu haben, was in meiner Nähe lag und woran
ich täglich studieren konnte."
Ja der Humor kam ihm nun alsbald mit der wieder
hergestellten inneren Harmonie. So besuchte er 'einmal einen
Herrn Roller, der Psarrer in Lausa und nichts weniger als
ein Kunstkenner, aber ein gesunder Mensch war, und hörte von
diesem völlig nnbefangenen Mann ein Urteil über seine
italienischen Bilder, das so richtig ist, daß wir es hier her-
setzen:
„Rollor fand etwas Gemachtes, Schönthuerisches darin, namentlich
in den Figuren. Wenn er malen könnte, meinte er, so würde er suchen,
die Natur ungeschminkt, in ihrer unschuldvollen Schönheit hinzustellen,
ohne etwas dazu zu thun." . . .
Dieses „Dazuthun", die hinein„komponierte" Sentimen-
talität, das Aufopfern der Wahrheit des Ausdrucks um einer
schönen Linie halber würde unser Roller heute wohl auch
noch ein wenig in dem „Schreckenstein" finden, Richter
brauchte noch Jahre lang, bis er zu jener vollen Unbe-
fangenheit der Auffassung kam, die er in seinen besten Dar-
stellungen seiner Landsleute offenbart, ohne je uüchtern oder
läppisch zu werden.
Derselbe brave Pfarrer Roller kam einst in eine Pastoren-Konferenz nach Flöha, wo sich ihm sogleich
der Ortspfarrer mit den Worten vorstellt: „Jch bin der Pfarrer von Flöha", „und ich bin der Pastor von
Lausa", sagte Roller, „schade, daß der Pfarrer von Wanzleben nicht hier ist, er würde der passende Dritte im
Bunde sein".
An solchen schalkhaften Zügen und belehrenden Gedanken ist nun Richters Buch überreich, man sieht
in demselben beständig den ganzen Menschen, wie man ihn gekannt und verehrt hat, in seiner stillen anspruchs-
losen, alles beachtenden, rnhig-gelassenen Art, über welche die Schalkheit und der köstliche Hnmor nur dann
und wann wie ein Sonnenstrahl hinblitzte, um gleich wieder zu verschwinden.
Hat sich der berühmte Künstler selbst das schönste Denkmal gesetzt mit diesem eine wahre Bereicherung
unserer Litteratur bildenden Buch, so möchte man nur wünschen, daß es auch mit einer Anzahl Abbildungen
seiner bedeutendsten Werke ausgestattet worden wäre, aus denen man seine allmühliche Entwickelung und Um-
bildung hätte sehen können. Es ist das ein auffallender Mangel, der hoffentlich recht bald verbessert wird, um
das köstliche Werk vollends zu einem deutschen Familieuschatz zu machen. Er schließt dasselbe mit den
prächtigen Worten:
„Als die beideri Pole aller gesunden Kunst kann man die irdische und die himmlische Heimat bezeichnen. Jn die erstere
senkt sie die Wurzeln, nach der andern erhebt sie sich und gipfelt in derselben. Jn diesem Geiste und in der ihm entsprechenden Form
wird die Kunst stets lebendig wirksam sein."
Liidwig Richkrr, 22 Iahrr alk.
Zeichnung v. Karl Peschel.
„Vvn dieser Zeit an wendete sich mein Streben wieder ganz der heimischen Natur zu, alle die tiefgehenden Eindrücke aus
der Jugendzeit lebten damit wieder auf und erneuerten sich an den nämlichen oder verwandten Gegenständen, und immer freudiger
durchdrang mich dieses neue Leben. Wenn ich in den letzten Jahren meine Begeisterung nur an meinen italienischen Naturstudien
nnd der immer blasser werdenden Erinnerung entziinden lonnte, so enipfand ich jetzt das Glück, täglich frisch an der Quelle schöpfen
zu können. Jetzt wurde mir alles, was nüch nmgab, auch das Geringste und Alltäglichste, ein interessanter Gegenstand malerischer
Beobachtung. Konnte ich jetzt nichr alles gebrauchen? War nicht Feld und Busch, Haus und Hütte, Menschen wie Tiere, jedes
Pflänzchen und jeder Zaun und alles mein, was sich am Himmel bewegt und was die Erde trägt?"
Richter bezeichnet hier umibertrefflich selber, was von da an den Hauptreiz seiner Knnst ausmacht:
jene Beseelnng der ganzen Natnr durch ein liebevolles Gemüt, wie sie uns schon bei den altdeutschen Land-
schaften des Memling und Dürer entzückt, wo die Vögel in der Luft, die Tanben auf dem Dach, die Eich-
hörnchen aus dem Baum ebenso mitspielen, als die Hühner und Enten im Hof, die Käfer, Schmetterlinge und
Schnecken aus der Wiese. Selbst die Häuser der Menschen verkündenj jene tiefe Gemütlichkeit ihrer Bewohner
schon von außen, die deutsche Dörfer und Städtchen zu einer so einzigen Erscheinnng machen, die man in der
ganzen Welt nicht mehr so liebenswürdig trifft. Sie hat Richter in Sachsen und Thüringen ebenso wieder
entdeckt, wie Engen Nenreuther in Oberbayern, und dabei seinen Menschen noch größere Naturwahrheit und
individuelle Mannigfaltigkeit zu geben gewußt. Jmmer aber ist es die vollendete Harmonie, in der sie mit
ihrer Umgebung stehen, die uns ein so wohlthuendes Gefühl der Besriedigung gibt und diese enge Welt wie
ein Asyl erscheinen läßt, in dem selbst die Heiligen nicht weniger gerne verkehren, als Gnomen, Zauberer und
Feen. Richter sagt denn nun auch selber:
„Die bis zum Krankhasten gesteigerte Sehnsucht nach Jtalien war
von hier an gebrochen oder verhinderte mich wenigstens nicht mehr, ofsene
Augen für das Schöne zu haben, was in meiner Nähe lag und woran
ich täglich studieren konnte."
Ja der Humor kam ihm nun alsbald mit der wieder
hergestellten inneren Harmonie. So besuchte er 'einmal einen
Herrn Roller, der Psarrer in Lausa und nichts weniger als
ein Kunstkenner, aber ein gesunder Mensch war, und hörte von
diesem völlig nnbefangenen Mann ein Urteil über seine
italienischen Bilder, das so richtig ist, daß wir es hier her-
setzen:
„Rollor fand etwas Gemachtes, Schönthuerisches darin, namentlich
in den Figuren. Wenn er malen könnte, meinte er, so würde er suchen,
die Natur ungeschminkt, in ihrer unschuldvollen Schönheit hinzustellen,
ohne etwas dazu zu thun." . . .
Dieses „Dazuthun", die hinein„komponierte" Sentimen-
talität, das Aufopfern der Wahrheit des Ausdrucks um einer
schönen Linie halber würde unser Roller heute wohl auch
noch ein wenig in dem „Schreckenstein" finden, Richter
brauchte noch Jahre lang, bis er zu jener vollen Unbe-
fangenheit der Auffassung kam, die er in seinen besten Dar-
stellungen seiner Landsleute offenbart, ohne je uüchtern oder
läppisch zu werden.
Derselbe brave Pfarrer Roller kam einst in eine Pastoren-Konferenz nach Flöha, wo sich ihm sogleich
der Ortspfarrer mit den Worten vorstellt: „Jch bin der Pfarrer von Flöha", „und ich bin der Pastor von
Lausa", sagte Roller, „schade, daß der Pfarrer von Wanzleben nicht hier ist, er würde der passende Dritte im
Bunde sein".
An solchen schalkhaften Zügen und belehrenden Gedanken ist nun Richters Buch überreich, man sieht
in demselben beständig den ganzen Menschen, wie man ihn gekannt und verehrt hat, in seiner stillen anspruchs-
losen, alles beachtenden, rnhig-gelassenen Art, über welche die Schalkheit und der köstliche Hnmor nur dann
und wann wie ein Sonnenstrahl hinblitzte, um gleich wieder zu verschwinden.
Hat sich der berühmte Künstler selbst das schönste Denkmal gesetzt mit diesem eine wahre Bereicherung
unserer Litteratur bildenden Buch, so möchte man nur wünschen, daß es auch mit einer Anzahl Abbildungen
seiner bedeutendsten Werke ausgestattet worden wäre, aus denen man seine allmühliche Entwickelung und Um-
bildung hätte sehen können. Es ist das ein auffallender Mangel, der hoffentlich recht bald verbessert wird, um
das köstliche Werk vollends zu einem deutschen Familieuschatz zu machen. Er schließt dasselbe mit den
prächtigen Worten:
„Als die beideri Pole aller gesunden Kunst kann man die irdische und die himmlische Heimat bezeichnen. Jn die erstere
senkt sie die Wurzeln, nach der andern erhebt sie sich und gipfelt in derselben. Jn diesem Geiste und in der ihm entsprechenden Form
wird die Kunst stets lebendig wirksam sein."
Liidwig Richkrr, 22 Iahrr alk.
Zeichnung v. Karl Peschel.