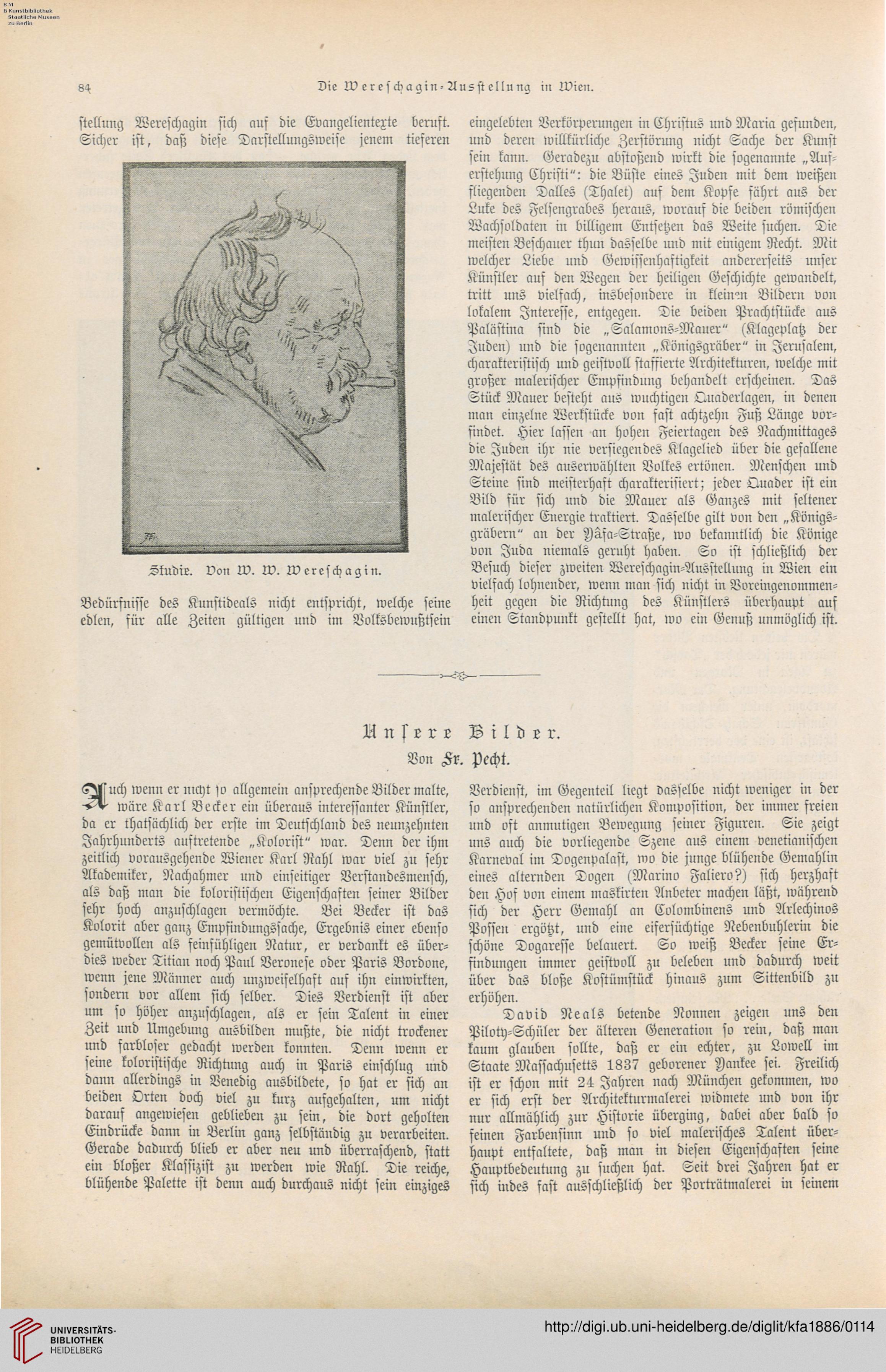8-4
Die W e r e s ck a gin - Aus st ellu ng in A)ien.
stellung Wereschagin sich aus die Evangelientexte beruft.
Sicher ist, daß diese Darstellungsweise jenem tieferen
Bedürstiisse des Kunstideals nicht entspricht, welche seine
edlen, für alle Zeiten gültigen und im Volksbewußtsein
eingelebten Berkörperungen in Christus und Bkaria gefunden,
und deren willkürliche Zerstörung nicht Sache der Kunst
sein kann. Geradezu abstoßend wirkt die sogenannte „Auf-
erstehung Christi": die Büste eines Juden mit dem weißen
fliegenden Dalles (Thalet) auf dem Kopfe fährt aus der
Luke des Felsengrabes heraus, worauf die beiden römischen
Wachsoldaten in billigem Entsetzen das Weite suchen. Die
meisten Beschauer thun dasselbe und mit einigem Recht. Mit
welcher Liebe und Gewissenhaftigkeit andererseits unser
Künstler auf den Wegen der heiligen Geschichte gewandelt,
tritt uns vielfach, insbesondere in kleinen Bildern von
lokalem Jnteresse, entgegen. Die beiden Prachtstücke aus
Palästina sind die „Salamons-Mauer" (Klageplatz der
Juden) und die sogenannten „Königsgräber" in Jerusalem,
charakteristisch und geistvoll stafsierte Architekturen, welche mit
großer malerischer Empfindung behandelt erscheinen. Das
Stück Mauer besteht aus wuchtigen Quaderlagen, in denen
man einzelne Werkstücke von fast achtzehn Fuß Länge vor-
stndet. Hier lassen an hohen Feiertagen des Nachmittages
die Juden ihr nie versiegendes Klagelied über die gefallene
Majestät des auserwählten Volkes ertönen. Akenschen und
Steine sind meisterhaft charakterisiert; jeder Quader ist ein
Bild sür sich nnd die Mauer als Ganzes mit seltener
malerischer Energie traktiert. Tasselbe gilt von den „Königs-
gräbern" an der Nstfa-Straße, wo bekanntlich die Könige
von Juda niemals geruht haben. So ist schließlich der
Besuch dieser zweiten Wereschagin-Ausstellung in Wien ein
vielfach lohnender, wenn man sich nicht in Voreingenommen-
heit gegen die Richtung des Künstlers überhaupt auf
einen Standpunkt gestellt hat, wo ein Genuß unmöglich ist.
Nnsrrr Vildrr.
Von Lr. pecht.
6Much wenu er nnyt ;o allgemein ansprechende Bilder malte,
wäre Karl Becker ein überaus interessanter Künstler,
da er thatsächlich der erste im Deutschland des neunzehnten
Jahrhunderts austretende „Kolorist" war. Denn der ihm
zeitlich vorausgehende Wiener Karl Rahl war viel zu sehr
Akademiker, Nachahmer und einseitiger Verstandesmensch,
als daß man die koloristischen Eigenschaften seiner Bilder
sehr hoch anzuschlagen vermöchte. Bei Becker ist das
Kolorit aber ganz Empfindungssache, Ergebnis einer ebenso
gemütvollen als feinfühligen Natur, er verdankt es über-
dies weder Titian noch Paul Veronese oder Paris Bordone,
wenn jene Männer auch unzweifelhaft auf ihn einwirkten,
sondern vor allem sich selber. Dies Verdienst ist aber
um so höher anzuschlagen, als er sein Talent in einer
Zeit und llmgebung ausbilden mußte, die nicht trockener
und farbloser gedacht werden konnten. Denn wenn er
seine koloristische Richtung auch in Paris einschlug und
dann allerdings in Venedig ausbildete, so hat er sich an
beiden Orten doch viel zu kurz aufgehalten, um nicht
darauf angewiesen geblieben zu sein, die dort geholten
Eindrücke dann in Berlin ganz selbständig zu verarbeiten.
Gerade dadurch blieb er aber neu und überraschend, statt
ein bloßer Klassizist zu werden wie Rahl. Die reiche,
blühende Palette ist denn auch durchaus nicht sein einziges
Verdienst, im Gegenteil liegt dasselbe nicht weniger in der
so ansprechenden natürlichen Komposition, der imnier freien
und oft anmutigen Bewegung seiner Figuren. Sie zeigt
uns auch die vorliegende Szene aus einem venetianischen
Karneval im Dogenpalast, wo die jniige blühende Gemahlin
eines alternden Dogen (Marino Faliero?) sich herzhaft
den Hof von eineni maskirten Anbeter machen läßt, während
sich der Herr Gemahl an Colombinens und Arlechinos
Possen ergötzt, und eine eifersüchtige Nebenbuhlerin die
schöne Dogaresse belauert. So weiß Becker seine Er-
findungen immer geistvoll zu beleben und dadurch weit
über das bloße Kostümstück hinaus zum Sittenbild zu
erhöhen.
David Neals betende Nonnen zeigen uns den
Piloty-Schiiler der älteren Generation so rein, daß man
kaum glauben sollte, daß er ein echter, zu Lowell im
Staate Massachusetts 1837 geborener Yankee sei. Freilich
ist er schon mit 24 Jahren nach München gekommen, wo
er sich erst der Architekturmalerei widmete und von ihr
nur allmählich zur Historie überging, dabei aber bald so
feinen Farbensinn und so viel malerisches Talent über-
haupt entfaltete, daß man in diesen Eigenschaften seine
Hauptbedeutung zu suchen hat. Seit drei Jahren hat er
sich indes fast ausschließlich der Porträtmalerei in seinem
Die W e r e s ck a gin - Aus st ellu ng in A)ien.
stellung Wereschagin sich aus die Evangelientexte beruft.
Sicher ist, daß diese Darstellungsweise jenem tieferen
Bedürstiisse des Kunstideals nicht entspricht, welche seine
edlen, für alle Zeiten gültigen und im Volksbewußtsein
eingelebten Berkörperungen in Christus und Bkaria gefunden,
und deren willkürliche Zerstörung nicht Sache der Kunst
sein kann. Geradezu abstoßend wirkt die sogenannte „Auf-
erstehung Christi": die Büste eines Juden mit dem weißen
fliegenden Dalles (Thalet) auf dem Kopfe fährt aus der
Luke des Felsengrabes heraus, worauf die beiden römischen
Wachsoldaten in billigem Entsetzen das Weite suchen. Die
meisten Beschauer thun dasselbe und mit einigem Recht. Mit
welcher Liebe und Gewissenhaftigkeit andererseits unser
Künstler auf den Wegen der heiligen Geschichte gewandelt,
tritt uns vielfach, insbesondere in kleinen Bildern von
lokalem Jnteresse, entgegen. Die beiden Prachtstücke aus
Palästina sind die „Salamons-Mauer" (Klageplatz der
Juden) und die sogenannten „Königsgräber" in Jerusalem,
charakteristisch und geistvoll stafsierte Architekturen, welche mit
großer malerischer Empfindung behandelt erscheinen. Das
Stück Mauer besteht aus wuchtigen Quaderlagen, in denen
man einzelne Werkstücke von fast achtzehn Fuß Länge vor-
stndet. Hier lassen an hohen Feiertagen des Nachmittages
die Juden ihr nie versiegendes Klagelied über die gefallene
Majestät des auserwählten Volkes ertönen. Akenschen und
Steine sind meisterhaft charakterisiert; jeder Quader ist ein
Bild sür sich nnd die Mauer als Ganzes mit seltener
malerischer Energie traktiert. Tasselbe gilt von den „Königs-
gräbern" an der Nstfa-Straße, wo bekanntlich die Könige
von Juda niemals geruht haben. So ist schließlich der
Besuch dieser zweiten Wereschagin-Ausstellung in Wien ein
vielfach lohnender, wenn man sich nicht in Voreingenommen-
heit gegen die Richtung des Künstlers überhaupt auf
einen Standpunkt gestellt hat, wo ein Genuß unmöglich ist.
Nnsrrr Vildrr.
Von Lr. pecht.
6Much wenu er nnyt ;o allgemein ansprechende Bilder malte,
wäre Karl Becker ein überaus interessanter Künstler,
da er thatsächlich der erste im Deutschland des neunzehnten
Jahrhunderts austretende „Kolorist" war. Denn der ihm
zeitlich vorausgehende Wiener Karl Rahl war viel zu sehr
Akademiker, Nachahmer und einseitiger Verstandesmensch,
als daß man die koloristischen Eigenschaften seiner Bilder
sehr hoch anzuschlagen vermöchte. Bei Becker ist das
Kolorit aber ganz Empfindungssache, Ergebnis einer ebenso
gemütvollen als feinfühligen Natur, er verdankt es über-
dies weder Titian noch Paul Veronese oder Paris Bordone,
wenn jene Männer auch unzweifelhaft auf ihn einwirkten,
sondern vor allem sich selber. Dies Verdienst ist aber
um so höher anzuschlagen, als er sein Talent in einer
Zeit und llmgebung ausbilden mußte, die nicht trockener
und farbloser gedacht werden konnten. Denn wenn er
seine koloristische Richtung auch in Paris einschlug und
dann allerdings in Venedig ausbildete, so hat er sich an
beiden Orten doch viel zu kurz aufgehalten, um nicht
darauf angewiesen geblieben zu sein, die dort geholten
Eindrücke dann in Berlin ganz selbständig zu verarbeiten.
Gerade dadurch blieb er aber neu und überraschend, statt
ein bloßer Klassizist zu werden wie Rahl. Die reiche,
blühende Palette ist denn auch durchaus nicht sein einziges
Verdienst, im Gegenteil liegt dasselbe nicht weniger in der
so ansprechenden natürlichen Komposition, der imnier freien
und oft anmutigen Bewegung seiner Figuren. Sie zeigt
uns auch die vorliegende Szene aus einem venetianischen
Karneval im Dogenpalast, wo die jniige blühende Gemahlin
eines alternden Dogen (Marino Faliero?) sich herzhaft
den Hof von eineni maskirten Anbeter machen läßt, während
sich der Herr Gemahl an Colombinens und Arlechinos
Possen ergötzt, und eine eifersüchtige Nebenbuhlerin die
schöne Dogaresse belauert. So weiß Becker seine Er-
findungen immer geistvoll zu beleben und dadurch weit
über das bloße Kostümstück hinaus zum Sittenbild zu
erhöhen.
David Neals betende Nonnen zeigen uns den
Piloty-Schiiler der älteren Generation so rein, daß man
kaum glauben sollte, daß er ein echter, zu Lowell im
Staate Massachusetts 1837 geborener Yankee sei. Freilich
ist er schon mit 24 Jahren nach München gekommen, wo
er sich erst der Architekturmalerei widmete und von ihr
nur allmählich zur Historie überging, dabei aber bald so
feinen Farbensinn und so viel malerisches Talent über-
haupt entfaltete, daß man in diesen Eigenschaften seine
Hauptbedeutung zu suchen hat. Seit drei Jahren hat er
sich indes fast ausschließlich der Porträtmalerei in seinem