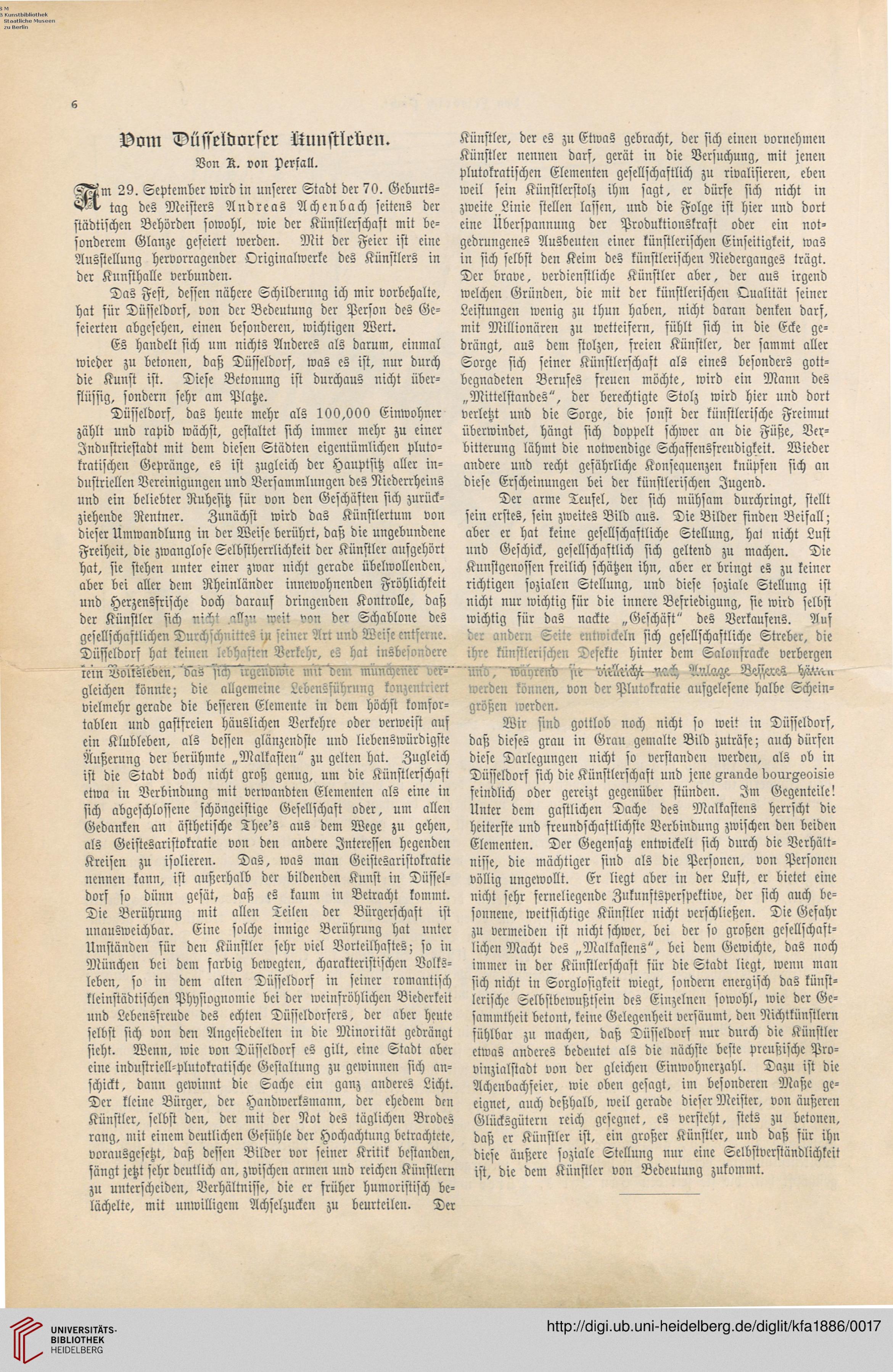Vom Düsseldorfer Üunstlcden.
Von L. von perfall.
29. September wird in unserer Stadt der 70. Geburls-
tag des Meisters Andreas Achenbach seitens der
städtischen Behörden sowohl, wie der Künstlerschast mit be-
sonderem Glanze gefeiert werden. Mit der Feier ist eine
Ausstellung hervorragender Originalwerke des Künstlers in
der Kunsthalle verbunden.
Das Fest, dessen nähcre Schilderung ich mir vorbehalte,
hat sür Düsseldorf, von der Bedeutung der Person des Ge-
seierten abgesehen, einen besonderen, wichtigen Wert.
Es handelt sich um nichts Anderes als darum, einmal
wieder zu betonen, daß Düfseldorf, was es ist, nur durch
die Kunst ist. Diese Betonung ist durchaus nicht über-
flüssig, sondcrn sehr am Platze.
Düsseldorf, das heute mehr als 100,000 Einwohuer
zählt und rapid wächst, gestaltet stch immer mehr zu einer
Jndustriestadt mit dem diesen Städten eigentümlichen pluto-
kratischen Gepränge, es ist zuglcich dcr Hauptsitz aller in-
dustricllen Vereinigungcn und Versammlungen des Nicderrheins
und ein beliebter Ruhesitz für von den Geschästen sich zurück-
ziehende Rentner. Zunächst wird das Künstlertum von
dieser Umwandlung in der Weise berührt, daß die ungebundene
Freiheit, die zwanglose Selbstherrlichkeit der Künstler ausgehört
hat, sie stehen unter einer zwar nicht gerade übelwollendeu,
aber bei aller dcm Rheinländer inncwohnenden Fröhlichkeit
und Herzensfrische doch darauf dringenden Kontrolle, daß
der Künstler sich n'chl "ll'" w'it "on der Schablone des
gesellschaftlichen Durchsanüttcs u, uincr Arr und Wcise cnts..ne.
Düfleldorf hat keinen lebhaften Verkehr, es hat insbesondere
rern Polksieven, 'öas' 'stcy lrgen'vwre nnt 'vem münchenei
gleichen könnte; die allgemeine Lebensführung konzcniriert
viclmehr gerade die besseren Elemente in dem höchst komfor-
tablen und gastsreicn häuslichen Verkehre oder verweist aus
ein Klubleben, als deflen glänzendste und liebenswürdigste
Änßerung der berühmte „Malkasten" zu gelten hat. Zugleich
ist die Stadt doch nicht groß gcnug, um die Künstlerschaft
ctwa in Verbindung mit vcrwandten Elementen als eine in
stch abgeschlosscne schöngeistige Gesellschaft oder, um allen
Gedanken an ästhetische Thee's aus dem Wege zu gehen,
als Geistesaristokratie von den andere Jntereflen hegcnden
Kreiscn zu isolieren. Das, was man Geistcsaristokratie
nennen kann, ist außerhalb dcr bildenden Kunst in Düssel-
dorf so dünn gesät, daß cs kaum in Betracht kommt.
Die Berührung mit allen Teilcn der Biirgerschast ist
unausweichbar. Einc solche innigc Berührung hat untcr
Umständen sür den Künstlcr sehr viel Vorteilhastes; so in
Münchcn bei dem sarbig bcwcgten, charakteristischen Volks-
leben, so in dem altcn Düsseldorf in seiner romantisch
klcinstädtischen Physiognomie bci dcr weinfröhlichen Biederkeit
und Lebcnssreude des cchten Düsscldorfers, der aber heutc
selbst sich von den Angesiedelten in die Minorität gedrängt
sieht. Wenn, wie von Düsseldorf es gilt, eine Stadt aber
cine industriell-plutokratische Gestaltung zu gewinnen stch an-
schickt, dann gewinnt die Sache ein ganz anderes Licht.
Dcr ktcinc Bürger, der Handwcrksmann, der ehedem dcn
Künstler, selbst den, der mit der Not des täglichen Brodes
rang, mit einem deutlichen Gefühle dcr Hochachtung betrachtctc,
vorausgcsetzt, daß dessen Bildcr vor seiner Kritik bestandcn,
fängt jetzt sehr deutlich an, zwischen armen und reichen Künstlern
zu unterscheiden, Verhältnisse, die er früher humoristisch be-
lächelte, mit unwilligem Achselzucken zu beurteilen. Der
Künstler, der es zu Etwas gebracht, der sich einen vornehmen
Künstler nennen darf, gerät in die Versuchung, mit jenen
plutokratischen Elementen gesellschaftlich zu rivalisieren, eben
weil sein Künstlerstolz ihm sagt, er dürfe sich nicht in
zweite Linie stellen lassen, und die Folge ist hier und dort
eine Uberspannung der Produktionskraft oder ein not-
gedrungenes Ausbeuten einer künstlerischen Einseitigkeit, was
in sich selbst den Keim des künstlerischen Niederganges trägt.
Der brave, verdienstliche Künstler aber, der aus irgend
welchen Gründen, die mit der künstlerischen Qualität seiner
Leistungen wenig zu thun haben, nicht daran denken darf,
mit Millionären zu wetteifern, fühlt sich in die Ecke ge-
drängt, aus dem stolzen, freien Künstler, der sammt aller
Sorge sich seiner Künstlerschast als eines besonders gott-
bcgnadeten Berufes freuen möchte, wird ein Mann des
„Mittelstandes", der berechtigte Stolz wird hier und dort
verletzt und die Sorge, die sonst der künstlerische Freimut
überwindet, hängt sich doppelt schwer an die Füße, Ver-
bitterung lähmt die notwendige Schaffensfreudigkeit. Wieder
andere und recht gefährliche Konsequenzen knüpfen sich an
diese Erscheinungen bei der künstlerischen Jugend.
Der arme Teusel, der sich mühsam durchringt, stellt
sein erstes, sein zweites Bild aus. Die Bilder finden Beifall;
aber er hat keine gesellschastliche Stellung, hal nicht Lust
und Geschick, gesellschastlich sich geltend zu machen. Die
Kunstgenossen sreilich schätzen ihn, aber er bringt es zu keincr
richtigen sozialen Stellung, und diese soziale Stellung ist
nicht nur wichtig sür die innere Befriedigung, sie wird selbst
wichtig sür das nackte „Geschäft" des Verkaufens. Auf
i ande... S:iie entwickeln sich gesellschaftliche Streber, die
ihre künstlerischen Defekte hinter dem Salonfracke verbergen
"Ünü, 'Mmreno pc ÄÄrM AÄazr Besieres W».,»
.dcn lönnen, von der Plutokratte aufgelesene halbe Schein-
größen werden.
Wir sind goitlob noch nicht so weit in Düsseldorf,
daß dieses grau in Grau gemalte Bild zuträse; auch dürfen
diese Darlegungen nicht so verstanden werden, als ob in
Düsseldorf sich die Künstlerschaft und jene Zrsncks bonrZsoisis
feindlich oder gereizt gegenüber stünden. Jm Gegenteile!
Unter dem gastlichen Dache des Malkastens herrscht die
heiterste und freundschaftlichste Verbindung zwischen den beiden
Elemenien. Der Gegensatz entwickelt sich durch die Verhält-
nisse, die mächtiger sind als die Personen, von Personcn
völlig ungewollt. Er liegt aber in der Luft, er bietet eine
nicht sehr serneliegende Zukunftsperspektive, der sich auch bc-
sonnene, weitsichtige Künstler nicht verschließen. Die Gefahr
zu vermeiden ist nicht schwer, bei der so großen gesellschaft-
lichcn Macht des „Malkastens", bei dem Gewichte, das noch
immer in der Künstlerschaft für die Stadt liegt, wenn man
sich nicht in Sorglosigkeit wiegt, sondern energisch das künst-
lerische Selbstbewußtscin des Einzelncn sowohl, wie der Ge-
sammtheit betont, keine Gelegenheit versäumt, den Nichtkünstlern
fühlbar zu machen, daß Düsseldorf nur durch die Künstler
etwas anderes bedeutet als die nächste beste preußische Pro-
vinzialstadt von dcr gleichen Einwohnerzahl. Dazu ist die
Achenbachfeier, wie oben gesagt. im besonderen Maße ge-
cignet, auch deßhalb, weil gerade dieser Meister, von äußcren
Glücksgütern reich gcscgnet, es vcrsteht, stets zu betonen,
daß cr Künstlcr ist, ein großcr Künstler, und daß für ihn
dicse äußere soziale Stellung nur eine Selbstverständlichkeit
ist, die dem Künstler von Bedeulung zukommt.
Von L. von perfall.
29. September wird in unserer Stadt der 70. Geburls-
tag des Meisters Andreas Achenbach seitens der
städtischen Behörden sowohl, wie der Künstlerschast mit be-
sonderem Glanze gefeiert werden. Mit der Feier ist eine
Ausstellung hervorragender Originalwerke des Künstlers in
der Kunsthalle verbunden.
Das Fest, dessen nähcre Schilderung ich mir vorbehalte,
hat sür Düsseldorf, von der Bedeutung der Person des Ge-
seierten abgesehen, einen besonderen, wichtigen Wert.
Es handelt sich um nichts Anderes als darum, einmal
wieder zu betonen, daß Düfseldorf, was es ist, nur durch
die Kunst ist. Diese Betonung ist durchaus nicht über-
flüssig, sondcrn sehr am Platze.
Düsseldorf, das heute mehr als 100,000 Einwohuer
zählt und rapid wächst, gestaltet stch immer mehr zu einer
Jndustriestadt mit dem diesen Städten eigentümlichen pluto-
kratischen Gepränge, es ist zuglcich dcr Hauptsitz aller in-
dustricllen Vereinigungcn und Versammlungen des Nicderrheins
und ein beliebter Ruhesitz für von den Geschästen sich zurück-
ziehende Rentner. Zunächst wird das Künstlertum von
dieser Umwandlung in der Weise berührt, daß die ungebundene
Freiheit, die zwanglose Selbstherrlichkeit der Künstler ausgehört
hat, sie stehen unter einer zwar nicht gerade übelwollendeu,
aber bei aller dcm Rheinländer inncwohnenden Fröhlichkeit
und Herzensfrische doch darauf dringenden Kontrolle, daß
der Künstler sich n'chl "ll'" w'it "on der Schablone des
gesellschaftlichen Durchsanüttcs u, uincr Arr und Wcise cnts..ne.
Düfleldorf hat keinen lebhaften Verkehr, es hat insbesondere
rern Polksieven, 'öas' 'stcy lrgen'vwre nnt 'vem münchenei
gleichen könnte; die allgemeine Lebensführung konzcniriert
viclmehr gerade die besseren Elemente in dem höchst komfor-
tablen und gastsreicn häuslichen Verkehre oder verweist aus
ein Klubleben, als deflen glänzendste und liebenswürdigste
Änßerung der berühmte „Malkasten" zu gelten hat. Zugleich
ist die Stadt doch nicht groß gcnug, um die Künstlerschaft
ctwa in Verbindung mit vcrwandten Elementen als eine in
stch abgeschlosscne schöngeistige Gesellschaft oder, um allen
Gedanken an ästhetische Thee's aus dem Wege zu gehen,
als Geistesaristokratie von den andere Jntereflen hegcnden
Kreiscn zu isolieren. Das, was man Geistcsaristokratie
nennen kann, ist außerhalb dcr bildenden Kunst in Düssel-
dorf so dünn gesät, daß cs kaum in Betracht kommt.
Die Berührung mit allen Teilcn der Biirgerschast ist
unausweichbar. Einc solche innigc Berührung hat untcr
Umständen sür den Künstlcr sehr viel Vorteilhastes; so in
Münchcn bei dem sarbig bcwcgten, charakteristischen Volks-
leben, so in dem altcn Düsseldorf in seiner romantisch
klcinstädtischen Physiognomie bci dcr weinfröhlichen Biederkeit
und Lebcnssreude des cchten Düsscldorfers, der aber heutc
selbst sich von den Angesiedelten in die Minorität gedrängt
sieht. Wenn, wie von Düsseldorf es gilt, eine Stadt aber
cine industriell-plutokratische Gestaltung zu gewinnen stch an-
schickt, dann gewinnt die Sache ein ganz anderes Licht.
Dcr ktcinc Bürger, der Handwcrksmann, der ehedem dcn
Künstler, selbst den, der mit der Not des täglichen Brodes
rang, mit einem deutlichen Gefühle dcr Hochachtung betrachtctc,
vorausgcsetzt, daß dessen Bildcr vor seiner Kritik bestandcn,
fängt jetzt sehr deutlich an, zwischen armen und reichen Künstlern
zu unterscheiden, Verhältnisse, die er früher humoristisch be-
lächelte, mit unwilligem Achselzucken zu beurteilen. Der
Künstler, der es zu Etwas gebracht, der sich einen vornehmen
Künstler nennen darf, gerät in die Versuchung, mit jenen
plutokratischen Elementen gesellschaftlich zu rivalisieren, eben
weil sein Künstlerstolz ihm sagt, er dürfe sich nicht in
zweite Linie stellen lassen, und die Folge ist hier und dort
eine Uberspannung der Produktionskraft oder ein not-
gedrungenes Ausbeuten einer künstlerischen Einseitigkeit, was
in sich selbst den Keim des künstlerischen Niederganges trägt.
Der brave, verdienstliche Künstler aber, der aus irgend
welchen Gründen, die mit der künstlerischen Qualität seiner
Leistungen wenig zu thun haben, nicht daran denken darf,
mit Millionären zu wetteifern, fühlt sich in die Ecke ge-
drängt, aus dem stolzen, freien Künstler, der sammt aller
Sorge sich seiner Künstlerschast als eines besonders gott-
bcgnadeten Berufes freuen möchte, wird ein Mann des
„Mittelstandes", der berechtigte Stolz wird hier und dort
verletzt und die Sorge, die sonst der künstlerische Freimut
überwindet, hängt sich doppelt schwer an die Füße, Ver-
bitterung lähmt die notwendige Schaffensfreudigkeit. Wieder
andere und recht gefährliche Konsequenzen knüpfen sich an
diese Erscheinungen bei der künstlerischen Jugend.
Der arme Teusel, der sich mühsam durchringt, stellt
sein erstes, sein zweites Bild aus. Die Bilder finden Beifall;
aber er hat keine gesellschastliche Stellung, hal nicht Lust
und Geschick, gesellschastlich sich geltend zu machen. Die
Kunstgenossen sreilich schätzen ihn, aber er bringt es zu keincr
richtigen sozialen Stellung, und diese soziale Stellung ist
nicht nur wichtig sür die innere Befriedigung, sie wird selbst
wichtig sür das nackte „Geschäft" des Verkaufens. Auf
i ande... S:iie entwickeln sich gesellschaftliche Streber, die
ihre künstlerischen Defekte hinter dem Salonfracke verbergen
"Ünü, 'Mmreno pc ÄÄrM AÄazr Besieres W».,»
.dcn lönnen, von der Plutokratte aufgelesene halbe Schein-
größen werden.
Wir sind goitlob noch nicht so weit in Düsseldorf,
daß dieses grau in Grau gemalte Bild zuträse; auch dürfen
diese Darlegungen nicht so verstanden werden, als ob in
Düsseldorf sich die Künstlerschaft und jene Zrsncks bonrZsoisis
feindlich oder gereizt gegenüber stünden. Jm Gegenteile!
Unter dem gastlichen Dache des Malkastens herrscht die
heiterste und freundschaftlichste Verbindung zwischen den beiden
Elemenien. Der Gegensatz entwickelt sich durch die Verhält-
nisse, die mächtiger sind als die Personen, von Personcn
völlig ungewollt. Er liegt aber in der Luft, er bietet eine
nicht sehr serneliegende Zukunftsperspektive, der sich auch bc-
sonnene, weitsichtige Künstler nicht verschließen. Die Gefahr
zu vermeiden ist nicht schwer, bei der so großen gesellschaft-
lichcn Macht des „Malkastens", bei dem Gewichte, das noch
immer in der Künstlerschaft für die Stadt liegt, wenn man
sich nicht in Sorglosigkeit wiegt, sondern energisch das künst-
lerische Selbstbewußtscin des Einzelncn sowohl, wie der Ge-
sammtheit betont, keine Gelegenheit versäumt, den Nichtkünstlern
fühlbar zu machen, daß Düsseldorf nur durch die Künstler
etwas anderes bedeutet als die nächste beste preußische Pro-
vinzialstadt von dcr gleichen Einwohnerzahl. Dazu ist die
Achenbachfeier, wie oben gesagt. im besonderen Maße ge-
cignet, auch deßhalb, weil gerade dieser Meister, von äußcren
Glücksgütern reich gcscgnet, es vcrsteht, stets zu betonen,
daß cr Künstlcr ist, ein großcr Künstler, und daß für ihn
dicse äußere soziale Stellung nur eine Selbstverständlichkeit
ist, die dem Künstler von Bedeulung zukommt.