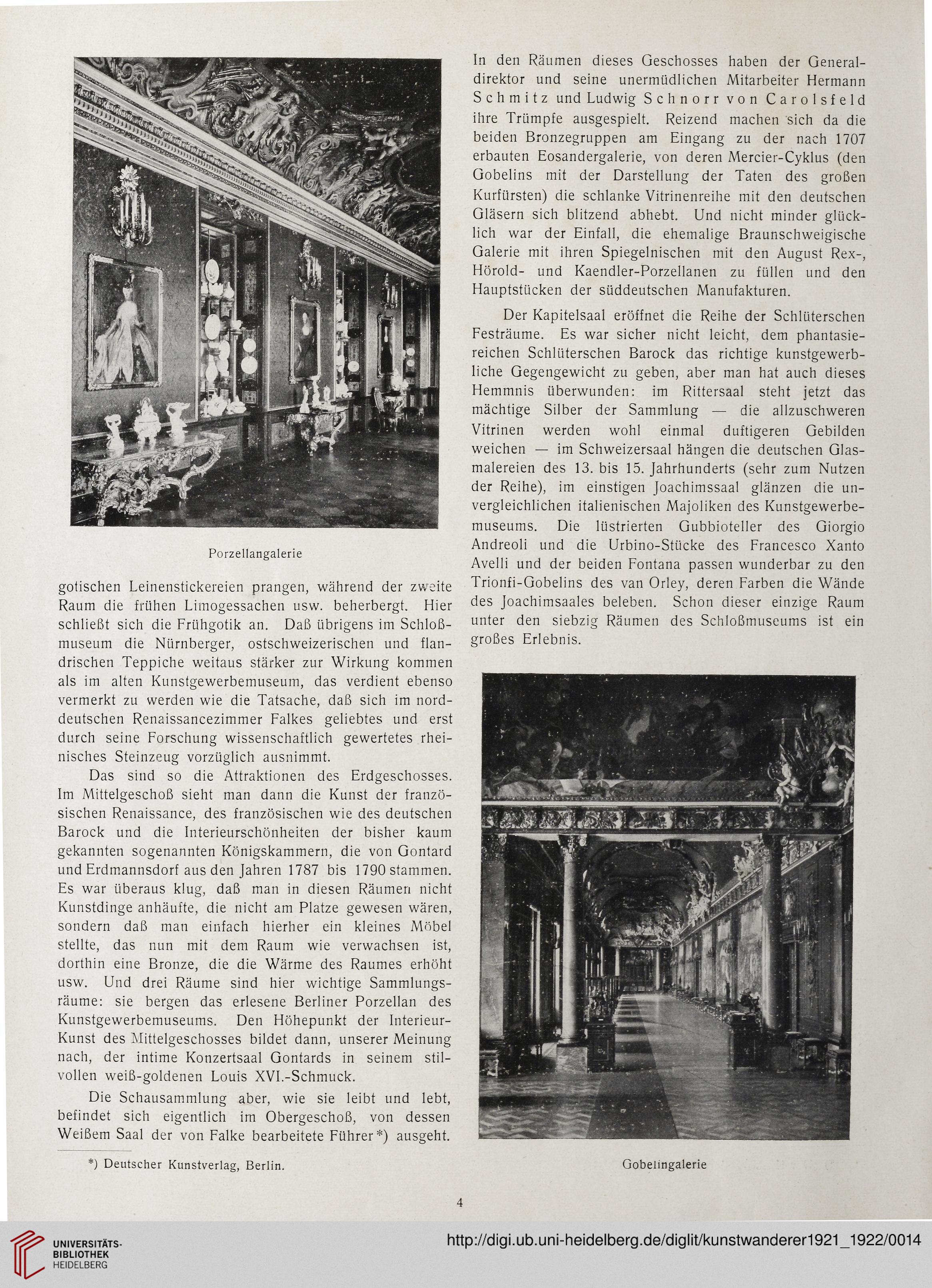Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 3./4.1921/22
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0014
DOI Heft:
1. Septemberheft
DOI Artikel:Donath, Adolph: Die Eröffnung des Berliner Schloßmuseum
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0014
Porzellangalerie
gotischen Leinenstickereien prangen, während der zweite
Raum die frühen Limogessachen usw. beherbergt. Hier
schließt sich die Frühgotik an. Daß übrigens im Schloß-
museum die Nürnberger, ostschweizerischen und flan-
drischen Teppiche weitaus stärker zur Wirkung kommen
als im alten Kunstgev/erbemuseum, das verdient ebenso
vermerkt zu werden wie die Tatsache, daß sich im nord-
deutschen Renaissancezimmer Falkes geliebtes und erst
durch seine Forschung wissenschaftlich gewertetes rhei-
nisches Steinzeug vorzüglich ausnimmt.
Das sind so die Attraktionen des Erdgeschosses.
Im Mittelgeschoß sieht man dann die Kunst der franzö-
sischen Renaissance, des französischen wie des deutschen
Barock und die Interieurschönheiten der bisher kaum
gekannten sogenannten Königskammern, die von Gontard
und Erdmannsdorf aus den Jahren 1787 bis 1790 stammen.
Es war überaus klug, daß man in diesen Räumen nicht
Kunstdinge anhäufte, die nicht am Platze gewesen wären,
sondern daß man einfach hierher ein kleines Möbel
stellte, das nun mit dem Raum wie verwachsen ist,
dorthin eine Bronze, die die Wärme des Raumes erhöht
usw. Und drei Räume sind hier wichtige Sammlungs-
räume: sie bergen das erlesene Berliner Porzellan des
Kunstgewerbemuseums. Den Höhepunkt der Interieur-
Kunst des Mittelgeschosses bildet dann, unserer Meinung
nach, der intime Konzertsaal Gontards in seinem stil-
vollen weiß-goldenen Louis XVI.-Schmuck.
Die Schausammlung aber, wie sie leibt und lebt,
befindet sich eigentlich irn Obergeschoß, von dessen
Weißem Saal der von Falke bearbeitete Führer*) ausgeht.
In den Räumen dieses Geschosses haben der General-
direktor und seine unermüdlichen Mitarbeiter Hermann
S c h m i t z und Ludwig Schnorrvon Carolsfeld
ihre Trümpfe ausgespielt. Reizend machen sich da die
beiden Bronzegruppen am Eingang zu der nach 1707
erbauten Eosandergalerie, von deren Mercier-Cyklus (den
Gobelins mit der Darstellung der Taten des großen
Kurftirsten) die schlanke Vitrinenreihe mit den deutschen
Gläsern sich blitzend abhebt. Und nicht minder glück-
lich war der Einfall, die ehemalige Braunschweigische
Galerie mit ihren Spiegelnischen mit den August Rex-,
Hörold- und Kaendler-Porzellanen zu füllen und den
Hauptstticken der süddeutschen Manufakturen.
Der Kapitelsaal eröffnet die Reihe der Schlüterschen
Festräume. Es war sicher nicht leicht, dem phantasie-
reichen Schlüterschen Barock das richtige kunstgewerb-
liche Gegengewicht zu geben, aber man hat auch dieses
Hemmnis überwunden: im Rittersaal steht jetzt das
mächtige Silber der Sammlung — die allzuschweren
Vitrinen werden wohl einmal duftigeren Gebilden
weichen — im Schweizersaal hängen die deutschen Glas-
malereien des 13. bis 15. Jahrhunderts (sehr zum Nutzen
der Reihe), im einstigen Joachimssaal glänzen die un-
vergleichlichen italienischen Majoliken des Kunstgewerbe-
museums. Die lüstrierten Gubbioteller des Giorgio
Andreoli und die Urbino-Stticke des Francesco Xanto
Avelli und der beiden Fontana passen wunderbar zu den
Trionfi-Gobelins des van Orley, deren Farben die Wände
des Joachimsaales beleben. Schon dieser einzige Raum
unter den siebzig Räumen des Schloßmuseums ist ein
großes Erlebnis.
*) Deutscher Kunstverlag, Berlin.
Gobelingalerie
4
gotischen Leinenstickereien prangen, während der zweite
Raum die frühen Limogessachen usw. beherbergt. Hier
schließt sich die Frühgotik an. Daß übrigens im Schloß-
museum die Nürnberger, ostschweizerischen und flan-
drischen Teppiche weitaus stärker zur Wirkung kommen
als im alten Kunstgev/erbemuseum, das verdient ebenso
vermerkt zu werden wie die Tatsache, daß sich im nord-
deutschen Renaissancezimmer Falkes geliebtes und erst
durch seine Forschung wissenschaftlich gewertetes rhei-
nisches Steinzeug vorzüglich ausnimmt.
Das sind so die Attraktionen des Erdgeschosses.
Im Mittelgeschoß sieht man dann die Kunst der franzö-
sischen Renaissance, des französischen wie des deutschen
Barock und die Interieurschönheiten der bisher kaum
gekannten sogenannten Königskammern, die von Gontard
und Erdmannsdorf aus den Jahren 1787 bis 1790 stammen.
Es war überaus klug, daß man in diesen Räumen nicht
Kunstdinge anhäufte, die nicht am Platze gewesen wären,
sondern daß man einfach hierher ein kleines Möbel
stellte, das nun mit dem Raum wie verwachsen ist,
dorthin eine Bronze, die die Wärme des Raumes erhöht
usw. Und drei Räume sind hier wichtige Sammlungs-
räume: sie bergen das erlesene Berliner Porzellan des
Kunstgewerbemuseums. Den Höhepunkt der Interieur-
Kunst des Mittelgeschosses bildet dann, unserer Meinung
nach, der intime Konzertsaal Gontards in seinem stil-
vollen weiß-goldenen Louis XVI.-Schmuck.
Die Schausammlung aber, wie sie leibt und lebt,
befindet sich eigentlich irn Obergeschoß, von dessen
Weißem Saal der von Falke bearbeitete Führer*) ausgeht.
In den Räumen dieses Geschosses haben der General-
direktor und seine unermüdlichen Mitarbeiter Hermann
S c h m i t z und Ludwig Schnorrvon Carolsfeld
ihre Trümpfe ausgespielt. Reizend machen sich da die
beiden Bronzegruppen am Eingang zu der nach 1707
erbauten Eosandergalerie, von deren Mercier-Cyklus (den
Gobelins mit der Darstellung der Taten des großen
Kurftirsten) die schlanke Vitrinenreihe mit den deutschen
Gläsern sich blitzend abhebt. Und nicht minder glück-
lich war der Einfall, die ehemalige Braunschweigische
Galerie mit ihren Spiegelnischen mit den August Rex-,
Hörold- und Kaendler-Porzellanen zu füllen und den
Hauptstticken der süddeutschen Manufakturen.
Der Kapitelsaal eröffnet die Reihe der Schlüterschen
Festräume. Es war sicher nicht leicht, dem phantasie-
reichen Schlüterschen Barock das richtige kunstgewerb-
liche Gegengewicht zu geben, aber man hat auch dieses
Hemmnis überwunden: im Rittersaal steht jetzt das
mächtige Silber der Sammlung — die allzuschweren
Vitrinen werden wohl einmal duftigeren Gebilden
weichen — im Schweizersaal hängen die deutschen Glas-
malereien des 13. bis 15. Jahrhunderts (sehr zum Nutzen
der Reihe), im einstigen Joachimssaal glänzen die un-
vergleichlichen italienischen Majoliken des Kunstgewerbe-
museums. Die lüstrierten Gubbioteller des Giorgio
Andreoli und die Urbino-Stticke des Francesco Xanto
Avelli und der beiden Fontana passen wunderbar zu den
Trionfi-Gobelins des van Orley, deren Farben die Wände
des Joachimsaales beleben. Schon dieser einzige Raum
unter den siebzig Räumen des Schloßmuseums ist ein
großes Erlebnis.
*) Deutscher Kunstverlag, Berlin.
Gobelingalerie
4