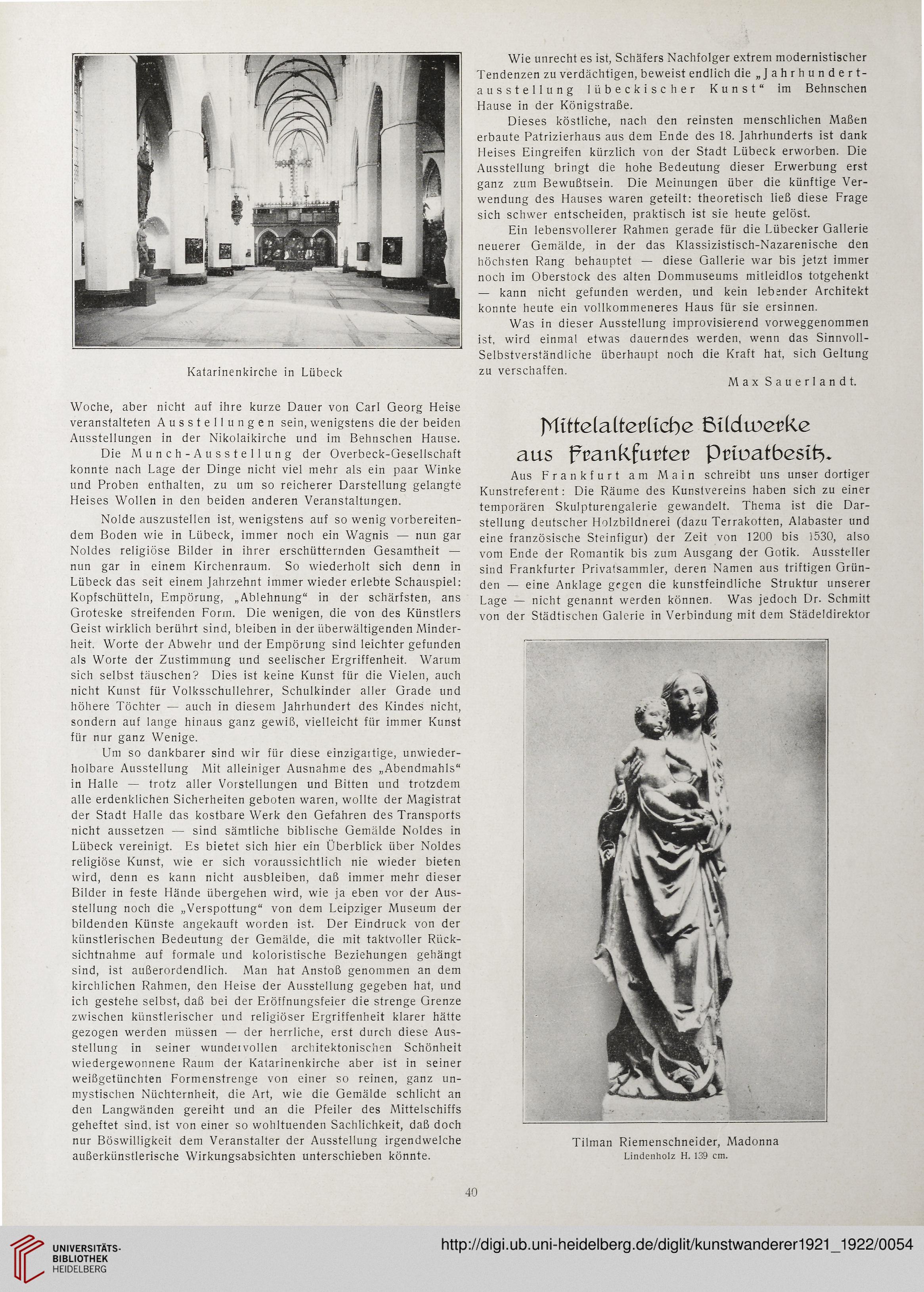Katarinenkirche in Lübeck
Woche, aber nicht auf ihre kurze Dauer von Carl Georg Heise
veranstalteten Ausstellungen sein, wenigstens die der beiden
Ausstellungen in der Nikolaikirche und im Behnschen Hause.
Die Munch-Ausstellung der Overbeck-Gesellschaft
konnte nach Lage der Dinge nicht viel mehr als ein paar Winke
und Proben enthalten, zu um so reicherer Darstellung gelangte
Heises Wollen in den beiden anderen Veranstaltungen.
Nolde auszustellen ist, wenigstens auf so wenig vorbereiten-
dem Boden wie in Lübeck, immer noch ein Wagnis — nun gar
Noldes religiöse Bilder in ihrer erschütternden Gesamtheit —
nun gar in einem Kirchenraum. So wiederholt sich denn in
Lübeck das seit einem Jahrzehnt immer wieder erlebte Schauspiel:
Kopfschütteln, Empörung, „Ablehnung“ in der schärfsten, ans
Groteske streifenden Forrn. Die wenigen, die von des Künstlers
Geist wirklich berührt sind, bleiben in der überwältigenden Minder-
heit. Worte der Abwehr und der Empörung sind leichter gefunden
als Worte der Zustimmung und seelischer Ergriffenheit. Warum
sich selbst täuschen? Dies ist keine Kunst für die Vielen, auch
nicht Kunst für Volksschullehrer, Schulkinder aller Grade und
höhere Töchter — auch in diesem Jahrhundert des Kindes nicht,
sondern auf Iange hinaus ganz gewiß, vielleicht für immer Kunst
für nur ganz Wenige.
Um so dankbarer sind wir für diese einzigaitige, unwieder-
holbare Ausstellung Mit alleiniger Ausnahme des „Abendmahls“
in Halle — trotz aller Vorstellungen und Bitten und trotzdem
alle erdenklichen Sicherheiten geboten waren, wollte der Magistrat
der Stadt Halle das kostbare Werk den Gefahren des Transports
nicht aussetzen — sind sämtliche biblische Gemälde Noldes in
Lübeck vereinigt. Es bietet sich hier ein Überblick über Noldes
religiöse Kunst, wie er sich voraussichtlich nie wieder bieten
wird, denn es kann nicht ausbleiben, daß immer mehr dieser
Bilder in feste Hände übergehen wird, wie ja eben vor der Aus-
stellung noch die „Verspottung“ von dem Leipziger Museum der
bildenden Künste angekauft worden ist. Der Eindruck von der
kiinstlerischen Bedeutung der Gemälde, die mit taktvoller Rück-
sichtnahme auf formale und koloristische Beziehungen gehängt
sind, ist außerordendlich. Man hat Anstoß genommen an dem
kirchlichen Rahmen, den Heise der Ausstellung gegeben hat, und
ich gestehe selbst, daß bei der Eröffnungsfeier die strenge Grenze
zwischen künstlerischer und religiöser Ergriffenheit klarer hätte
gezogen werden müssen — der herrliche, erst durch diese Aus-
stellung in seiner wundeivollen architektonischen Schönheit
wiedergewonnene Raum der Katarinenkirche aber ist in seiner
weißgetünchten Formenstrenge von einer so reinen, ganz un-
mystischen Nüchternheit, die Art, wie die Gemälde schlicht an
den Langwänden gereiht und an die Pfeiler des Mittelschiffs
geheftet sind, ist von einer so wohltuenden Sachlichkeit, daß doch
nur Böswilligkeit dem Veranstalter der Ausstellung irgendwelche
außerkünstlerische Wirkungsabsichten unterschieben könnte.
Wie unrecht es ist, Schäfers Nachfolger extrem modernistischer
Tendenzen zu verdächtigen, beweist endlich die „Jahrhundert-
ausstellung lübeckischer Kunst“ im Behnschen
Hause in der Königstraße.
Dieses köstliche, nach den reinsten menschlichen Maßen
erbaute Patrizierhaus aus dem Ende des 18. Jahrhunderts ist dank
Heises Eingreifen kürzlich von der Stadt Lübeck erworben. Die
Ausstellung bringt die hohe Bedeutung dieser Erwerbung erst
ganz zum Bewußtsein. Die Meinungen über die künftige Ver-
wendung des Hauses waren geteilt: theoretisch ließ diese Frage
sich schwer entscheiden, praktisch ist sie heute gelöst.
Ein lebensvollerer Rahmen gerade für die Lübecker Gallerie
neuerer Gemälde, in der das Klassizistisch-Nazarenische den
höchsten Rang behauptet — diese Gallerie war bis jetzt immer
noch im Oberstock des alten Dommuseums mitleidlos totgehenkt
— kann nicht gefunden werden, und kein Iebender Architekt
konnte heute ein vollkommeneres Haus für sie ersinnen.
Was in dieser Ausstellung improvisierend vorweggenommen
ist, wird einmal etwas dauerndes werden, wenn das Sinnvoll-
Selbstverständliche überhaupt noch die Kraft hat, sich Geltung
zu verschaffen.
Max Sauerlandt.
JyUttelaltevlicbe Bildtoct’ke
aus pt’ankfut’tet’ Pt’ioatbesitv
Aus Frankfurt am Main schreibt uns unser dortiger
Kunstreferent: Die Räume des Kunstvereins haben sich zu einer
temporären Skulpturengalerie gewandelt. Thema ist die Dar-
stellung deutscher Holzbildnerei (dazu Terrakotten, Alabaster und
eine französische Steinfigur) der Zeit von 1200 bis 1530, also
vom Ende der Romantik bis zum Ausgang der Gotik. Aussteller
sind Frankfurter Privatsammler, deren Namen aus triftigen Grün-
den — eine Anklage gegen die kunstfeindliche Struktur unserer
Lage — nicht genannt werden können. Was jedoch Dr. Schmitt
von der Städtischen Galerie in Verbindung mit dem Städeldirektor
Tilman Riemenschneider, Madonna
Lindenholz H. 139 cm.
40
Woche, aber nicht auf ihre kurze Dauer von Carl Georg Heise
veranstalteten Ausstellungen sein, wenigstens die der beiden
Ausstellungen in der Nikolaikirche und im Behnschen Hause.
Die Munch-Ausstellung der Overbeck-Gesellschaft
konnte nach Lage der Dinge nicht viel mehr als ein paar Winke
und Proben enthalten, zu um so reicherer Darstellung gelangte
Heises Wollen in den beiden anderen Veranstaltungen.
Nolde auszustellen ist, wenigstens auf so wenig vorbereiten-
dem Boden wie in Lübeck, immer noch ein Wagnis — nun gar
Noldes religiöse Bilder in ihrer erschütternden Gesamtheit —
nun gar in einem Kirchenraum. So wiederholt sich denn in
Lübeck das seit einem Jahrzehnt immer wieder erlebte Schauspiel:
Kopfschütteln, Empörung, „Ablehnung“ in der schärfsten, ans
Groteske streifenden Forrn. Die wenigen, die von des Künstlers
Geist wirklich berührt sind, bleiben in der überwältigenden Minder-
heit. Worte der Abwehr und der Empörung sind leichter gefunden
als Worte der Zustimmung und seelischer Ergriffenheit. Warum
sich selbst täuschen? Dies ist keine Kunst für die Vielen, auch
nicht Kunst für Volksschullehrer, Schulkinder aller Grade und
höhere Töchter — auch in diesem Jahrhundert des Kindes nicht,
sondern auf Iange hinaus ganz gewiß, vielleicht für immer Kunst
für nur ganz Wenige.
Um so dankbarer sind wir für diese einzigaitige, unwieder-
holbare Ausstellung Mit alleiniger Ausnahme des „Abendmahls“
in Halle — trotz aller Vorstellungen und Bitten und trotzdem
alle erdenklichen Sicherheiten geboten waren, wollte der Magistrat
der Stadt Halle das kostbare Werk den Gefahren des Transports
nicht aussetzen — sind sämtliche biblische Gemälde Noldes in
Lübeck vereinigt. Es bietet sich hier ein Überblick über Noldes
religiöse Kunst, wie er sich voraussichtlich nie wieder bieten
wird, denn es kann nicht ausbleiben, daß immer mehr dieser
Bilder in feste Hände übergehen wird, wie ja eben vor der Aus-
stellung noch die „Verspottung“ von dem Leipziger Museum der
bildenden Künste angekauft worden ist. Der Eindruck von der
kiinstlerischen Bedeutung der Gemälde, die mit taktvoller Rück-
sichtnahme auf formale und koloristische Beziehungen gehängt
sind, ist außerordendlich. Man hat Anstoß genommen an dem
kirchlichen Rahmen, den Heise der Ausstellung gegeben hat, und
ich gestehe selbst, daß bei der Eröffnungsfeier die strenge Grenze
zwischen künstlerischer und religiöser Ergriffenheit klarer hätte
gezogen werden müssen — der herrliche, erst durch diese Aus-
stellung in seiner wundeivollen architektonischen Schönheit
wiedergewonnene Raum der Katarinenkirche aber ist in seiner
weißgetünchten Formenstrenge von einer so reinen, ganz un-
mystischen Nüchternheit, die Art, wie die Gemälde schlicht an
den Langwänden gereiht und an die Pfeiler des Mittelschiffs
geheftet sind, ist von einer so wohltuenden Sachlichkeit, daß doch
nur Böswilligkeit dem Veranstalter der Ausstellung irgendwelche
außerkünstlerische Wirkungsabsichten unterschieben könnte.
Wie unrecht es ist, Schäfers Nachfolger extrem modernistischer
Tendenzen zu verdächtigen, beweist endlich die „Jahrhundert-
ausstellung lübeckischer Kunst“ im Behnschen
Hause in der Königstraße.
Dieses köstliche, nach den reinsten menschlichen Maßen
erbaute Patrizierhaus aus dem Ende des 18. Jahrhunderts ist dank
Heises Eingreifen kürzlich von der Stadt Lübeck erworben. Die
Ausstellung bringt die hohe Bedeutung dieser Erwerbung erst
ganz zum Bewußtsein. Die Meinungen über die künftige Ver-
wendung des Hauses waren geteilt: theoretisch ließ diese Frage
sich schwer entscheiden, praktisch ist sie heute gelöst.
Ein lebensvollerer Rahmen gerade für die Lübecker Gallerie
neuerer Gemälde, in der das Klassizistisch-Nazarenische den
höchsten Rang behauptet — diese Gallerie war bis jetzt immer
noch im Oberstock des alten Dommuseums mitleidlos totgehenkt
— kann nicht gefunden werden, und kein Iebender Architekt
konnte heute ein vollkommeneres Haus für sie ersinnen.
Was in dieser Ausstellung improvisierend vorweggenommen
ist, wird einmal etwas dauerndes werden, wenn das Sinnvoll-
Selbstverständliche überhaupt noch die Kraft hat, sich Geltung
zu verschaffen.
Max Sauerlandt.
JyUttelaltevlicbe Bildtoct’ke
aus pt’ankfut’tet’ Pt’ioatbesitv
Aus Frankfurt am Main schreibt uns unser dortiger
Kunstreferent: Die Räume des Kunstvereins haben sich zu einer
temporären Skulpturengalerie gewandelt. Thema ist die Dar-
stellung deutscher Holzbildnerei (dazu Terrakotten, Alabaster und
eine französische Steinfigur) der Zeit von 1200 bis 1530, also
vom Ende der Romantik bis zum Ausgang der Gotik. Aussteller
sind Frankfurter Privatsammler, deren Namen aus triftigen Grün-
den — eine Anklage gegen die kunstfeindliche Struktur unserer
Lage — nicht genannt werden können. Was jedoch Dr. Schmitt
von der Städtischen Galerie in Verbindung mit dem Städeldirektor
Tilman Riemenschneider, Madonna
Lindenholz H. 139 cm.
40