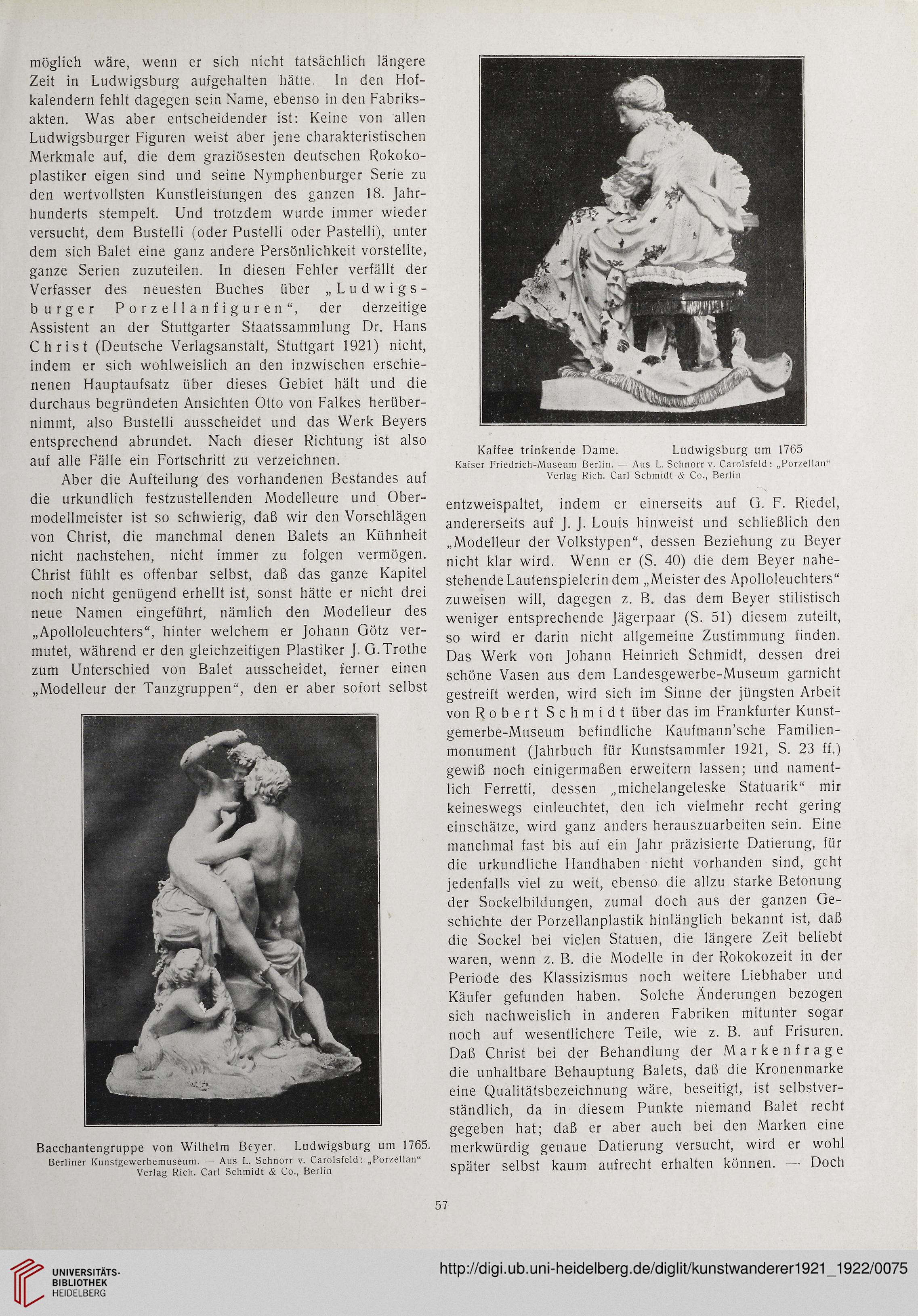Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 3./4.1921/22
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0075
DOI issue:
1. Oktoberheft
DOI article:Pazaurek, Gustav Edmund: Ludwigsburger Porzellanfiguren
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0075
möglich wäre, wenn er sich nicht tatsächlich längere
Zeit in Ludwigsburg aufgehalten hätte. In den Hof-
kalendern fehlt dagegen sein Name, ebenso in den Fabriks-
akten. Was aber entscheidender ist: Keine von allen
Ludwigsburger Figuren weist aber jene charakteristischen
Merkmale auf, die dem graziösesten deutschen Rokoko-
plastiker eigen sind und seine Nymphenburger Serie zu
den wertvollsten Kunstleistungen des ganzen 18. Jahr-
hunderts stempelt. Und trotzdem wurde immer wieder
versucht, dem Bustelli (oder Pustelli oder Pastelli), unter
dem sich Balet eine ganz andere Persönlichkeit vorstellte,
ganze Serien zuzuteilen. In diesen Fehler verfällt der
Verfasser des neuesten Buches über „Ludwigs-
burger Porzellanfiguren“, der derzeitige
Assistent an der Stuttgarter Staatssammlung Dr. Hans
Christ (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1921) nicht,
indem er sich wohlweislich an den inzwischen erschie-
nenen Hauptaufsatz über dieses Gebiet hält und die
durchaus begründeten Ansichten Otto von Falkes herüber-
nimmt, also Bustelii ausscheidet und das Werk Beyers
entsprechend abrundet. Nach dieser Richtung ist also
auf alle Fälle ein Fortschritt zu verzeichnen.
Aber die Aufteilung des vorhandenen Bestandes auf
die urkundlich festzustellenden Modelleure und Ober-
modellmeister ist so schwierig, daß wir den Vorschlägen
von Christ, die manchmal denen Balets an Kühnheit
nicht nachstehen, nicht immer zu folgen vermögen.
Christ fühlt es offenbar selbst, daß das ganze Kapitel
noch nicht genügend erhellt ist, sonst hätte er nicht drei
neue Namen eingeführt, nämlich den Modelleur des
„Apolloleuchters“, hinter welchem er Johann Götz ver-
mutet, während er den gleichzeitigen Plastiker J. G.Trothe
zum Unterschied von Balet ausscheidet, ferner einen
„Modelleur der Tanzgruppen“, den er aber sofort selbst
Bacchantengruppe von Wilhelm Beyer. Ludwigsburg um 1765.
Berliner Kunstgewerbemuseum. — Aus L. Schnorr v. Carolsfeld: „Porzellan“
Verlag Ricli. Carl Schmidt & Co., Berlin
Kaffee trinkende Dame. Ludwigsburg um 1765
Kaiser Friedrich-Museum Berlin. — Aus L. Schnorr v. Carolsfeld: „Porzellan“
Verlag Rich. Carl Schmidt & Co., Berlin
entzweispaltet, indem er einerseits auf G. F. Riedel,
andererseits auf J. J. Louis hinweist und schließlich den
„Modelleur der Volkstypen“, dessen Beziehung zu Beyer
nicht klar wird. Wenn er (S. 40) die dem Beyer nahe-
stehende Lautenspielerin dem „Meister des Apolloleuchters“
zuweisen will, dagegen z. B. das dem Beyer stilistisch
weniger entsprechende Jägerpaar (S. 51) diesem zuteilt,
so wird er darin nicht allgemeine Zustimmung finden.
Das Werk von Johann Heinrich Schmidt, dessen drei
schöne Vasen aus dem Landesgewerbe-Museum garnicht
gestreift werden, wird sich im Sinne der jüngsten Arbeit
von Robert Schmidt über das im Frankfurter Kunst-
gemerbe-Museum befindliche Kaufmann’sche Familien-
monument (Jahrbuch für Kunstsammler 1921, S. 23 ff.)
gewiß noch einigermaßen erweitern lassen; und nament-
lich Ferretti, dessen „michelangeleske Statuarik“ mir
keineswegs einleuchtet, den ich vielmehr recht gering
einschätze, wird ganz anders herauszuarbeiten sein. Eine
manchmal fast bis auf ein Jahr präzisierte Datierung, für
die urkundliche Handhaben nicht vorhanden sind, geht
jedenfalls viel zu weit, ebenso die allzu starke Betonung
der Sockelbildungen, zumal doch aus der ganzen Ge-
schichte der Porzellanplastik hinlänglich bekannt ist, daß
die Sockel bei vielen Statuen, die längere Zeit beliebt
waren, wenn z. B. die Modelle in der Rokokozeit in der
Periode des Klassizismus noch weitere Liebhaber und
Käufer gefunden haben. Solche Änderungen bezogen
sich nachweislich in anderen Fabriken mitunter sogar
noch auf wesentlichere Teile, wie z. B. auf Frisuren.
Daß Christ bei der Behandiung der Markenfrage
die unhaltbare Behauptung Balets, daß die Kronenmarke
eine Qualitätsbezeichnung wäre, beseitigt, ist selbstver-
ständlich, da in diesem Punkte niemand Balet recht
gegeben hat; daß er aber auch bei den Marken eine
merkwürdig genaue Datierung versucht, wird er wohl
später selbst kaum aufrecht erhalten können. — Doch
57
Zeit in Ludwigsburg aufgehalten hätte. In den Hof-
kalendern fehlt dagegen sein Name, ebenso in den Fabriks-
akten. Was aber entscheidender ist: Keine von allen
Ludwigsburger Figuren weist aber jene charakteristischen
Merkmale auf, die dem graziösesten deutschen Rokoko-
plastiker eigen sind und seine Nymphenburger Serie zu
den wertvollsten Kunstleistungen des ganzen 18. Jahr-
hunderts stempelt. Und trotzdem wurde immer wieder
versucht, dem Bustelli (oder Pustelli oder Pastelli), unter
dem sich Balet eine ganz andere Persönlichkeit vorstellte,
ganze Serien zuzuteilen. In diesen Fehler verfällt der
Verfasser des neuesten Buches über „Ludwigs-
burger Porzellanfiguren“, der derzeitige
Assistent an der Stuttgarter Staatssammlung Dr. Hans
Christ (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1921) nicht,
indem er sich wohlweislich an den inzwischen erschie-
nenen Hauptaufsatz über dieses Gebiet hält und die
durchaus begründeten Ansichten Otto von Falkes herüber-
nimmt, also Bustelii ausscheidet und das Werk Beyers
entsprechend abrundet. Nach dieser Richtung ist also
auf alle Fälle ein Fortschritt zu verzeichnen.
Aber die Aufteilung des vorhandenen Bestandes auf
die urkundlich festzustellenden Modelleure und Ober-
modellmeister ist so schwierig, daß wir den Vorschlägen
von Christ, die manchmal denen Balets an Kühnheit
nicht nachstehen, nicht immer zu folgen vermögen.
Christ fühlt es offenbar selbst, daß das ganze Kapitel
noch nicht genügend erhellt ist, sonst hätte er nicht drei
neue Namen eingeführt, nämlich den Modelleur des
„Apolloleuchters“, hinter welchem er Johann Götz ver-
mutet, während er den gleichzeitigen Plastiker J. G.Trothe
zum Unterschied von Balet ausscheidet, ferner einen
„Modelleur der Tanzgruppen“, den er aber sofort selbst
Bacchantengruppe von Wilhelm Beyer. Ludwigsburg um 1765.
Berliner Kunstgewerbemuseum. — Aus L. Schnorr v. Carolsfeld: „Porzellan“
Verlag Ricli. Carl Schmidt & Co., Berlin
Kaffee trinkende Dame. Ludwigsburg um 1765
Kaiser Friedrich-Museum Berlin. — Aus L. Schnorr v. Carolsfeld: „Porzellan“
Verlag Rich. Carl Schmidt & Co., Berlin
entzweispaltet, indem er einerseits auf G. F. Riedel,
andererseits auf J. J. Louis hinweist und schließlich den
„Modelleur der Volkstypen“, dessen Beziehung zu Beyer
nicht klar wird. Wenn er (S. 40) die dem Beyer nahe-
stehende Lautenspielerin dem „Meister des Apolloleuchters“
zuweisen will, dagegen z. B. das dem Beyer stilistisch
weniger entsprechende Jägerpaar (S. 51) diesem zuteilt,
so wird er darin nicht allgemeine Zustimmung finden.
Das Werk von Johann Heinrich Schmidt, dessen drei
schöne Vasen aus dem Landesgewerbe-Museum garnicht
gestreift werden, wird sich im Sinne der jüngsten Arbeit
von Robert Schmidt über das im Frankfurter Kunst-
gemerbe-Museum befindliche Kaufmann’sche Familien-
monument (Jahrbuch für Kunstsammler 1921, S. 23 ff.)
gewiß noch einigermaßen erweitern lassen; und nament-
lich Ferretti, dessen „michelangeleske Statuarik“ mir
keineswegs einleuchtet, den ich vielmehr recht gering
einschätze, wird ganz anders herauszuarbeiten sein. Eine
manchmal fast bis auf ein Jahr präzisierte Datierung, für
die urkundliche Handhaben nicht vorhanden sind, geht
jedenfalls viel zu weit, ebenso die allzu starke Betonung
der Sockelbildungen, zumal doch aus der ganzen Ge-
schichte der Porzellanplastik hinlänglich bekannt ist, daß
die Sockel bei vielen Statuen, die längere Zeit beliebt
waren, wenn z. B. die Modelle in der Rokokozeit in der
Periode des Klassizismus noch weitere Liebhaber und
Käufer gefunden haben. Solche Änderungen bezogen
sich nachweislich in anderen Fabriken mitunter sogar
noch auf wesentlichere Teile, wie z. B. auf Frisuren.
Daß Christ bei der Behandiung der Markenfrage
die unhaltbare Behauptung Balets, daß die Kronenmarke
eine Qualitätsbezeichnung wäre, beseitigt, ist selbstver-
ständlich, da in diesem Punkte niemand Balet recht
gegeben hat; daß er aber auch bei den Marken eine
merkwürdig genaue Datierung versucht, wird er wohl
später selbst kaum aufrecht erhalten können. — Doch
57