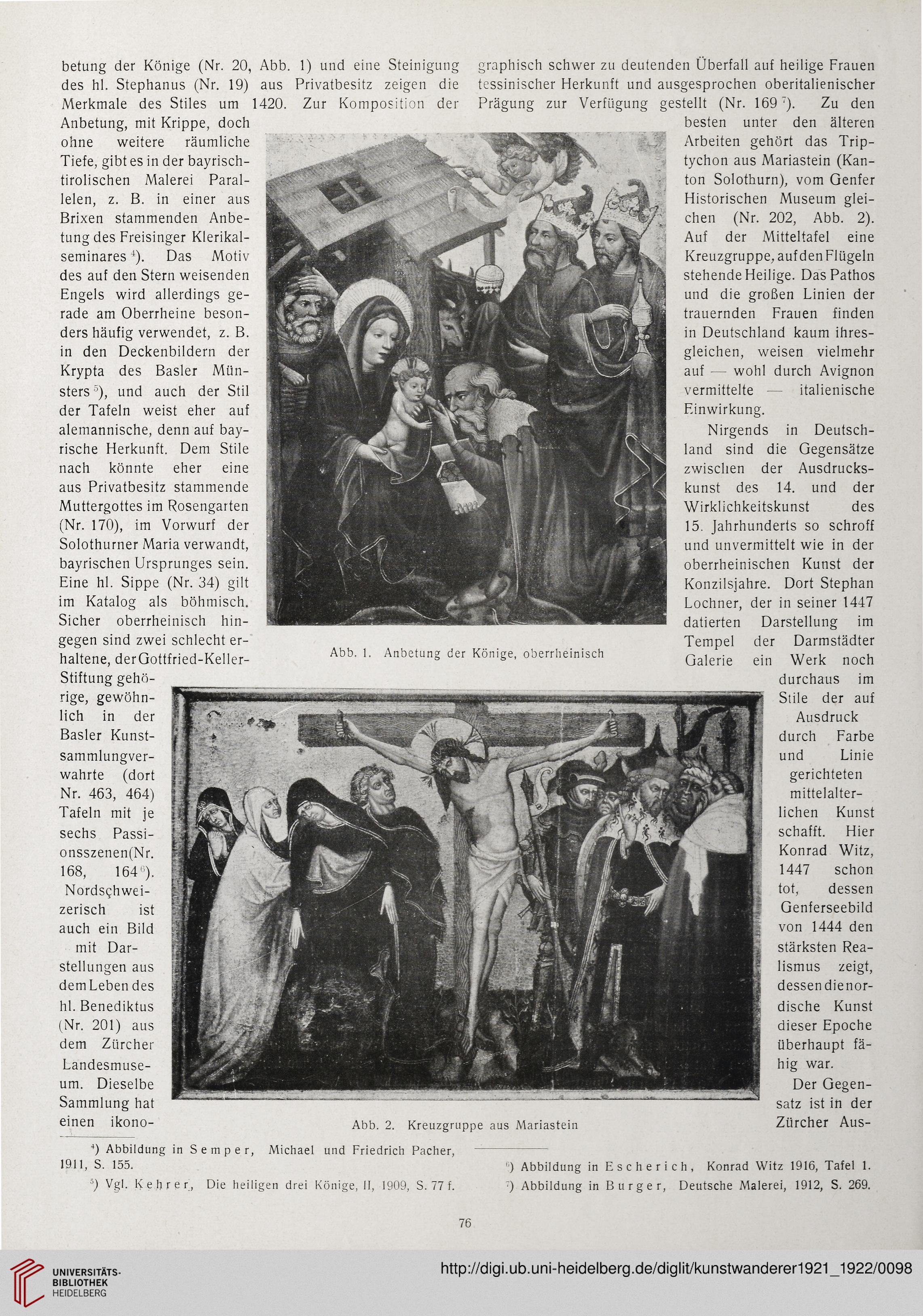Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 3./4.1921/22
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0098
DOI Heft:
2. Oktoberheft
DOI Artikel:Baum, Julius: Die Zürchner Ausstellung, [1]
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0098
betung der Könige (Nr. 20, Abb.
des hl. Stephanus (Nr. 19) aus
Merkmale des Stiles um 1420.
Anbetung, mit Krippe, doch
ohne weitere räumliche
Tiefe, gibt es in der bayrisch-
tirolischen Malerei Paral-
lelen, z. B. in einer aus
Brixen stammenden Anbe-
tung des Freisinger Klerikal-
seminares4). Das Motiv
des auf den Stern weisenden
Engels wird allerdings ge-
rade am Oberrheine beson-
ders häufig verwendet, z. B.
in den Deckenbildern der
Krypta des Basler Mün-
sters5), und auch der Stil
der Tafeln weist eher auf
alemannische, denn auf bay-
rische Herkunft. Dem Stile
nach könnte eher eine
aus Privatbesitz stammende
Muttergottes im Rosengarten
(Nr. 170), im Vorwurf der
Solothurner Maria verwandt,
bayrischen Ursprunges sein.
Eine hl. Sippe (Nr. 34) gilt
im Katalog als böhmisch.
Sicher oberrheinisch hin-
gegen sind zwei schlecht er-
haltene, derGottfried-Keller-
Stiftung gehö-
rige, gewöhn-
lich in der
Basler Kunst-
sammlungver-
wahrte (dort
Nr. 463, 464)
Tafeln mit je
sechs Passi-
onsszenen(Nr.
168, 164").
Nordschwei-
zerisch ist
auch ein Bild
mit Dar-
stellungen aus
dem Leben des
1) und eine Steinigung graphisch schwer zu deutenden Überfall auf heilige Frauen
Privatbesitz zeigen die tessinischer Herkunft und ausgesprochen oberitalienischer
Zur Komposition der Prägung zur Verfügung gestellt (Nr. 169 ")• Zu den
besten unter den älteren
Arbeiten gehört das Trip-
tychon aus Mariastein (Kan-
ton Solothurn), vom Genfer
Historischen Museum glei-
chen (Nr. 202, Abb. 2).
Auf der Mitteltafel eine
Kreuzgruppe, auf den Flügeln
stehende Heilige. Das Pathos
und die großen Linien der
trauernden Frauen finden
in Deutschland kaum ihres-
gleichen, weisen vielmehr
auf —- wohl durch Avignon
vermittelte — italienische
Einwirkung.
Nirgends in Deutsch-
land sind die Gegensätze
zwischen der Ausdrucks-
kunst des 14. und der
Wirklichkeitskunst des
15. Jahrhunderts so schroff
und unvermittelt wie in der
oberrheinischen Kunst der
Konzilsjahre. Dort Stephan
Lochner, der in seiner 1447
datierten Darstellung im
Tempel der Darmstädter
Galerie ein Werk noch
durchaus im
Stile der auf
Ausdruck
durch Farbe
und Linie
gerichteten
mittelalter-
lichen Kunst
schafft. Hier
Konrad Witz,
1447 schon
tot, dessen
Genferseebild
von 1444 den
dische Kunst
dieser Epoche
überhaupt fä-
hig war.
Der Gegen-
satz ist in der
Zürcher Aus-
Abb, 1. Anbetung der Könige, oberrheinisch
Abb. 2. Kreuzgruppe aus Mariastein
hl. Benediktus
(Nr. 201) aus
dem Zürcher
Landesmuse-
um. Dieselbe
Sammlung hat
einen ikono-
4) Abbildung in S e m p e r, Michael und Friedrich Pacher,
1911, S. 155.
ö) Vgl. Kehrer, Die heiligen drei Könige, II, 1909, S. 77 f.
stärksten Rea-
lismus zeigt,
dessendienor-
76
') Abbildung in Escherich, Konrad Witz 1916, Tafel 1.
7) Abbildung in Burger, Deutsche Malerei, 1912, S. 269.
des hl. Stephanus (Nr. 19) aus
Merkmale des Stiles um 1420.
Anbetung, mit Krippe, doch
ohne weitere räumliche
Tiefe, gibt es in der bayrisch-
tirolischen Malerei Paral-
lelen, z. B. in einer aus
Brixen stammenden Anbe-
tung des Freisinger Klerikal-
seminares4). Das Motiv
des auf den Stern weisenden
Engels wird allerdings ge-
rade am Oberrheine beson-
ders häufig verwendet, z. B.
in den Deckenbildern der
Krypta des Basler Mün-
sters5), und auch der Stil
der Tafeln weist eher auf
alemannische, denn auf bay-
rische Herkunft. Dem Stile
nach könnte eher eine
aus Privatbesitz stammende
Muttergottes im Rosengarten
(Nr. 170), im Vorwurf der
Solothurner Maria verwandt,
bayrischen Ursprunges sein.
Eine hl. Sippe (Nr. 34) gilt
im Katalog als böhmisch.
Sicher oberrheinisch hin-
gegen sind zwei schlecht er-
haltene, derGottfried-Keller-
Stiftung gehö-
rige, gewöhn-
lich in der
Basler Kunst-
sammlungver-
wahrte (dort
Nr. 463, 464)
Tafeln mit je
sechs Passi-
onsszenen(Nr.
168, 164").
Nordschwei-
zerisch ist
auch ein Bild
mit Dar-
stellungen aus
dem Leben des
1) und eine Steinigung graphisch schwer zu deutenden Überfall auf heilige Frauen
Privatbesitz zeigen die tessinischer Herkunft und ausgesprochen oberitalienischer
Zur Komposition der Prägung zur Verfügung gestellt (Nr. 169 ")• Zu den
besten unter den älteren
Arbeiten gehört das Trip-
tychon aus Mariastein (Kan-
ton Solothurn), vom Genfer
Historischen Museum glei-
chen (Nr. 202, Abb. 2).
Auf der Mitteltafel eine
Kreuzgruppe, auf den Flügeln
stehende Heilige. Das Pathos
und die großen Linien der
trauernden Frauen finden
in Deutschland kaum ihres-
gleichen, weisen vielmehr
auf —- wohl durch Avignon
vermittelte — italienische
Einwirkung.
Nirgends in Deutsch-
land sind die Gegensätze
zwischen der Ausdrucks-
kunst des 14. und der
Wirklichkeitskunst des
15. Jahrhunderts so schroff
und unvermittelt wie in der
oberrheinischen Kunst der
Konzilsjahre. Dort Stephan
Lochner, der in seiner 1447
datierten Darstellung im
Tempel der Darmstädter
Galerie ein Werk noch
durchaus im
Stile der auf
Ausdruck
durch Farbe
und Linie
gerichteten
mittelalter-
lichen Kunst
schafft. Hier
Konrad Witz,
1447 schon
tot, dessen
Genferseebild
von 1444 den
dische Kunst
dieser Epoche
überhaupt fä-
hig war.
Der Gegen-
satz ist in der
Zürcher Aus-
Abb, 1. Anbetung der Könige, oberrheinisch
Abb. 2. Kreuzgruppe aus Mariastein
hl. Benediktus
(Nr. 201) aus
dem Zürcher
Landesmuse-
um. Dieselbe
Sammlung hat
einen ikono-
4) Abbildung in S e m p e r, Michael und Friedrich Pacher,
1911, S. 155.
ö) Vgl. Kehrer, Die heiligen drei Könige, II, 1909, S. 77 f.
stärksten Rea-
lismus zeigt,
dessendienor-
76
') Abbildung in Escherich, Konrad Witz 1916, Tafel 1.
7) Abbildung in Burger, Deutsche Malerei, 1912, S. 269.