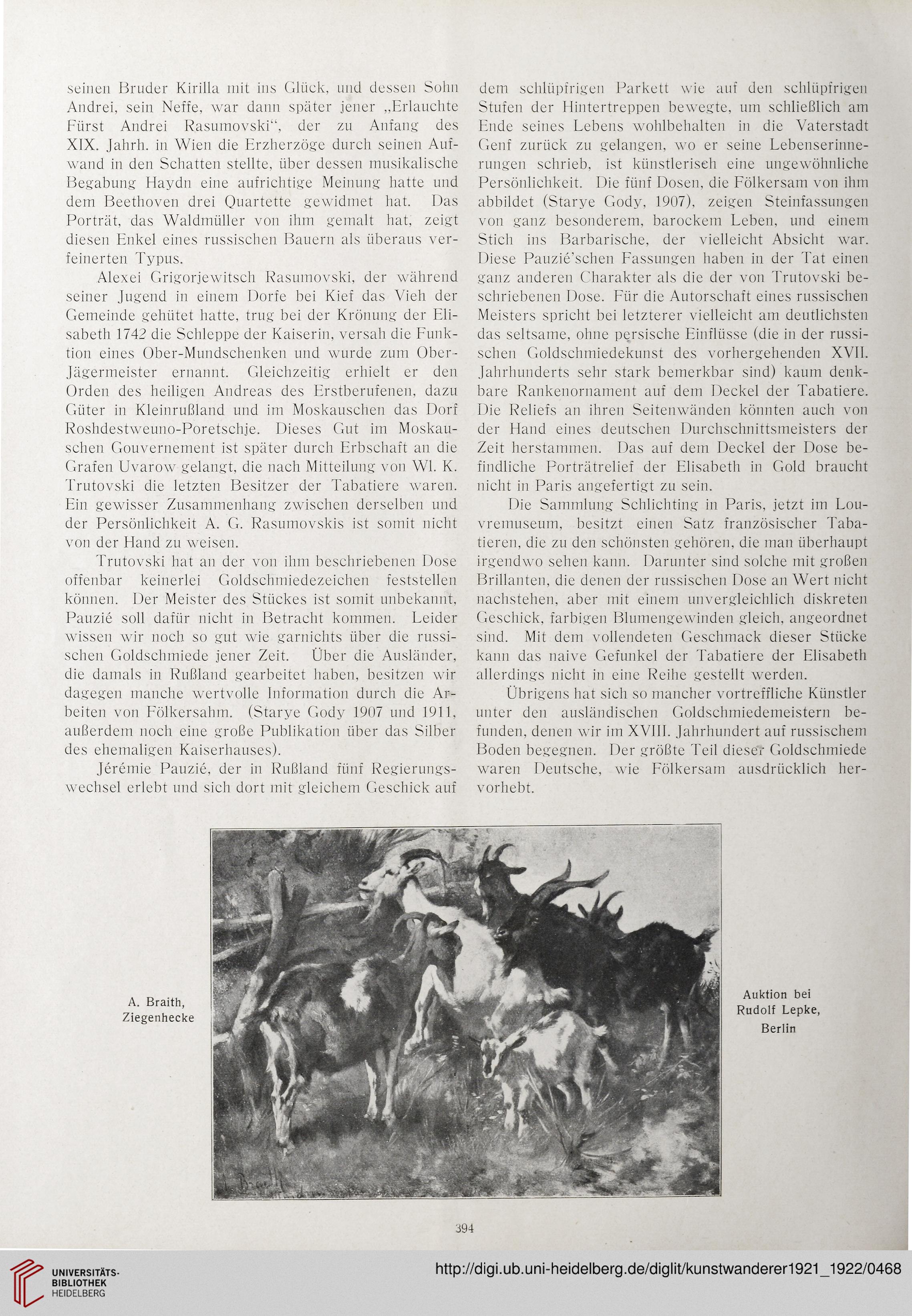Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 3./4.1921/22
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0468
DOI Heft:
1. Maiheft
DOI Artikel:Schweinfurth, Philipp: Kunst und Kunstsammeln in Rußland: die Tabatière der Kaiserin Elisabeth
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0468
seinen Bruder Kirilla mit ins Glück, und dessen Sohn
Andrei, sein Neffe, war dann später jener „Erlauchte
Fürst Andrei Rasumovski“, der zu Anfang des
XIX. Jahrh. in Wien die Erzherzöge durch seinen Auf-
wand in den Schatten stellte, über dessen musikalische
Begabung Haydn eine aufrichtige Meinung hatte und
dem Beethoven drei Quartette gewidmet hat. Das
Porträt, das Waldmüller von ihm gemalt hat, zeigt
diesen Enkel eines russischen Bauern als überaus ver-
feinerten Typus.
Alexei Grigorjewitsch Rasumovski, der während
seiner Jugend in einem Dorfe bei Kief das Vieh der
Gemeinde gehütet hatte, trug bei der Krönung der Eli-
sabeth 1742 die Schleppe der Kaiserin, versah die Funk-
tion eines Ober-Mundschenken und wurde zum Ober-
Jägermeister ernannt. Gleichzeitig erhielt er den
Orden des heiligen Andreas des Erstberufenen, dazu
Güter in Kleinrußland und im Moskauschen das Dorf
Roshdestweuno-Poretschje. Dieses Gut im Moskau-
schen Gouvernement ist später durch Erbschaft an die
Grafen Uvarow gelangt, die nach Mitteilung von Wl. K.
Trutovski die letzten Besitzer der Tabatiere waren.
Ein gewisser Zusammenhang zwischen derselben und
der Persönlichkeit A. G. Rasumovskis ist somit nicht
von der Hand zu weisen.
Trutovski hat an der von ihm beschriebenen Dose
offenbar keinerlei Goldschmiedezeichen feststellen
können. Der Meister des Stückes ist somit unbekannt,
Pauzie soll dafür nicht in Betracht kommen. Leider
wissen wir noch so gut wie garnichts über die russi-
schen Goldschmiede jener Zeit. Über die Ausländer,
die damals in Rußland gearbeitet haben, besitzen wir
dagegen manche wertvolle Information durch die Ar-
beiten von Fölkersahm. (Starye Gody 1907 und 1911,
außerdem noch eine große Publikation über das Silber
des ehemaligen Kaiserhauses).
Jeremie Pauzie, der in Rußland fünf Regierungs-
wechsel erlebt und sich dort init gleichem Geschick auf
dem schlüpfrigen Parkett wie auf den schlüpfrigen
Stufen der Hintertreppen bewegte, um schließlich am
Ende seines Lebens wohlbehalten in die Vaterstadt
Genf zurück zu gelangen, wo er seine Lebenserinne-
rungen schrieb, ist künstleriseh eine ungewöhnliche
Persönlichkeit. Die fünf Dosen, die Fölkersam von ihm
abbildet (Starye Gody, 1907), zeigen Steinfassungen
von ganz besonderem, barockem Leben, und einem
Stich ins Barbarische, der vielleicht Absicht war.
Diese Pauzie'schen Fassungen haben in der Tat einen
ganz anderen Charakter als die der von Trutovski be-
schriebenen Dose. Für die Autorschaft eines russischen
Meisters spricht bei letzterer vielleicht am deutlichsten
das seltsame, ohne persische Einflüsse (die in der russi-
schen Goldschmiedekunst des vorhergehenden XVII.
Jahrhunderts sehr stark bemerkbar sind) kaum denk-
bare Rankenornament auf dem Deckel der Tabatiere.
Die Reliefs an ihren Seitenwänden könnten auch von
der Hand eines deutschen Durchschnittsmeisters der
Zeit herstammen. Das auf dem Deckel der Dose be-
findliche Porträtrelief der Elisabeth in Gold braucht
nicht in Paris angefertigt zu sein.
Die Sammlung Schlichting in Paris, jetzt im Lou-
vremuseum, besitzt einen Satz französischer Taba-
tieren, die zu den schönsten gehören, die man überhaupt
irgendwo sehen kann. Darunter sind solche mit großen
Brillanten, die denen der russischen Dose an Wert nicht
nachstehen, aber mit einem unvergleichlich diskreten
Geschick, farbigen Blumengewinden gleich, angeordnet
sind. Mit dem vollendeten Geschmack dieser Stücke
kann das naive Gefunkel der Tabatiere der Elisabeth
allerdings nicht in eine Reihe gestellt werden.
Übrigens hat sich so mancher vortreffliche Künstler
unter den ausländischen Goldschmiedemeistern be-
funden, denen wir im XVIII. Jahrhundert auf russischem
Boden begegnen. Der größte Teil dieser Goldschmiede
waren Deutsche, wie Fölkersam ausdrücklich her-
vorhebt.
A. Braith,
Ziegenhecke
Auktion bei
Rudolf Lepke,
Berlin
Andrei, sein Neffe, war dann später jener „Erlauchte
Fürst Andrei Rasumovski“, der zu Anfang des
XIX. Jahrh. in Wien die Erzherzöge durch seinen Auf-
wand in den Schatten stellte, über dessen musikalische
Begabung Haydn eine aufrichtige Meinung hatte und
dem Beethoven drei Quartette gewidmet hat. Das
Porträt, das Waldmüller von ihm gemalt hat, zeigt
diesen Enkel eines russischen Bauern als überaus ver-
feinerten Typus.
Alexei Grigorjewitsch Rasumovski, der während
seiner Jugend in einem Dorfe bei Kief das Vieh der
Gemeinde gehütet hatte, trug bei der Krönung der Eli-
sabeth 1742 die Schleppe der Kaiserin, versah die Funk-
tion eines Ober-Mundschenken und wurde zum Ober-
Jägermeister ernannt. Gleichzeitig erhielt er den
Orden des heiligen Andreas des Erstberufenen, dazu
Güter in Kleinrußland und im Moskauschen das Dorf
Roshdestweuno-Poretschje. Dieses Gut im Moskau-
schen Gouvernement ist später durch Erbschaft an die
Grafen Uvarow gelangt, die nach Mitteilung von Wl. K.
Trutovski die letzten Besitzer der Tabatiere waren.
Ein gewisser Zusammenhang zwischen derselben und
der Persönlichkeit A. G. Rasumovskis ist somit nicht
von der Hand zu weisen.
Trutovski hat an der von ihm beschriebenen Dose
offenbar keinerlei Goldschmiedezeichen feststellen
können. Der Meister des Stückes ist somit unbekannt,
Pauzie soll dafür nicht in Betracht kommen. Leider
wissen wir noch so gut wie garnichts über die russi-
schen Goldschmiede jener Zeit. Über die Ausländer,
die damals in Rußland gearbeitet haben, besitzen wir
dagegen manche wertvolle Information durch die Ar-
beiten von Fölkersahm. (Starye Gody 1907 und 1911,
außerdem noch eine große Publikation über das Silber
des ehemaligen Kaiserhauses).
Jeremie Pauzie, der in Rußland fünf Regierungs-
wechsel erlebt und sich dort init gleichem Geschick auf
dem schlüpfrigen Parkett wie auf den schlüpfrigen
Stufen der Hintertreppen bewegte, um schließlich am
Ende seines Lebens wohlbehalten in die Vaterstadt
Genf zurück zu gelangen, wo er seine Lebenserinne-
rungen schrieb, ist künstleriseh eine ungewöhnliche
Persönlichkeit. Die fünf Dosen, die Fölkersam von ihm
abbildet (Starye Gody, 1907), zeigen Steinfassungen
von ganz besonderem, barockem Leben, und einem
Stich ins Barbarische, der vielleicht Absicht war.
Diese Pauzie'schen Fassungen haben in der Tat einen
ganz anderen Charakter als die der von Trutovski be-
schriebenen Dose. Für die Autorschaft eines russischen
Meisters spricht bei letzterer vielleicht am deutlichsten
das seltsame, ohne persische Einflüsse (die in der russi-
schen Goldschmiedekunst des vorhergehenden XVII.
Jahrhunderts sehr stark bemerkbar sind) kaum denk-
bare Rankenornament auf dem Deckel der Tabatiere.
Die Reliefs an ihren Seitenwänden könnten auch von
der Hand eines deutschen Durchschnittsmeisters der
Zeit herstammen. Das auf dem Deckel der Dose be-
findliche Porträtrelief der Elisabeth in Gold braucht
nicht in Paris angefertigt zu sein.
Die Sammlung Schlichting in Paris, jetzt im Lou-
vremuseum, besitzt einen Satz französischer Taba-
tieren, die zu den schönsten gehören, die man überhaupt
irgendwo sehen kann. Darunter sind solche mit großen
Brillanten, die denen der russischen Dose an Wert nicht
nachstehen, aber mit einem unvergleichlich diskreten
Geschick, farbigen Blumengewinden gleich, angeordnet
sind. Mit dem vollendeten Geschmack dieser Stücke
kann das naive Gefunkel der Tabatiere der Elisabeth
allerdings nicht in eine Reihe gestellt werden.
Übrigens hat sich so mancher vortreffliche Künstler
unter den ausländischen Goldschmiedemeistern be-
funden, denen wir im XVIII. Jahrhundert auf russischem
Boden begegnen. Der größte Teil dieser Goldschmiede
waren Deutsche, wie Fölkersam ausdrücklich her-
vorhebt.
A. Braith,
Ziegenhecke
Auktion bei
Rudolf Lepke,
Berlin