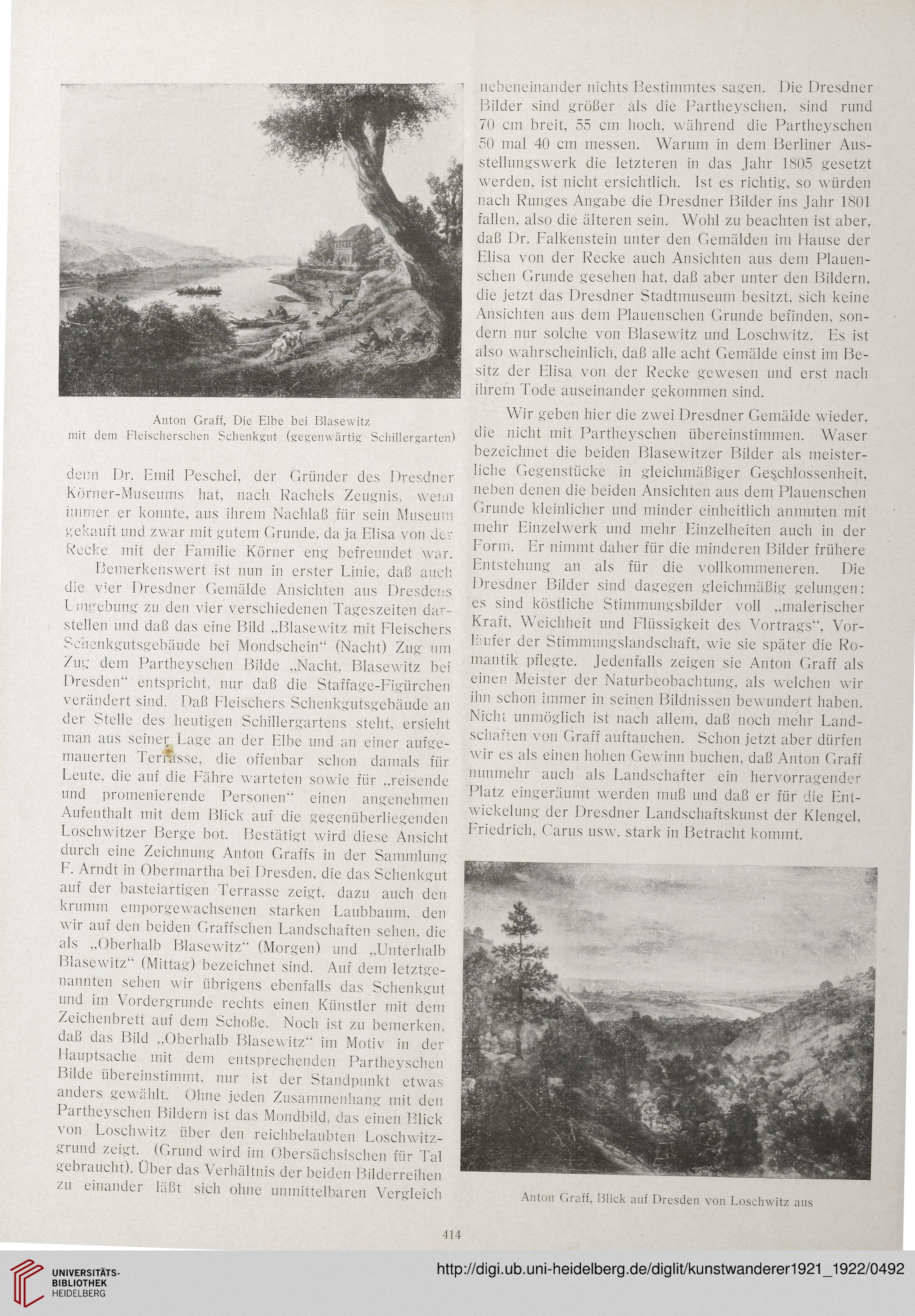Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 3./4.1921/22
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0492
DOI Heft:
2. Maiheft
DOI Artikel:Schumann, Paul: Anton Graff als Landschafter
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0492
Anton Graff, Die Elbe bei Blasewitz
mit dem Fleischerschen Schenkgut (gegenwärtig Schillergarten)
defm Dr. Emil Peschel, der Griinder des Dresdner
Körner-Museums hat, nach Rachels Zeugnis, weun
immer er konnte, aus ihrem Nachlaß ftir sein Museum
Rekauft und zwar mit gutem Grunde, da ja Elisa von der
Recke mit der Familie Körner eng befreundet war.
Bemerkenswert ist nun in erster Linie, daß auch
die vier Dresdner Gemälde Ansichten aus Dresdens
Emrebung zu den vier verschiedenen Tageszeiten dar-
stellen und daß das eine Bild „Blasewitz mit Fleischers
Schenkgutsgebäude bei Mondschein“ (Nacht) Zug um
Zug dem Partheyschen Bilde „Nacht, Blasewitz bei
Dresden“ entspricht, nur daß die Staffage-Figürchen
verändert sind. Daß Fleischers Schenkgutsgebäude an
der Stelle des heutigen Schillergartens steht, ersieht
man aus seiner Lage an der Elbe und an einer aufge-
mauerten Terrasse, die offenbar sclion damals fiir
Leute, die auf die Fähre warteten sowie ftir „reisende
und promenierende Personen“ einen angenehmen
Aufenthalt mit dem Blick auf die gegenüberliegenden
Loschwitzer Berge bot. Bestätigt wird diese Ansicht
durch eine Zeiclmung Anton Graffs in der Sammlung
F. Arndt in Obermartha bei Dresden, die das Schenkgut
auf der basteiartigen Terrasse zeigt, daztt auch den
krumm emporgewachsenen starken Laubbaum, den
wir auf den beiden Graffschen Landschaften sehen, die
als „Oberhalb Blasewitz“ (Morgen) und „Unterhalb
Blasewitz" (Mittag) bezeichnet sind. Auf dem letztge-
nannten sehen wir übrigens ebenfalls das Schenkgut
und im Vordergrunde rechts einen Künstler mit dem
Zeichenbrett auf dem Schoße. Noch ist zu bemerken,
daß das Bild „Oberhalb Blasewitz“ im Motiv in der
Hauptsache mit dem entsprechenden Partheyschen
Büde übereinstimmt, nur ist der Standpunkt etwas
anders gewählt. Ohne jeden Zusammenhang mit den
Partheyschen Bildern ist das Mondbild, das einen Blick
von Loschwitz über den reichbelaubten Loschwitz-
grund zeigt. (Grund wird im Obersächsischen für Tal
gebiaucht). Über das Verhältnis der beiden Bilderreihen
zu einander läßt sich olme unmittelbaren Vergleich
nebeneinander nichts Bestimmtes sagen. Die Dresdner
Bilder sind größer als die Partheyschen, sind rund
70 cm breit, 55 cm hoch, während die Partheyschen
50 mal 40 cm messen. Warum in dem Berliner Aus-
stellungswerk die letzteren in das Jahr 1805 gesetzt
werden, ist nicht ersichtlich. Ist es richtig, so würden
nach Runges Angabe die Dresdner Bilder ins Jahr 1801
fallen, also die älteren sein. Wolil zu beachten ist aber,
daß Dr. Falkenstein unter den Gemälden im Hause der
Elisa von der Recke auch Ansichten aus dem Plauen-
schen Grunde gesehen hat, daß aber unter den Bildern,
die jetzt das Dresdner Stadtmuseum besitzt, sich keine
Ansichten aus dem Plauenschen Grunde befinden, son-
dern nur solche von Blasewitz und Loschwitz. Fs ist
also wahrscheinlich, daß alle acht Gemälde einst im Be-
sitz der Elisa von der Recke gewesen und erst nach
ihrem Tode auseinander gekommen sind.
Wir geben hier die zwei Dresdner Gemälde wieder,
die nicht mit Partheyschen übereinstimmen. Waser
bezeichnet die beiden Blasewitzer Bilder als meister-
liche Gegenstücke in gleichmäßiger Geschlossenheit,
neben denen die beiden Ansichten aus dem Plauenschen
Grunde kleinlicher und minder einheitlich anmuten mit
mehr Einzelwerk und mehr Einzelheiten auch in der
Form. Er nimmt daher für die minderen Bilder frühere
Entstehung an als ftir die vollkommeneren. Die
Dresdner Bilder sind dagegen gleichmäßig gelungen:
es sind köstliche Stimmungsbilder voll „malerischer
Kraft, Weichheit und Flüssigkeit des Vortrags“, Vor-
läufer der Stimmnngslandschaft, wie sie später die Ro-
mantik pflegte. Jedenfalls zeigen sie Anton Graff als
einen Meister der Naturbeobachtung, als welchen wir
ihn schon immer in seinen Bildnissen bewundert haben.
Nrcht unmöglich ist nacli allem, daß noch mehr Land-
schaften von Graff auftauchen. Schon jetzt aber dürfen
wir es als einen hohen Gewinn buchen, daß Anton Graff
nunmehr auch als Landschafter ein hervorragender
Platz eingeräumt werden muß und daß er für die Ent-
wickelung der Dresdner Landschaftskunst der Klengel,
Friedrich, Carus usw. stark in Betracht kommt.
Anton Graff, Blick auf Dresden von Loschwitz aus
414
mit dem Fleischerschen Schenkgut (gegenwärtig Schillergarten)
defm Dr. Emil Peschel, der Griinder des Dresdner
Körner-Museums hat, nach Rachels Zeugnis, weun
immer er konnte, aus ihrem Nachlaß ftir sein Museum
Rekauft und zwar mit gutem Grunde, da ja Elisa von der
Recke mit der Familie Körner eng befreundet war.
Bemerkenswert ist nun in erster Linie, daß auch
die vier Dresdner Gemälde Ansichten aus Dresdens
Emrebung zu den vier verschiedenen Tageszeiten dar-
stellen und daß das eine Bild „Blasewitz mit Fleischers
Schenkgutsgebäude bei Mondschein“ (Nacht) Zug um
Zug dem Partheyschen Bilde „Nacht, Blasewitz bei
Dresden“ entspricht, nur daß die Staffage-Figürchen
verändert sind. Daß Fleischers Schenkgutsgebäude an
der Stelle des heutigen Schillergartens steht, ersieht
man aus seiner Lage an der Elbe und an einer aufge-
mauerten Terrasse, die offenbar sclion damals fiir
Leute, die auf die Fähre warteten sowie ftir „reisende
und promenierende Personen“ einen angenehmen
Aufenthalt mit dem Blick auf die gegenüberliegenden
Loschwitzer Berge bot. Bestätigt wird diese Ansicht
durch eine Zeiclmung Anton Graffs in der Sammlung
F. Arndt in Obermartha bei Dresden, die das Schenkgut
auf der basteiartigen Terrasse zeigt, daztt auch den
krumm emporgewachsenen starken Laubbaum, den
wir auf den beiden Graffschen Landschaften sehen, die
als „Oberhalb Blasewitz“ (Morgen) und „Unterhalb
Blasewitz" (Mittag) bezeichnet sind. Auf dem letztge-
nannten sehen wir übrigens ebenfalls das Schenkgut
und im Vordergrunde rechts einen Künstler mit dem
Zeichenbrett auf dem Schoße. Noch ist zu bemerken,
daß das Bild „Oberhalb Blasewitz“ im Motiv in der
Hauptsache mit dem entsprechenden Partheyschen
Büde übereinstimmt, nur ist der Standpunkt etwas
anders gewählt. Ohne jeden Zusammenhang mit den
Partheyschen Bildern ist das Mondbild, das einen Blick
von Loschwitz über den reichbelaubten Loschwitz-
grund zeigt. (Grund wird im Obersächsischen für Tal
gebiaucht). Über das Verhältnis der beiden Bilderreihen
zu einander läßt sich olme unmittelbaren Vergleich
nebeneinander nichts Bestimmtes sagen. Die Dresdner
Bilder sind größer als die Partheyschen, sind rund
70 cm breit, 55 cm hoch, während die Partheyschen
50 mal 40 cm messen. Warum in dem Berliner Aus-
stellungswerk die letzteren in das Jahr 1805 gesetzt
werden, ist nicht ersichtlich. Ist es richtig, so würden
nach Runges Angabe die Dresdner Bilder ins Jahr 1801
fallen, also die älteren sein. Wolil zu beachten ist aber,
daß Dr. Falkenstein unter den Gemälden im Hause der
Elisa von der Recke auch Ansichten aus dem Plauen-
schen Grunde gesehen hat, daß aber unter den Bildern,
die jetzt das Dresdner Stadtmuseum besitzt, sich keine
Ansichten aus dem Plauenschen Grunde befinden, son-
dern nur solche von Blasewitz und Loschwitz. Fs ist
also wahrscheinlich, daß alle acht Gemälde einst im Be-
sitz der Elisa von der Recke gewesen und erst nach
ihrem Tode auseinander gekommen sind.
Wir geben hier die zwei Dresdner Gemälde wieder,
die nicht mit Partheyschen übereinstimmen. Waser
bezeichnet die beiden Blasewitzer Bilder als meister-
liche Gegenstücke in gleichmäßiger Geschlossenheit,
neben denen die beiden Ansichten aus dem Plauenschen
Grunde kleinlicher und minder einheitlich anmuten mit
mehr Einzelwerk und mehr Einzelheiten auch in der
Form. Er nimmt daher für die minderen Bilder frühere
Entstehung an als ftir die vollkommeneren. Die
Dresdner Bilder sind dagegen gleichmäßig gelungen:
es sind köstliche Stimmungsbilder voll „malerischer
Kraft, Weichheit und Flüssigkeit des Vortrags“, Vor-
läufer der Stimmnngslandschaft, wie sie später die Ro-
mantik pflegte. Jedenfalls zeigen sie Anton Graff als
einen Meister der Naturbeobachtung, als welchen wir
ihn schon immer in seinen Bildnissen bewundert haben.
Nrcht unmöglich ist nacli allem, daß noch mehr Land-
schaften von Graff auftauchen. Schon jetzt aber dürfen
wir es als einen hohen Gewinn buchen, daß Anton Graff
nunmehr auch als Landschafter ein hervorragender
Platz eingeräumt werden muß und daß er für die Ent-
wickelung der Dresdner Landschaftskunst der Klengel,
Friedrich, Carus usw. stark in Betracht kommt.
Anton Graff, Blick auf Dresden von Loschwitz aus
414