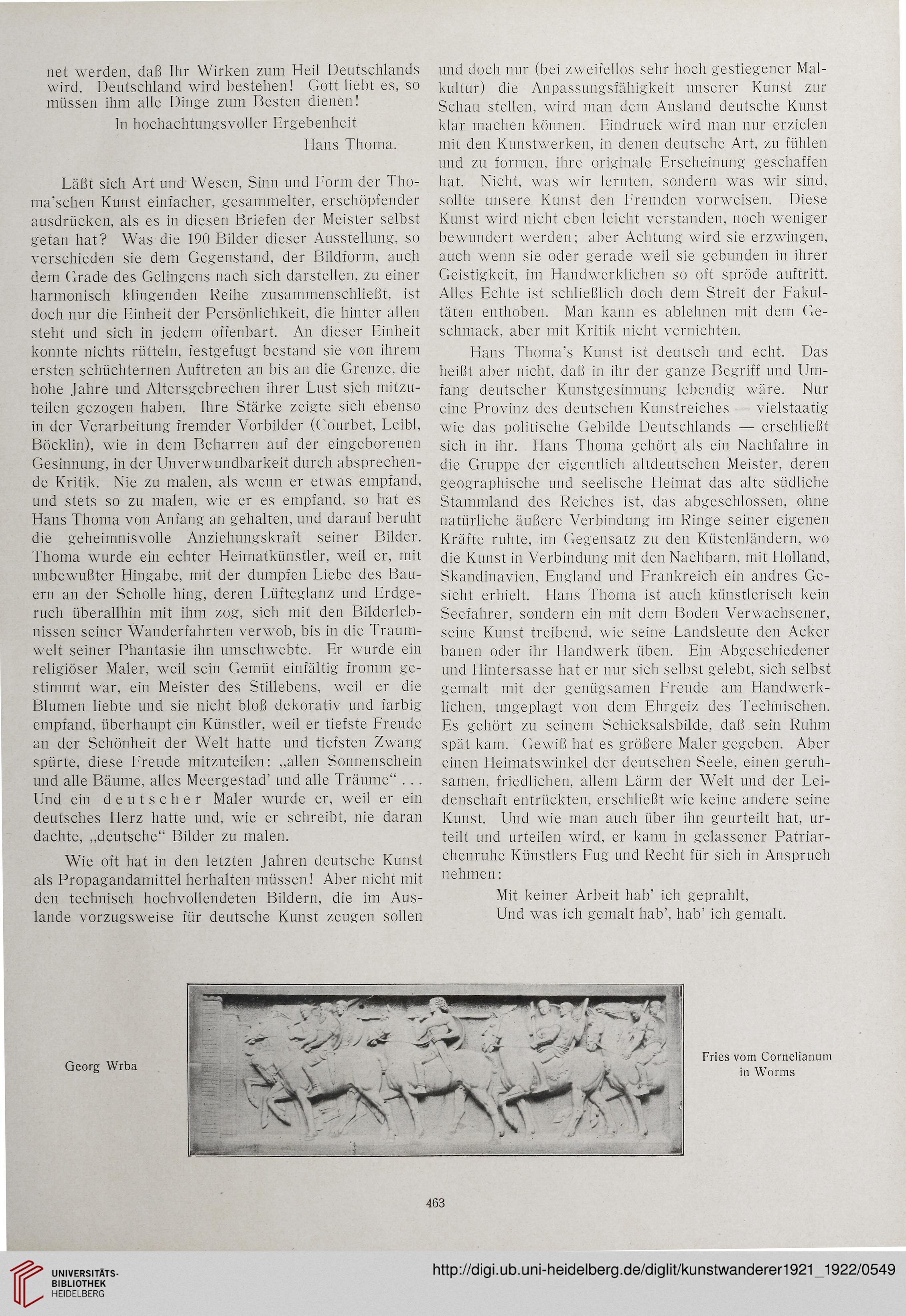net werden, daß Ihr Wirken zum Heil Deutschlands
wird. Deutschland wird bestehen! Gott liebt es, so
müssen ihm alle Dinge zum Besten dienen!
In hochachtungsvoller Ergebenheit
Hans Thoma.
Läßt sich Art und Wesen, Sinn und Form der Tho-
ma’schen Kunst einfacher, gesammelter, erschöpfender
ausdrücken, als es in diesen Briefen der Meister selbst
getan hat? Was die 190 Bilder dieser Ausstellung, so
verschieden sie dem Gegenstand, der Bildform, auch
dem Grade des Gelingens nach sich darstellen, zu einer
harmonisch klingenden Reihe zusammenschließt, ist
doch nur die Einheit der Persönlichkeit, die hinter allen
steht und sich in jedem offenbart. An dieser Einheit
konnte nichts rütteln, festgefugt bestand sie von ihrem
ersten schüchternen Auftreten an bis an die Grenze, die
hohe Jahre und Altersgebrechen ihrer Lust sich mitzu-
teilen gezogen haben. Ihre Stärke zeigte sich ebenso
in der Verarbeitung fremder Vorbilder (Courbet, Leibl,
Böcklin), wie in dem Beharren auf der eingeborenen
Gesinnung, in der Unverwundbarkeit durch absprechen-
de Kritik. Nie zu malen, als wenn er etwas empfand,
und stets so zu malen, wie er es empfand, so hat es
Hans Thoma von Anfang an gehalten, und darauf beruht
die geheimnisvolle Anziehungskraft seiner Bilder.
Thoma wurde ein echter Heimatkünstler, weil er, mit
unbewußter Hingabe, mit der dumpfen Liebe des Bau-
ern an der Scholle hing, deren Lüfteglanz und Erdge-
ruch überallhin mit ihm zog, sicli mit den Bilderleb-
nissen seiner Wanderfahrten verwob, bis in die Traum-
welt seiner Phantasie ihn umschwebte. Er wurde ein
religiöser Maler, weil sein Gemüt einfältig fromm ge-
stimmt war, ein Meister des Stillebens, weil er die
Blumen liebte und sie nicht bloß dekorativ und farbig
empfand, tiberhaupt ein Künstler, weil er tiefste Freude
an der Schönheit der Welt hatte und tiefsten Zwang
spürte, diese Freude mitzuteilen: ,,allen Sonnenschein
und alle Bäume, alles Meergestad’ und alle Träume“ . . .
Und ein d e u t s c h e r Maler wurde er, weil er ein
deutsches Herz hatte und, wie er schreibt, nie daran
dachte, „deutsche“ Bilder zu malen.
Wie oft hat in den letzten Jahren deutsche Kunst
als Propagandamittel herhalten müssen! Aber nicht mit
den technisch hochvollendeten Bildern, die im Aus-
lande vorzugsweise für deutsche Kunst zeugen sollen
und doch nur (bei zweifellos sehr hoch gestiegener Mal-
kultur) die Anpassungsfähigkeit unserer Kunst zur
Schau stellen, wird man dem Ausland deutsche Kunst
klar machen können. Eindruck wird man nur erzielen
mit den Kunstwerken, in denen deutsche Art, zu fühlen
und zu formen, ihre originale Erscheinung geschaffen
hat. Nicht, was wir lernten, sondern was wir sind,
sollte unsere Kunst den Fremden vorweisen. Diese
Kunst wird nicht eben leicht verstanden, noch weniger
bewundert werden; aber Achtung wird sie erzwingen,
auch wenn sie oder gerade weil sie gebunden in ihrer
Geistigkeit, im Handwerklichen so oft spröde auftritt.
Alles Echte ist schließlich doch dem Streit der Fakul-
täten enthoben. Man kann es ablehnen mit dem Ge-
schmack, aber mit Kritik nicht vernichten.
Hans Thoma’s Kunst ist deutsch und echt. Das
heißt aber nicht, daß in ihr der ganze Begriff und Um-
fang deutscher Kunstgesinnung lebendig wäre. Nur
eine Provinz des deutschen Kunstreiches — vielstaatig
wie das politische Gebilde Deutschlands — erschließt
sich in ihr. Hans Thoma gehört als ein Nachfahre in
die Gruppe der eigentlich altdeutschen Meister, deren
geographische und seelische Heimat das alte südliche
Stammland des Reiches ist, das abgeschlossen, ohne
natürliche äußere Verbindung im Ringe seiner eigenen
Kräfte ruhte, im Gegensatz zu den Küstenländern, wo
die Kunst in Verbindung mit den Nachbarn, mit Holland,
Skandinavien, England und Frankreich ein andres Ge-
sicht erhielt. Hans Tlioma ist auch künstlerisch kein
Seefahrer, sondern ein mit dem Boden Verwachsener,
seine Kunst treibend, wie seine Landsleute den Acker
bauen oder ihr Handwerk tiben. Ein Abgeschiedener
und Hintersasse hat er nur sich selbst gelebt, sich selbst
gemalt mit der genügsamen Freude am Handwerk-
lichen, ungeplagt von dem Ehrgeiz des Technischen.
Es gehört zu seinem Schicksalsbilde, daß sein Ruhm
spät kam. Gewiß hat es größere Maler gegeben. Aber
einen Heimatswinkel der deutschen Seele, einen geruh-
samen, friedlichen, allem Lärm der Welt und der Lei-
denschaft entrückten, erschließt wie keine andere seine
Kunst. Und wie man auch über ihn geurteilt hat, ur-
teilt und urteilen wird, er kann in gelassener Patriar-
chenruhe Künstlers Fug und Recht für sich in Anspruch
nehmen:
Mit keiner Arbeit hab’ ich geprahlt,
Und was ich gemalt hab’, hab’ ich gemalt.
463
wird. Deutschland wird bestehen! Gott liebt es, so
müssen ihm alle Dinge zum Besten dienen!
In hochachtungsvoller Ergebenheit
Hans Thoma.
Läßt sich Art und Wesen, Sinn und Form der Tho-
ma’schen Kunst einfacher, gesammelter, erschöpfender
ausdrücken, als es in diesen Briefen der Meister selbst
getan hat? Was die 190 Bilder dieser Ausstellung, so
verschieden sie dem Gegenstand, der Bildform, auch
dem Grade des Gelingens nach sich darstellen, zu einer
harmonisch klingenden Reihe zusammenschließt, ist
doch nur die Einheit der Persönlichkeit, die hinter allen
steht und sich in jedem offenbart. An dieser Einheit
konnte nichts rütteln, festgefugt bestand sie von ihrem
ersten schüchternen Auftreten an bis an die Grenze, die
hohe Jahre und Altersgebrechen ihrer Lust sich mitzu-
teilen gezogen haben. Ihre Stärke zeigte sich ebenso
in der Verarbeitung fremder Vorbilder (Courbet, Leibl,
Böcklin), wie in dem Beharren auf der eingeborenen
Gesinnung, in der Unverwundbarkeit durch absprechen-
de Kritik. Nie zu malen, als wenn er etwas empfand,
und stets so zu malen, wie er es empfand, so hat es
Hans Thoma von Anfang an gehalten, und darauf beruht
die geheimnisvolle Anziehungskraft seiner Bilder.
Thoma wurde ein echter Heimatkünstler, weil er, mit
unbewußter Hingabe, mit der dumpfen Liebe des Bau-
ern an der Scholle hing, deren Lüfteglanz und Erdge-
ruch überallhin mit ihm zog, sicli mit den Bilderleb-
nissen seiner Wanderfahrten verwob, bis in die Traum-
welt seiner Phantasie ihn umschwebte. Er wurde ein
religiöser Maler, weil sein Gemüt einfältig fromm ge-
stimmt war, ein Meister des Stillebens, weil er die
Blumen liebte und sie nicht bloß dekorativ und farbig
empfand, tiberhaupt ein Künstler, weil er tiefste Freude
an der Schönheit der Welt hatte und tiefsten Zwang
spürte, diese Freude mitzuteilen: ,,allen Sonnenschein
und alle Bäume, alles Meergestad’ und alle Träume“ . . .
Und ein d e u t s c h e r Maler wurde er, weil er ein
deutsches Herz hatte und, wie er schreibt, nie daran
dachte, „deutsche“ Bilder zu malen.
Wie oft hat in den letzten Jahren deutsche Kunst
als Propagandamittel herhalten müssen! Aber nicht mit
den technisch hochvollendeten Bildern, die im Aus-
lande vorzugsweise für deutsche Kunst zeugen sollen
und doch nur (bei zweifellos sehr hoch gestiegener Mal-
kultur) die Anpassungsfähigkeit unserer Kunst zur
Schau stellen, wird man dem Ausland deutsche Kunst
klar machen können. Eindruck wird man nur erzielen
mit den Kunstwerken, in denen deutsche Art, zu fühlen
und zu formen, ihre originale Erscheinung geschaffen
hat. Nicht, was wir lernten, sondern was wir sind,
sollte unsere Kunst den Fremden vorweisen. Diese
Kunst wird nicht eben leicht verstanden, noch weniger
bewundert werden; aber Achtung wird sie erzwingen,
auch wenn sie oder gerade weil sie gebunden in ihrer
Geistigkeit, im Handwerklichen so oft spröde auftritt.
Alles Echte ist schließlich doch dem Streit der Fakul-
täten enthoben. Man kann es ablehnen mit dem Ge-
schmack, aber mit Kritik nicht vernichten.
Hans Thoma’s Kunst ist deutsch und echt. Das
heißt aber nicht, daß in ihr der ganze Begriff und Um-
fang deutscher Kunstgesinnung lebendig wäre. Nur
eine Provinz des deutschen Kunstreiches — vielstaatig
wie das politische Gebilde Deutschlands — erschließt
sich in ihr. Hans Thoma gehört als ein Nachfahre in
die Gruppe der eigentlich altdeutschen Meister, deren
geographische und seelische Heimat das alte südliche
Stammland des Reiches ist, das abgeschlossen, ohne
natürliche äußere Verbindung im Ringe seiner eigenen
Kräfte ruhte, im Gegensatz zu den Küstenländern, wo
die Kunst in Verbindung mit den Nachbarn, mit Holland,
Skandinavien, England und Frankreich ein andres Ge-
sicht erhielt. Hans Tlioma ist auch künstlerisch kein
Seefahrer, sondern ein mit dem Boden Verwachsener,
seine Kunst treibend, wie seine Landsleute den Acker
bauen oder ihr Handwerk tiben. Ein Abgeschiedener
und Hintersasse hat er nur sich selbst gelebt, sich selbst
gemalt mit der genügsamen Freude am Handwerk-
lichen, ungeplagt von dem Ehrgeiz des Technischen.
Es gehört zu seinem Schicksalsbilde, daß sein Ruhm
spät kam. Gewiß hat es größere Maler gegeben. Aber
einen Heimatswinkel der deutschen Seele, einen geruh-
samen, friedlichen, allem Lärm der Welt und der Lei-
denschaft entrückten, erschließt wie keine andere seine
Kunst. Und wie man auch über ihn geurteilt hat, ur-
teilt und urteilen wird, er kann in gelassener Patriar-
chenruhe Künstlers Fug und Recht für sich in Anspruch
nehmen:
Mit keiner Arbeit hab’ ich geprahlt,
Und was ich gemalt hab’, hab’ ich gemalt.
463