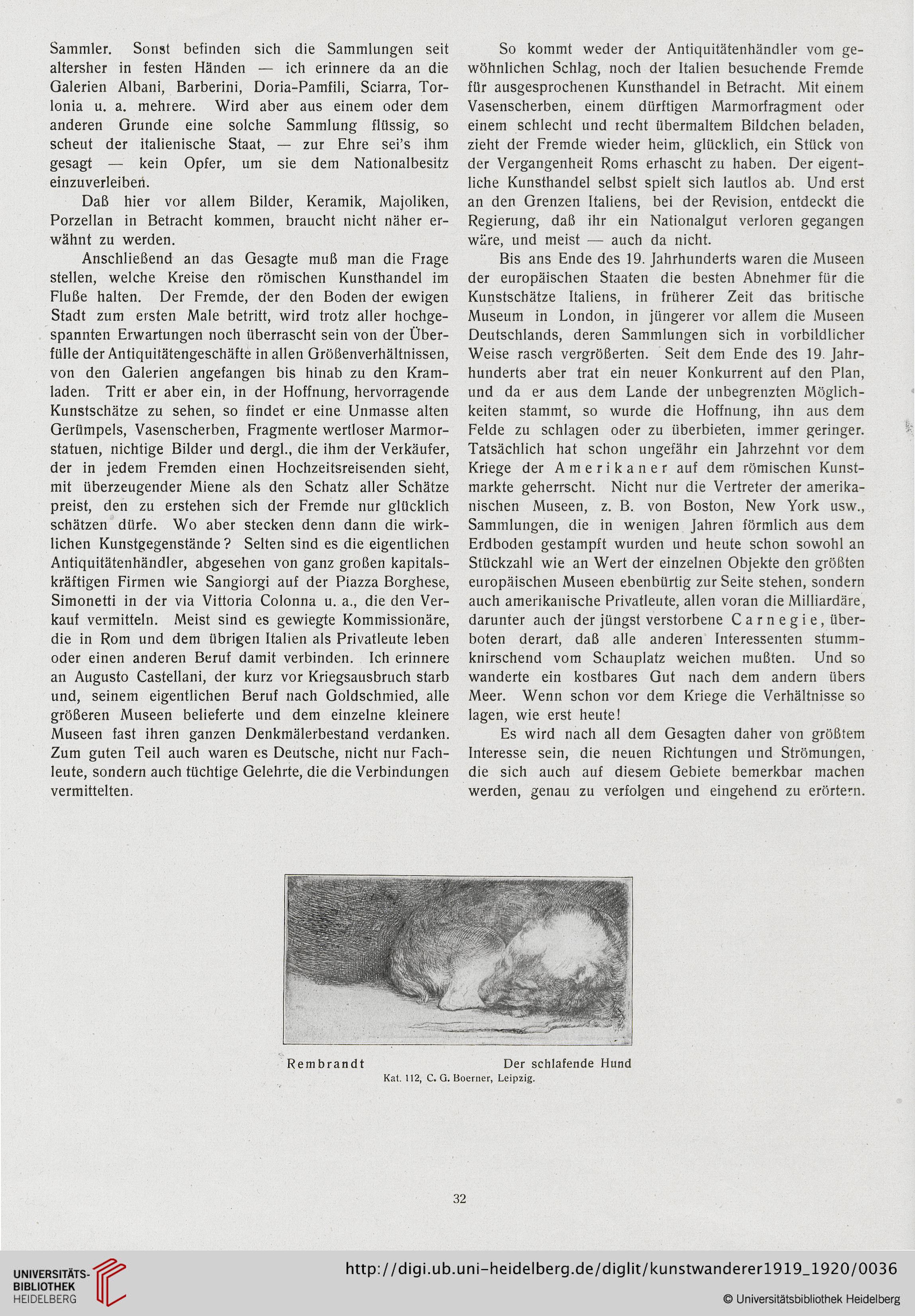Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 1.1919/20
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0036
DOI issue:
2. Septemberheft
DOI article:Hoefner, Friedrich: Der römische Kunsthandel
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0036
Sammler. Sonst befinden sich die Sammlungen seit
altersher in festen Händen — ich erinnere da an die
Galerien Albani, Barberini, Doria-Pamfili, Sciarra, Tor-
lonia u. a. mehrere. Wird aber aus einem oder dem
anderen Grunde eine solche Sammlung flüssig, so
scheut der italienische Staat, — zur Ehre sei’s ihm
gesagt — kein Opfer, um sie dem Nationalbesitz
einzuverleiben.
Daß hier vor allem Bilder, Keramik, Majoliken,
Porzellan in Betracht kommen, braucht nicht näher er-
wähnt zu werden.
Anschließend an das Gesagte muß man die Frage
stellen, welche Kreise den römischen Kunsthandel im
Fluße halten. Der Fremde, der den Boden der ewigen
Stadt zum ersten Male betritt, wird trotz aller hochge-
spannten Erwartungen noch überrascht sein von der Über-
fülle der Antiquitätengeschäfte in allen Größenverhältnissen,
von den Galerien angefangen bis hinab zu den Kram-
laden. Tritt er aber ein, in der Hoffnung, hervorragende
Kunstschätze zu sehen, so findet er eine Unmasse alten
Gerümpels, Vasenscherben, Fragmente wertloser Marmor-
statuen, nichtige Bilder und dergl., die ihm der Verkäufer,
der in jedem Fremden einen Hochzeitsreisenden sieht,
mit überzeugender Miene als den Schatz aller Schätze
preist, den zu erstehen sich der Fremde nur glücklich
schätzen dürfe. Wo aber stecken denn dann die wirk-
lichen Kunstgegenstände? Selten sind es die eigentlichen
Antiquitätenhändler, abgesehen von ganz großen kapitals-
kräftigen Firmen wie Sangiorgi auf der Piazza Borghese,
Simonetti in der via Vittoria Colonna u. a., die den Ver-
kauf vermitteln. Meist sind es gewiegte Kommissionäre,
die in Rom und dem übrigen Italien als Privatleute leben
oder einen anderen Beruf damit verbinden. Ich erinnere
an Augusto Castellani, der kurz vor Kriegsausbruch starb
und, seinem eigentlichen Beruf nach Goldschmied, alle
größeren Museen belieferte und dem einzelne kleinere
Museen fast ihren ganzen Denkmälerbestand verdanken.
Zum guten Teil auch waren es Deutsche, nicht nur Fach-
leute, sondern auch tüchtige Gelehrte, die die Verbindungen
vermittelten.
So kommt weder der Antiquitätenhändler vom ge-
wöhnlichen Schlag, noch der Italien besuchende Fremde
für ausgesprochenen Kunsthandel in Betracht. Mit einem
Vasenscherben, einem dürftigen Marmorfragment oder
einem schlecht und recht übermaltem Bildchen beladen,
zieht der Fremde wieder heim, glücklich, ein Stück von
der Vergangenheit Roms erhascht zu haben. Der eigent-
liche Kunsthandel selbst spielt sich lautlos ab. Und erst
an den Grenzen Italiens, bei der Revision, entdeckt die
Regierung, daß ihr ein Nationalgut verloren gegangen
wäre, und meist — auch da nicht.
Bis ans Ende des 19. Jahrhunderts waren die Museen
der europäischen Staaten die besten Abnehmer für die
Kunstschätze Italiens, in früherer Zeit das britische
Museum in London, in jüngerer vor allem die Museen
Deutschlands, deren Sammlungen sich in vorbildlicher
Weise rasch vergrößerten. Seit dem Ende des 19 Jahr-
hunderts aber trat ein neuer Konkurrent auf den Plan,
und da er aus dem Lande der unbegrenzten Möglich-
keiten stammt, so wurde die Hoffnung, ihn aus dem
Felde zu schlagen oder zu überbieten, immer geringer.
Tatsächlich hat schon ungefähr ein Jahrzehnt vor dem
Kriege der Amerikaner auf dem römischen Kunst-
markte geherrscht. Nicht nur die Vertreter der amerika-
nischen Museen, z. B. von Boston, New York usw.,
Sammlungen, die in wenigen Jahren förmlich aus dem
Erdboden gestampft wurden und heute schon sowohl an
Stückzahl wie an Wert der einzelnen Objekte den größten
europäischen Museen ebenbürtig zur Seite stehen, sondern
auch amerikanische Privatleute, allen voran die Milliardäre,
darunter auch der jüngst verstorbene Carnegie, über-
boten derart, daß alle anderen Interessenten stumm-
knirschend vom Schauplatz weichen mußten. Und so
wanderte ein kostbares Gut nach dem andern übers
Meer. Wenn schon vor dem Kriege die Verhältnisse so
lagen, wie erst heute!
Es wird nach all dem Gesagten daher von größtem
Interesse sein, die neuen Richtungen und Strömungen,
die sich auch auf diesem Gebiete bemerkbar machen
werden, genau zu verfolgen und eingehend zu erörtern.
Rembrandt Der schlafende Hund
Kat. 112, C. G. Boerner, Leipzig.
32
altersher in festen Händen — ich erinnere da an die
Galerien Albani, Barberini, Doria-Pamfili, Sciarra, Tor-
lonia u. a. mehrere. Wird aber aus einem oder dem
anderen Grunde eine solche Sammlung flüssig, so
scheut der italienische Staat, — zur Ehre sei’s ihm
gesagt — kein Opfer, um sie dem Nationalbesitz
einzuverleiben.
Daß hier vor allem Bilder, Keramik, Majoliken,
Porzellan in Betracht kommen, braucht nicht näher er-
wähnt zu werden.
Anschließend an das Gesagte muß man die Frage
stellen, welche Kreise den römischen Kunsthandel im
Fluße halten. Der Fremde, der den Boden der ewigen
Stadt zum ersten Male betritt, wird trotz aller hochge-
spannten Erwartungen noch überrascht sein von der Über-
fülle der Antiquitätengeschäfte in allen Größenverhältnissen,
von den Galerien angefangen bis hinab zu den Kram-
laden. Tritt er aber ein, in der Hoffnung, hervorragende
Kunstschätze zu sehen, so findet er eine Unmasse alten
Gerümpels, Vasenscherben, Fragmente wertloser Marmor-
statuen, nichtige Bilder und dergl., die ihm der Verkäufer,
der in jedem Fremden einen Hochzeitsreisenden sieht,
mit überzeugender Miene als den Schatz aller Schätze
preist, den zu erstehen sich der Fremde nur glücklich
schätzen dürfe. Wo aber stecken denn dann die wirk-
lichen Kunstgegenstände? Selten sind es die eigentlichen
Antiquitätenhändler, abgesehen von ganz großen kapitals-
kräftigen Firmen wie Sangiorgi auf der Piazza Borghese,
Simonetti in der via Vittoria Colonna u. a., die den Ver-
kauf vermitteln. Meist sind es gewiegte Kommissionäre,
die in Rom und dem übrigen Italien als Privatleute leben
oder einen anderen Beruf damit verbinden. Ich erinnere
an Augusto Castellani, der kurz vor Kriegsausbruch starb
und, seinem eigentlichen Beruf nach Goldschmied, alle
größeren Museen belieferte und dem einzelne kleinere
Museen fast ihren ganzen Denkmälerbestand verdanken.
Zum guten Teil auch waren es Deutsche, nicht nur Fach-
leute, sondern auch tüchtige Gelehrte, die die Verbindungen
vermittelten.
So kommt weder der Antiquitätenhändler vom ge-
wöhnlichen Schlag, noch der Italien besuchende Fremde
für ausgesprochenen Kunsthandel in Betracht. Mit einem
Vasenscherben, einem dürftigen Marmorfragment oder
einem schlecht und recht übermaltem Bildchen beladen,
zieht der Fremde wieder heim, glücklich, ein Stück von
der Vergangenheit Roms erhascht zu haben. Der eigent-
liche Kunsthandel selbst spielt sich lautlos ab. Und erst
an den Grenzen Italiens, bei der Revision, entdeckt die
Regierung, daß ihr ein Nationalgut verloren gegangen
wäre, und meist — auch da nicht.
Bis ans Ende des 19. Jahrhunderts waren die Museen
der europäischen Staaten die besten Abnehmer für die
Kunstschätze Italiens, in früherer Zeit das britische
Museum in London, in jüngerer vor allem die Museen
Deutschlands, deren Sammlungen sich in vorbildlicher
Weise rasch vergrößerten. Seit dem Ende des 19 Jahr-
hunderts aber trat ein neuer Konkurrent auf den Plan,
und da er aus dem Lande der unbegrenzten Möglich-
keiten stammt, so wurde die Hoffnung, ihn aus dem
Felde zu schlagen oder zu überbieten, immer geringer.
Tatsächlich hat schon ungefähr ein Jahrzehnt vor dem
Kriege der Amerikaner auf dem römischen Kunst-
markte geherrscht. Nicht nur die Vertreter der amerika-
nischen Museen, z. B. von Boston, New York usw.,
Sammlungen, die in wenigen Jahren förmlich aus dem
Erdboden gestampft wurden und heute schon sowohl an
Stückzahl wie an Wert der einzelnen Objekte den größten
europäischen Museen ebenbürtig zur Seite stehen, sondern
auch amerikanische Privatleute, allen voran die Milliardäre,
darunter auch der jüngst verstorbene Carnegie, über-
boten derart, daß alle anderen Interessenten stumm-
knirschend vom Schauplatz weichen mußten. Und so
wanderte ein kostbares Gut nach dem andern übers
Meer. Wenn schon vor dem Kriege die Verhältnisse so
lagen, wie erst heute!
Es wird nach all dem Gesagten daher von größtem
Interesse sein, die neuen Richtungen und Strömungen,
die sich auch auf diesem Gebiete bemerkbar machen
werden, genau zu verfolgen und eingehend zu erörtern.
Rembrandt Der schlafende Hund
Kat. 112, C. G. Boerner, Leipzig.
32