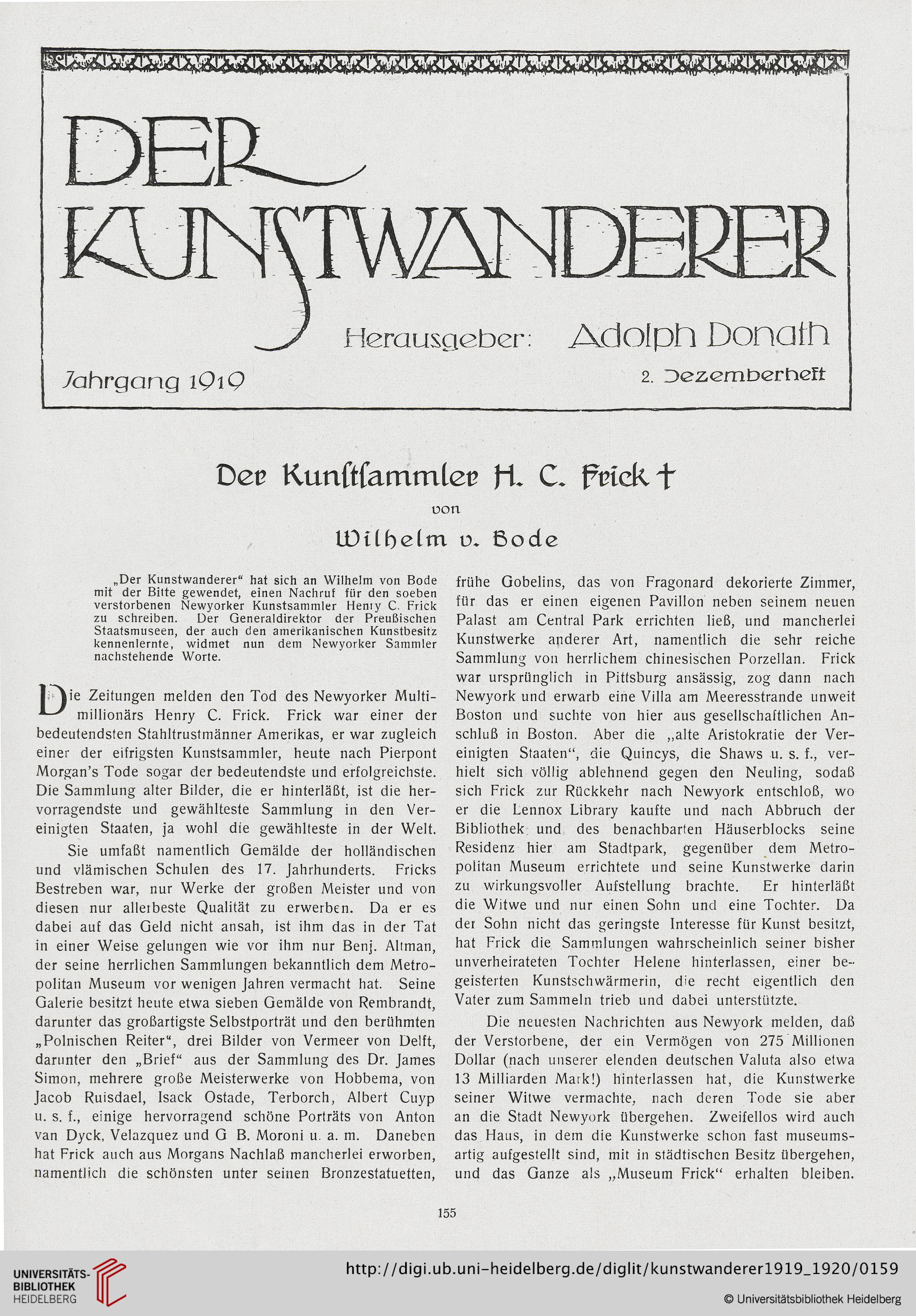/ahrgang iQ\0
Herausgeber: TXdOfptl DOHQfil
2. Dezemberheft
Der Kunftfammler J"L C. ptnck +
oon
LDÜbeltn o. Bode
„Der Kunstwanderer“ hat sich an Wilhelm von Bode
mit der Bitte gewendet, einen Nachruf für den soeben
verstorbenen Newyorker Kunstsammler Henty C. Frick
zu schreiben. Der Generaldirektor der Preußischen
Staatsmuseen, der auch den amerikanischen Kunstbesitz
kennenlernte, widmet nun dem Newyorker Sammler
nachstehende Worte.
I jie Zeitungen melden den Tod des Newyorker Multi-
millionärs Henry C. Frick. Frick war einer der
bedeutendsten Stahltrustmänner Amerikas, er war zugleich
einer der eifrigsten Kunstsammler, heute nach Pierpont
Morgan’s Tode sogar der bedeutendste und erfolgreichste.
Die Sammlung alter Bilder, die er hinterläßt, ist die her-
vorragendste und gewählteste Sammlung in den Ver-
einigten Staaten, ja wohl die gewählteste in der Welt.
Sie umfaßt namentlich Gemälde der holländischen
und vlämischen Schulen des 17. Jahrhunderts. Fricks
Bestreben war, nur Werke der großen Meister und von
diesen nur allerbeste Qualität zu erwerben. Da er es
dabei auf das Geld nicht ansah, ist ihm das in der Tat
in einer Weise gelungen wie vor ihm nur Benj. Altman,
der seine herrlichen Sammlungen bekanntlich dem Metro-
politan Museum vor wenigen Jahren vermacht hat. Seine
Galerie besitzt heute etwa sieben Gemälde von Rembrandt,
darunter das großartigste Selbstporträt und den berühmten
„Polnischen Reiter“, drei Bilder von Vermeer von Delft,
darunter den „Brief“ aus der Sammlung des Dr. James
Simon, mehrere große Meisterwerke von Hobbema, von
Jacob Ruisdael, Isack Ostade, Terborch, Albert Cuyp
u. s. f., einige hervorragend schöne Porträts von Anton
van Dyck, Velazquez und G B. Moroni u a. m. Daneben
hat Frick auch aus Morgans Nachlaß mancherlei erworben,
namentlich die schönsten unter seinen Bronzestatuetten,
frühe Gobelins, das von Fragonard dekorierte Zimmer,
für das er einen eigenen Pavillon neben seinem neuen
Palast am Central Park errichten ließ, und mancherlei
Kunstwerke anderer Art, namentlich die sehr reiche
Sammlung von herrlichem chinesischen Porzellan. Frick
war ursprünglich in Pittsburg ansässig, zog dann nach
Newyork und erwarb eine Villa am Meeresstrande unweit
Boston und suchte von hier aus gesellschaftlichen An-
schluß in Boston. Aber die ,,alte Aristokratie der Ver-
einigten Staaten“, die Quincys, die Shaws u. s. f., ver-
hielt sich völlig ablehnend gegen den Neuling, sodaß
sich Frick zur Rückkehr nach Newyork entschloß, wo
er die Lennox Library kaufte und nach Abbruch der
Bibliothek und des benachbarten Häuserblocks seine
Residenz hier am Stadtpark, gegenüber dem Metro-
politan Museum errichtete und seine Kunstwerke darin
zu wirkungsvoller Aufstellung brachte. Er hinterläßt
die Witwe und nur einen Sohn und eine Tochter. Da
der Sohn nicht das geringste Interesse für Kunst besitzt,
hat Frick die Sammlungen wahrscheinlich seiner bisher
unverheirateten Tochter Helene hinterlassen, einer be-
geisterten Kunstschwärmerin, die recht eigentlich den
Vater zum Sammeln trieb und dabei unterstützte.
Die neuesten Nachrichten aus Newyork melden, daß
der Verstorbene, der ein Vermögen von 275 Millionen
Dollar (nach unserer elenden deutschen Valuta also etwa
13 Milliarden Mark!) hinterlassen hat, die Kunstwerke
seiner Witwe vermachte, nach deren Tode sie aber
an die Stadt Newyork übergehen. Zweifellos wird auch
das Haus, in dem die Kunstwerke schon fast museums-
artig aufgestellt sind, mit in städtischen Besitz übergehen,
und das Ganze als „Museum Frick“ erhalten bleiben.
155
Herausgeber: TXdOfptl DOHQfil
2. Dezemberheft
Der Kunftfammler J"L C. ptnck +
oon
LDÜbeltn o. Bode
„Der Kunstwanderer“ hat sich an Wilhelm von Bode
mit der Bitte gewendet, einen Nachruf für den soeben
verstorbenen Newyorker Kunstsammler Henty C. Frick
zu schreiben. Der Generaldirektor der Preußischen
Staatsmuseen, der auch den amerikanischen Kunstbesitz
kennenlernte, widmet nun dem Newyorker Sammler
nachstehende Worte.
I jie Zeitungen melden den Tod des Newyorker Multi-
millionärs Henry C. Frick. Frick war einer der
bedeutendsten Stahltrustmänner Amerikas, er war zugleich
einer der eifrigsten Kunstsammler, heute nach Pierpont
Morgan’s Tode sogar der bedeutendste und erfolgreichste.
Die Sammlung alter Bilder, die er hinterläßt, ist die her-
vorragendste und gewählteste Sammlung in den Ver-
einigten Staaten, ja wohl die gewählteste in der Welt.
Sie umfaßt namentlich Gemälde der holländischen
und vlämischen Schulen des 17. Jahrhunderts. Fricks
Bestreben war, nur Werke der großen Meister und von
diesen nur allerbeste Qualität zu erwerben. Da er es
dabei auf das Geld nicht ansah, ist ihm das in der Tat
in einer Weise gelungen wie vor ihm nur Benj. Altman,
der seine herrlichen Sammlungen bekanntlich dem Metro-
politan Museum vor wenigen Jahren vermacht hat. Seine
Galerie besitzt heute etwa sieben Gemälde von Rembrandt,
darunter das großartigste Selbstporträt und den berühmten
„Polnischen Reiter“, drei Bilder von Vermeer von Delft,
darunter den „Brief“ aus der Sammlung des Dr. James
Simon, mehrere große Meisterwerke von Hobbema, von
Jacob Ruisdael, Isack Ostade, Terborch, Albert Cuyp
u. s. f., einige hervorragend schöne Porträts von Anton
van Dyck, Velazquez und G B. Moroni u a. m. Daneben
hat Frick auch aus Morgans Nachlaß mancherlei erworben,
namentlich die schönsten unter seinen Bronzestatuetten,
frühe Gobelins, das von Fragonard dekorierte Zimmer,
für das er einen eigenen Pavillon neben seinem neuen
Palast am Central Park errichten ließ, und mancherlei
Kunstwerke anderer Art, namentlich die sehr reiche
Sammlung von herrlichem chinesischen Porzellan. Frick
war ursprünglich in Pittsburg ansässig, zog dann nach
Newyork und erwarb eine Villa am Meeresstrande unweit
Boston und suchte von hier aus gesellschaftlichen An-
schluß in Boston. Aber die ,,alte Aristokratie der Ver-
einigten Staaten“, die Quincys, die Shaws u. s. f., ver-
hielt sich völlig ablehnend gegen den Neuling, sodaß
sich Frick zur Rückkehr nach Newyork entschloß, wo
er die Lennox Library kaufte und nach Abbruch der
Bibliothek und des benachbarten Häuserblocks seine
Residenz hier am Stadtpark, gegenüber dem Metro-
politan Museum errichtete und seine Kunstwerke darin
zu wirkungsvoller Aufstellung brachte. Er hinterläßt
die Witwe und nur einen Sohn und eine Tochter. Da
der Sohn nicht das geringste Interesse für Kunst besitzt,
hat Frick die Sammlungen wahrscheinlich seiner bisher
unverheirateten Tochter Helene hinterlassen, einer be-
geisterten Kunstschwärmerin, die recht eigentlich den
Vater zum Sammeln trieb und dabei unterstützte.
Die neuesten Nachrichten aus Newyork melden, daß
der Verstorbene, der ein Vermögen von 275 Millionen
Dollar (nach unserer elenden deutschen Valuta also etwa
13 Milliarden Mark!) hinterlassen hat, die Kunstwerke
seiner Witwe vermachte, nach deren Tode sie aber
an die Stadt Newyork übergehen. Zweifellos wird auch
das Haus, in dem die Kunstwerke schon fast museums-
artig aufgestellt sind, mit in städtischen Besitz übergehen,
und das Ganze als „Museum Frick“ erhalten bleiben.
155