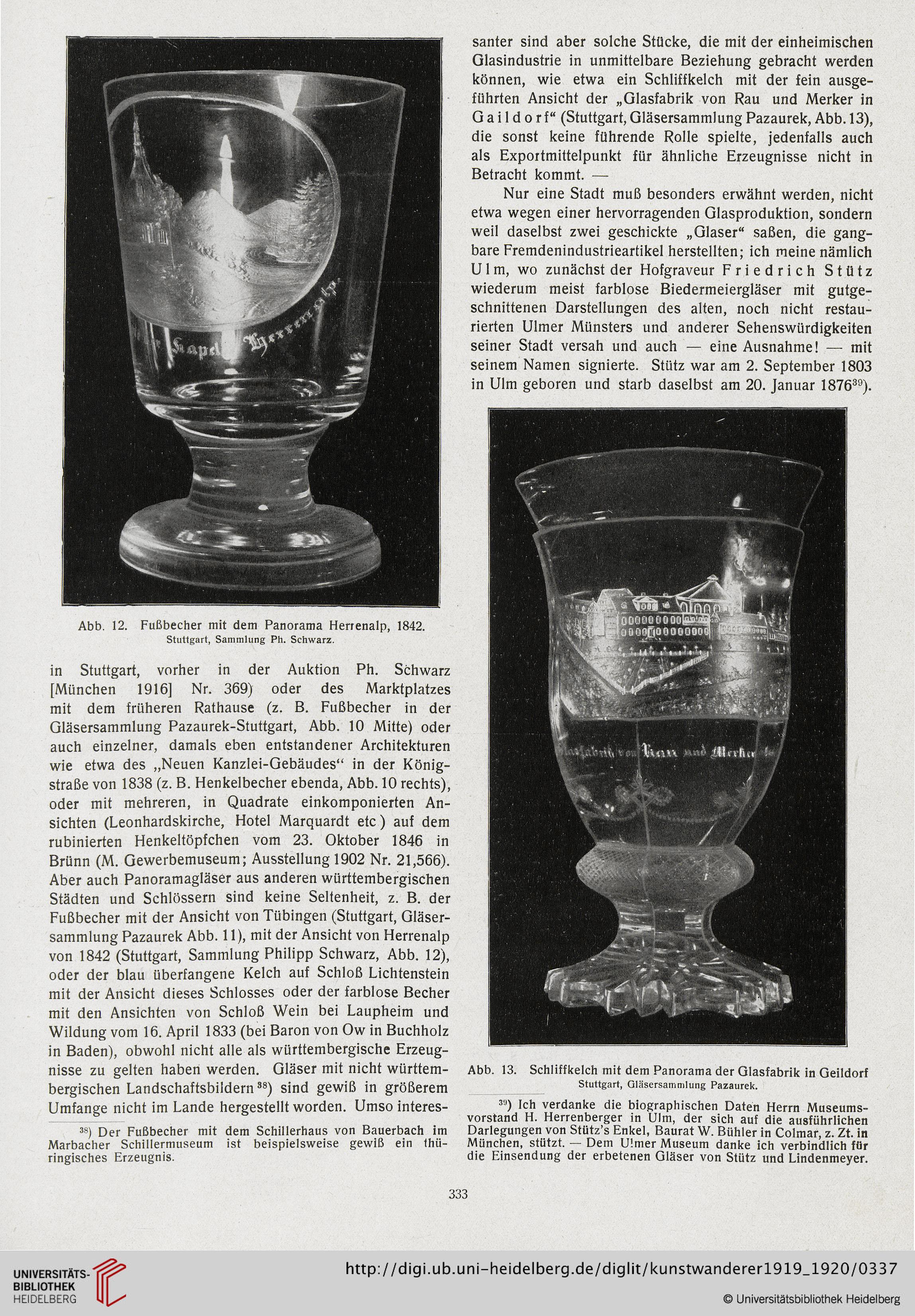Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 1.1919/20
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0337
DOI issue:
1. Maiheft
DOI article:Pazaurek, Gustav Edmund: Württembergische Glas- und Edelsteinschneider, [4]: eine Untersuchung
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0337
santer sind aber solche Stücke, die mit der einheimischen
Glasindustrie in unmittelbare Beziehung gebracht werden
können, wie etwa ein Schliffkelch mit der fein ausge-
führten Ansicht der „Glasfabrik von Rau und Merker in
Gaildorf“ (Stuttgart, Gläsersammlung Pazaurek, Abb. 13),
die sonst keine führende Rolle spielte, jedenfalls auch
als Exportmittelpunkt für ähnliche Erzeugnisse nicht in
Betracht kommt. —
Nur eine Stadt muß besonders erwähnt werden, nicht
etwa wegen einer hervorragenden Glasproduktion, sondern
weil daselbst zwei geschickte „Glaser“ saßen, die gang-
bare Fremdenindustrieartikel herstellten; ich meine nämlich
Ulm, wo zunächst der Hofgraveur Friedrich Stütz
wiederum meist farblose Biedermeiergläser mit gutge-
schnittenen Darstellungen des alten, noch nicht restau-
rierten Ulmer Münsters und anderer Sehenswürdigkeiten
seiner Stadt versah und auch — eine Ausnahme! — mit
seinem Namen signierte. Stütz war am 2. September 1803
in Ulm geboren und starb daselbst am 20. Januar 187639).
Abb. 13. Schliffkelch mit dem Panorama der Glasfabrik in Geildorf
Stuttgart, Gläsersammlung Pazaurek.
3“) Ich verdanke die biographischen Daten Herrn Museums-
vorstand H. Herrenberger in Ulm, der sich auf die ausführlichen
Darlegungen von Stütz’s Enkel, Baurat W. Bühler in Colmar, z. Zt. in
München, stützt. — Dem Ulmer Museum danke ich verbindlich für
die Einsendung der erbetenen Gläser von Stütz und Lindenmeyer.
Abb. 12. Fußbecher mit dem Panorama Herrenalp, 1842.
Stuttgart, Sammlung Ph. Schwarz.
in Stuttgart, vorher in der Auktion Ph. Schwarz
[München 1916] Nr. 369) oder des Marktplatzes
mit dem früheren Rathause (z. B. Fußbecher in der
Gläsersammlung Pazaurek-Stuttgart, Abb. 10 Mitte) oder
auch einzelner, damals eben entstandener Architekturen
wie etwa des „Neuen Kanzlei-Gebäudes“ in der König-
straße von 1838 (z. B. Henkelbecher ebenda, Abb. 10 rechts),
oder mit mehreren, in Quadrate einkomponierten An-
sichten (Leonhardskirche, Hotel Marquardt etc) auf dem
rubinierten Henkeltöpfchen vom 23. Oktober 1846 in
Brünn (M. Gewerbemuseum; Ausstellung 1902 Nr. 21,566).
Aber auch Panoramagläser aus anderen württembergischen
Städten und Schlössern sind keine Seltenheit, z. B. der
Fußbecher mit der Ansicht von Tübingen (Stuttgart, Gläser-
sammlung Pazaurek Abb. 11), mit der Ansicht von Herrenalp
von 1842 (Stuttgart, Sammlung Philipp Schwarz, Abb. 12),
oder der blau überfangene Kelch auf Schloß Lichtenstein
mit der Ansicht dieses Schlosses oder der farblose Becher
mit den Ansichten von Schloß Wein bei Laupheim und
Wildung vom 16. April 1833 (bei Baron von Ow in Buchholz
in Baden), obwohl nicht alle als württembergische Erzeug-
nisse zu gelten haben werden. Gläser mit nicht württem-
bergischen Landschaftsbildem38) sind gewiß in größerem
Umfange nicht im Lande hergestellt worden. Umso interes-
38) Der Fußbecher mit dem Schillerhaus von Bauerbach im
Marbacher Schillermuseum ist beispielsweise gewiß ein thü-
ringisches Erzeugnis.
333
Glasindustrie in unmittelbare Beziehung gebracht werden
können, wie etwa ein Schliffkelch mit der fein ausge-
führten Ansicht der „Glasfabrik von Rau und Merker in
Gaildorf“ (Stuttgart, Gläsersammlung Pazaurek, Abb. 13),
die sonst keine führende Rolle spielte, jedenfalls auch
als Exportmittelpunkt für ähnliche Erzeugnisse nicht in
Betracht kommt. —
Nur eine Stadt muß besonders erwähnt werden, nicht
etwa wegen einer hervorragenden Glasproduktion, sondern
weil daselbst zwei geschickte „Glaser“ saßen, die gang-
bare Fremdenindustrieartikel herstellten; ich meine nämlich
Ulm, wo zunächst der Hofgraveur Friedrich Stütz
wiederum meist farblose Biedermeiergläser mit gutge-
schnittenen Darstellungen des alten, noch nicht restau-
rierten Ulmer Münsters und anderer Sehenswürdigkeiten
seiner Stadt versah und auch — eine Ausnahme! — mit
seinem Namen signierte. Stütz war am 2. September 1803
in Ulm geboren und starb daselbst am 20. Januar 187639).
Abb. 13. Schliffkelch mit dem Panorama der Glasfabrik in Geildorf
Stuttgart, Gläsersammlung Pazaurek.
3“) Ich verdanke die biographischen Daten Herrn Museums-
vorstand H. Herrenberger in Ulm, der sich auf die ausführlichen
Darlegungen von Stütz’s Enkel, Baurat W. Bühler in Colmar, z. Zt. in
München, stützt. — Dem Ulmer Museum danke ich verbindlich für
die Einsendung der erbetenen Gläser von Stütz und Lindenmeyer.
Abb. 12. Fußbecher mit dem Panorama Herrenalp, 1842.
Stuttgart, Sammlung Ph. Schwarz.
in Stuttgart, vorher in der Auktion Ph. Schwarz
[München 1916] Nr. 369) oder des Marktplatzes
mit dem früheren Rathause (z. B. Fußbecher in der
Gläsersammlung Pazaurek-Stuttgart, Abb. 10 Mitte) oder
auch einzelner, damals eben entstandener Architekturen
wie etwa des „Neuen Kanzlei-Gebäudes“ in der König-
straße von 1838 (z. B. Henkelbecher ebenda, Abb. 10 rechts),
oder mit mehreren, in Quadrate einkomponierten An-
sichten (Leonhardskirche, Hotel Marquardt etc) auf dem
rubinierten Henkeltöpfchen vom 23. Oktober 1846 in
Brünn (M. Gewerbemuseum; Ausstellung 1902 Nr. 21,566).
Aber auch Panoramagläser aus anderen württembergischen
Städten und Schlössern sind keine Seltenheit, z. B. der
Fußbecher mit der Ansicht von Tübingen (Stuttgart, Gläser-
sammlung Pazaurek Abb. 11), mit der Ansicht von Herrenalp
von 1842 (Stuttgart, Sammlung Philipp Schwarz, Abb. 12),
oder der blau überfangene Kelch auf Schloß Lichtenstein
mit der Ansicht dieses Schlosses oder der farblose Becher
mit den Ansichten von Schloß Wein bei Laupheim und
Wildung vom 16. April 1833 (bei Baron von Ow in Buchholz
in Baden), obwohl nicht alle als württembergische Erzeug-
nisse zu gelten haben werden. Gläser mit nicht württem-
bergischen Landschaftsbildem38) sind gewiß in größerem
Umfange nicht im Lande hergestellt worden. Umso interes-
38) Der Fußbecher mit dem Schillerhaus von Bauerbach im
Marbacher Schillermuseum ist beispielsweise gewiß ein thü-
ringisches Erzeugnis.
333