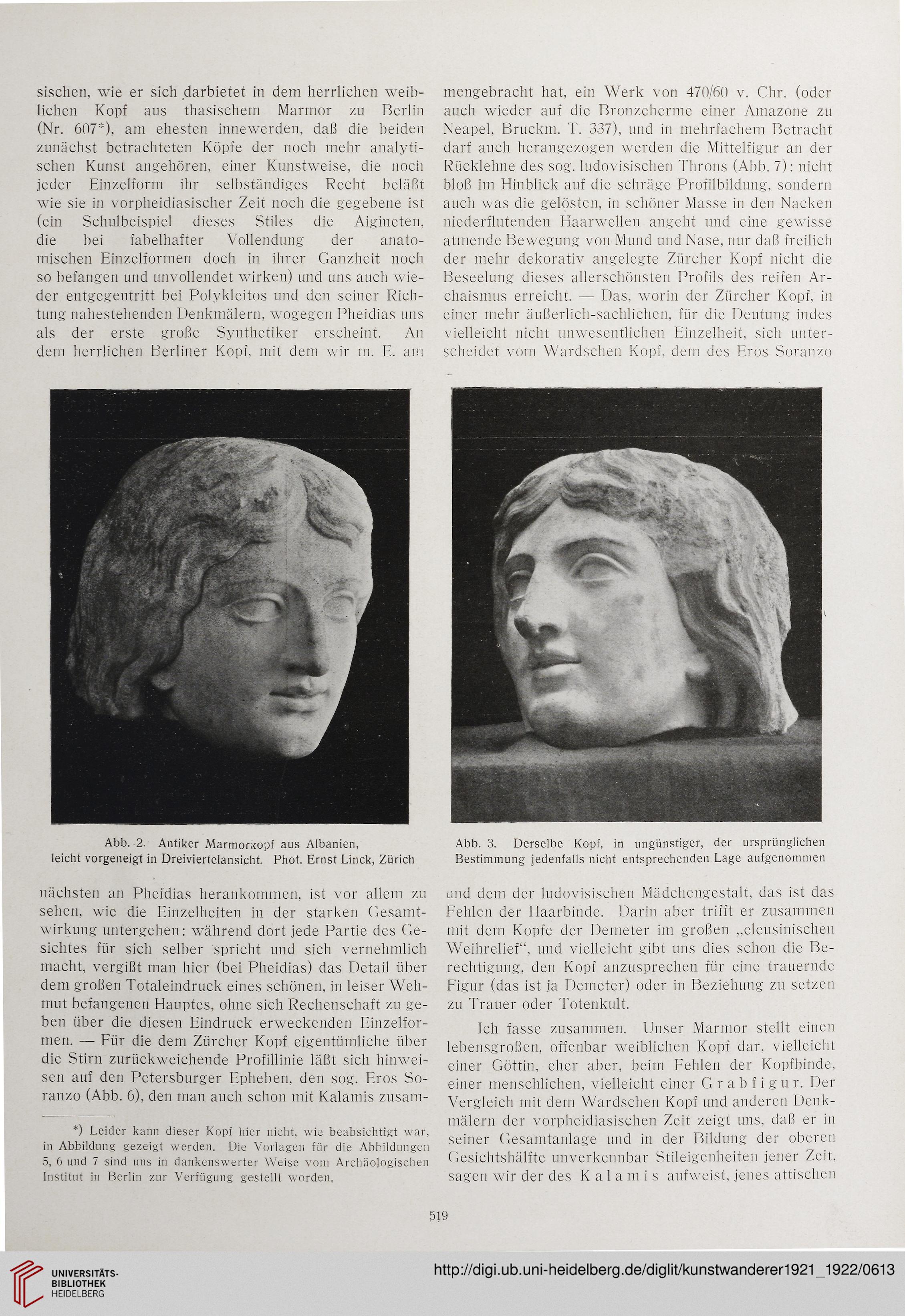Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 3./4.1921/22
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0613
DOI Heft:
1. Augustheft
DOI Artikel:Waser, Otto: Eine Neuerwerbung der Zürchner Archäologischen Sammlung
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0613
sischen. wie er sich darbietet in dem herrlichen weib-
lichen Kopf aus thasischem Marmor zu Berlin
(Nr. 607*), am ehesten innewerden, daß die beiden
zunächst betrachteten Köpfe der noch mehr analyti-
schen Kunst angehören, einer Kunstweise, die noch
jeder Einzelform ihr selbständiges Recht beläßt
wie sie in vorpheidiasischer Zeit noch die gegebene ist
(ein Schulbeispiel dieses Stiles die Aigineten,
die bei fabelhafter Vollendung der anato-
mischen Einzelformen doch in ihrer Ganzheit noch
so befangen und unvollendet wirken) und uns auch wie-
der entgegentritt bei Polykleitos und den seiner Rich-
tung nahestehenden Denkmälern, wogegen Pheidias uns
als der erste große Synthetiker erscheint. An
dem herrlichen Berliner Kopf, mit dem wir m. E. am
Abb. 2. Antiker Marmoncopf aus Albanien,
leicht vorgeneigt in Dreiviertelansicht. Phot. Ernst Linck, Zürich
nächsten an Pheidias herankommen, ist vor allem zu
sehen, wie die Einzelheiten in der starken Gesamt-
wirkung untergehen: während dort jede Partie des Ge-
sichtes für sich selber spricht und sich vernehmlich
macht, vergißt man hier (bei Pheidias) das Detail über
dem großen Totaleindruck eines schönen, in leiser Weh-
mut befangenen Hauptes, ohne sich Rechenschaft zu ge-
ben über die diesen Eindruck erweckenden Einzelfor-
men. — Für die dem Ziircher Kopf eigentiimliche iiber
die Stirn zuriickweichende Profillinie läßt sich hinwei-
sen auf den Petersburger Epheben, den sog. Eros So-
ranzo (Abb. 6), den man auch schon mit Kalamis zusam-
*) Leider kann dieser Kopf liier nicht, wie beabsichtigt war,
in Abbildung gezeigt werden. Die Vorlagen für die Abbildungen
5, 6 und 7 sind uns in dankenswerter Weise vom Archäologischen
Institut in Berlin zur Verfiigung gestellt worden.
mengebracht hat, ein Werk von 470/60 v. Chr. (oder
auch wieder auf die Bronzeherme einer Amazone zu
Neapel, Bruckm. T. 337), und in mehrfachem Betracht
darf auch herangezogen werden die Mittelfigur an der
Rücklehne des sog. ludovisischen Throns (Abb. 7): nicht
bloß im Hinblick auf die schräge Profilbildung, sondern
auch was die gelösten, in schöner Masse in den Nacken
niederflutenden Haarwellen angeht und eine gewisse
atmende Bewegung von Mund und Nase, nur daß freilich
der mehr dekorativ angelegte Zürcher Kopf nicht die
Beseelung dieses allerschönsten Profils des reifen Ar-
chaismus erreicht. — Das, worin der Zürcher Kopf, in
einer mehr äußerlich-sachlichen, für die Deutung indes
vielleicht nicht unwesentlichen Einzelheit, sich unter-
scheidet vom Wardschen Kopf, dem des Eros Soranzo
Abb. 3. Derselbe Kopf, in ungünstiger, der ursprünglichen
Bestimmung jedenfalls nicht entsprechenden Lage aufgenommen
und dem der ludovisischen Mädchengestalt, das ist das
Fehlen der Haarbinde. Darin aber trifft er zusammen
mit dem Kopfe der Derneter im großen „eleusinischen
Weihrelief“, und vielleicht gibt uns dies schon die Be-
rechtigung, den Kopf anzusprechen für eine trauernde
Figur (das ist ja Demeter) oder in Beziehung zu setzen
zu Trauer oder Totenkult.
Ich fasse zusammen. Efnser Marmor stellt einen
lebensgroßen, offenbar weiblichen Kopf dar, vielleicht
einer Göttin, eher aber, beim Fehlen der Kopfbinde,
einer menschlichen, vielleicht einer G r a b f i g u r. Der
Vergleich mit detu Wardschen Kopf und anderen Denk-
tnälern der vorpheidiasischen Zeit zeigt uns, daß er in
seiner Gesamtanlage und in der Bildung der oberen
Gesichtshälfte unverkennbar Stileigenheiten jener Zeit,
sagen wir der des K a 1 a m i s anfweist, jenes attischen
519
lichen Kopf aus thasischem Marmor zu Berlin
(Nr. 607*), am ehesten innewerden, daß die beiden
zunächst betrachteten Köpfe der noch mehr analyti-
schen Kunst angehören, einer Kunstweise, die noch
jeder Einzelform ihr selbständiges Recht beläßt
wie sie in vorpheidiasischer Zeit noch die gegebene ist
(ein Schulbeispiel dieses Stiles die Aigineten,
die bei fabelhafter Vollendung der anato-
mischen Einzelformen doch in ihrer Ganzheit noch
so befangen und unvollendet wirken) und uns auch wie-
der entgegentritt bei Polykleitos und den seiner Rich-
tung nahestehenden Denkmälern, wogegen Pheidias uns
als der erste große Synthetiker erscheint. An
dem herrlichen Berliner Kopf, mit dem wir m. E. am
Abb. 2. Antiker Marmoncopf aus Albanien,
leicht vorgeneigt in Dreiviertelansicht. Phot. Ernst Linck, Zürich
nächsten an Pheidias herankommen, ist vor allem zu
sehen, wie die Einzelheiten in der starken Gesamt-
wirkung untergehen: während dort jede Partie des Ge-
sichtes für sich selber spricht und sich vernehmlich
macht, vergißt man hier (bei Pheidias) das Detail über
dem großen Totaleindruck eines schönen, in leiser Weh-
mut befangenen Hauptes, ohne sich Rechenschaft zu ge-
ben über die diesen Eindruck erweckenden Einzelfor-
men. — Für die dem Ziircher Kopf eigentiimliche iiber
die Stirn zuriickweichende Profillinie läßt sich hinwei-
sen auf den Petersburger Epheben, den sog. Eros So-
ranzo (Abb. 6), den man auch schon mit Kalamis zusam-
*) Leider kann dieser Kopf liier nicht, wie beabsichtigt war,
in Abbildung gezeigt werden. Die Vorlagen für die Abbildungen
5, 6 und 7 sind uns in dankenswerter Weise vom Archäologischen
Institut in Berlin zur Verfiigung gestellt worden.
mengebracht hat, ein Werk von 470/60 v. Chr. (oder
auch wieder auf die Bronzeherme einer Amazone zu
Neapel, Bruckm. T. 337), und in mehrfachem Betracht
darf auch herangezogen werden die Mittelfigur an der
Rücklehne des sog. ludovisischen Throns (Abb. 7): nicht
bloß im Hinblick auf die schräge Profilbildung, sondern
auch was die gelösten, in schöner Masse in den Nacken
niederflutenden Haarwellen angeht und eine gewisse
atmende Bewegung von Mund und Nase, nur daß freilich
der mehr dekorativ angelegte Zürcher Kopf nicht die
Beseelung dieses allerschönsten Profils des reifen Ar-
chaismus erreicht. — Das, worin der Zürcher Kopf, in
einer mehr äußerlich-sachlichen, für die Deutung indes
vielleicht nicht unwesentlichen Einzelheit, sich unter-
scheidet vom Wardschen Kopf, dem des Eros Soranzo
Abb. 3. Derselbe Kopf, in ungünstiger, der ursprünglichen
Bestimmung jedenfalls nicht entsprechenden Lage aufgenommen
und dem der ludovisischen Mädchengestalt, das ist das
Fehlen der Haarbinde. Darin aber trifft er zusammen
mit dem Kopfe der Derneter im großen „eleusinischen
Weihrelief“, und vielleicht gibt uns dies schon die Be-
rechtigung, den Kopf anzusprechen für eine trauernde
Figur (das ist ja Demeter) oder in Beziehung zu setzen
zu Trauer oder Totenkult.
Ich fasse zusammen. Efnser Marmor stellt einen
lebensgroßen, offenbar weiblichen Kopf dar, vielleicht
einer Göttin, eher aber, beim Fehlen der Kopfbinde,
einer menschlichen, vielleicht einer G r a b f i g u r. Der
Vergleich mit detu Wardschen Kopf und anderen Denk-
tnälern der vorpheidiasischen Zeit zeigt uns, daß er in
seiner Gesamtanlage und in der Bildung der oberen
Gesichtshälfte unverkennbar Stileigenheiten jener Zeit,
sagen wir der des K a 1 a m i s anfweist, jenes attischen
519