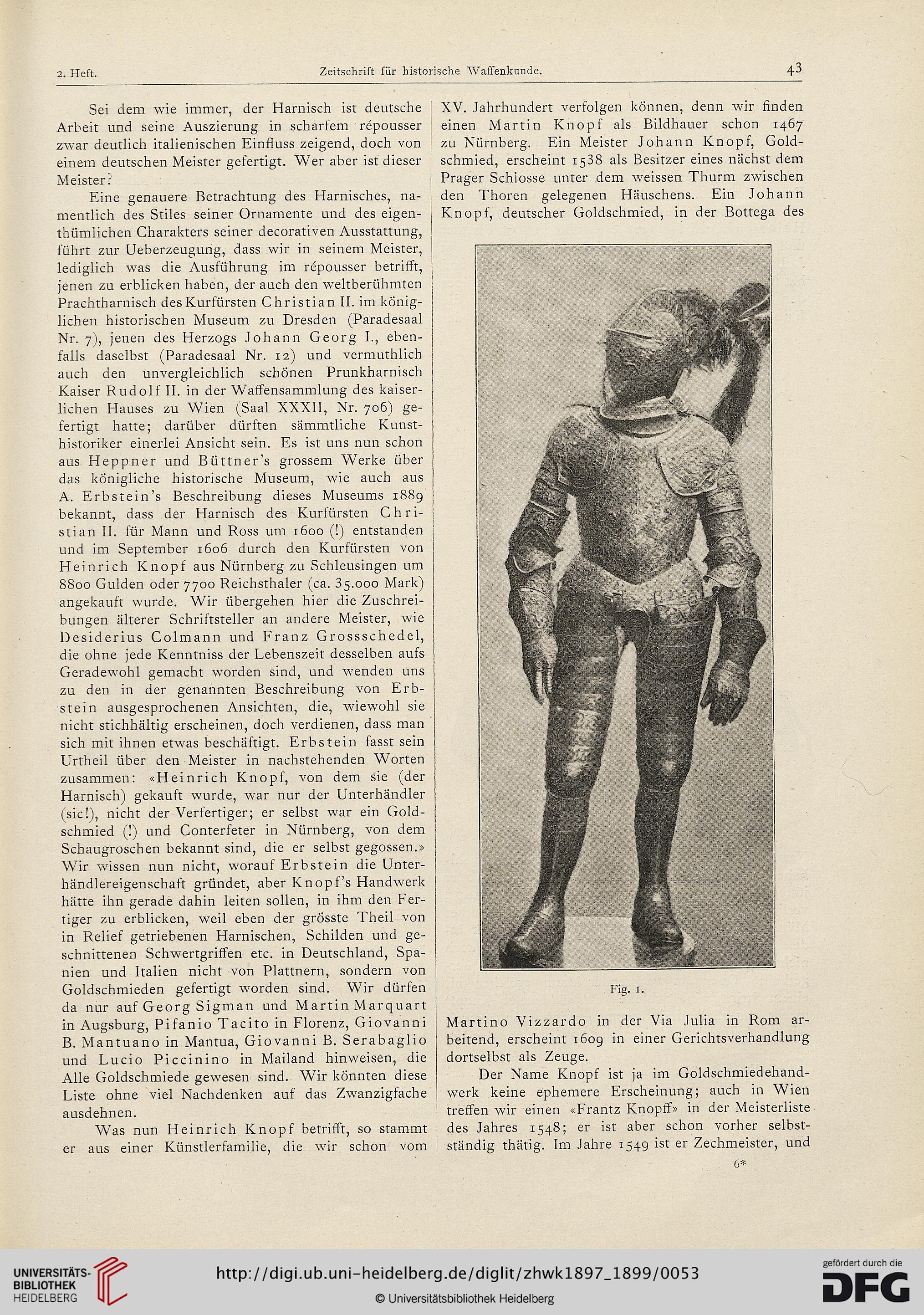2. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
43
Sei dem wie immer, der Harnisch ist deutsche
Arbeit und seine Auszierung in scharfem repousser
zwar deutlich italienischen Einfluss zeigend, doch von
einem deutschen Meister gefertigt. Wer aber ist dieser
Meister?
Eine genauere Betrachtung des Harnisches, na-
mentlich des Stiles seiner Ornamente und des eigen- !
thümlichen Charakters seiner decorativen Ausstattung,
führt zur Ueberzeugung, dass wir in seinem Meister,
lediglich was die Ausführung im repousser betrifft,
jenen zu erblicken haben, der auch den weltberühmten
Prachtharnisch des Kurfürsten Christian II. im könig-
lichen historischen Museum zu Dresden (Paradesaal
Nr. 7), jenen des Herzogs Johann Georg I., eben-
falls daselbst (Paradesaal Nr. 12) und vermuthlich
auch den unvergleichlich schönen Prunkharnisch
Kaiser Rudolf II. in der Waffensammlung des kaiser-
lichen Hauses zu Wien (Saal XXXII, Nr. 706) ge-
fertigt hatte; darüber dürften sämmtliche Kunst-
historiker einerlei Ansicht sein. Es ist uns nun schon
aus Heppner und Büttner’s grossem Werke über
das königliche historische Museum, wie auch aus
A. Erbstein’s Beschreibung dieses Museums 1889
bekannt, dass der Harnisch des Kurfürsten Chri-
stian II. für Mann und Ross um 1600 (!) entstanden
und im September 1606 durch den Kurfürsten von
Heinrich Knopf aus Nürnberg zu Schleusingen um
8S00 Gulden oder 7700 Reichsthaler (ca. 35.000 Mark)
angekauft wurde. Wir übergehen hier die Zuschrei-
bungen älterer Schriftsteller an andere Meister, wie
Desiderius Colmann und Franz Grossschedel,
die ohne jede Kenntniss der Lebenszeit desselben aufs
Geradewohl gemacht worden sind, und wenden uns
zu den in der genannten Beschreibung von Erb-
stein ausgesprochenen Ansichten, die, wiewohl sie
nicht stichhältig erscheinen, doch verdienen, dass man
sich mit ihnen etwas beschäftigt. Erbstein fasst sein
Urtheil über den Meister in nachstehenden Worten
zusammen: «Heinrich Knopf, von dem sie (der
Harnisch) gekauft wurde, war nur der Unterhändler
(sic!), nicht der Verfertiger; er selbst war ein Gold-
schmied (!) und Conterfeter in Nürnberg, von dem
Schaugroschen bekannt sind, die er selbst gegossen.»
Wir wissen nun nicht, worauf Erbstein die Unter-
händlereigenschaft gründet, aber Knopf’s Handwerk
hätte ihn gerade dahin leiten sollen, in ihm den Fer-
tiger zu erblicken, weil eben der grösste Theil von
in Relief getriebenen Harnischen, Schilden und ge-
schnittenen Schwertgriffen etc. in Deutschland, Spa-
nien und Italien nicht von Plattnern, sondern von
Goldschmieden gefertigt worden sind. Wir dürfen
da nur auf Georg Sigman und M artin M arquart
in Augsburg, Pifanio Tacito in Florenz, Giovanni
B. Mantuano in Mantua, Giovanni B. Serabaglio
und Lucio Piccinino in Mailand hinweisen, die
Alle Goldschmiede gewesen sind. Wir könnten diese
Liste ohne viel Nachdenken auf das Zwanzigfache
ausdehnen.
Was nun Heinrich Knopf betrifft, so stammt
er aus einer Künstlerfamilie, die wir schon vom
XV. Jahrhundert verfolgen können, denn wir finden
einen Martin Knopf als Bildhauer schon 1467
zu Nürnberg. Ein Meister Johann Knopf, Gold-
schmied, erscheint 1538 als Besitzer eines nächst dem
Prager Schlösse unter dem weissen Thurm zwischen
den Thoren gelegenen Häuschens. Ein Johann
Knopf, deutscher Goldschmied, in der Bottega des
Fig. 1.
Martino Vizzardo in der Via Julia in Rom ar-
beitend, erscheint 1609 in einer Gerichtsverhandlung
dortselbst als Zeuge.
Der Name Knopf ist ja im Goldschmiedehand-
werk keine ephemere Erscheinung; auch in Wien
treffen wir einen «Frantz Knopff» in der Meisterliste
des Jahres 1548; er ist aber schon vorher selbst-
ständig thätig. Im Jahre 1549 ist er Zechmeister, und
6*
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
43
Sei dem wie immer, der Harnisch ist deutsche
Arbeit und seine Auszierung in scharfem repousser
zwar deutlich italienischen Einfluss zeigend, doch von
einem deutschen Meister gefertigt. Wer aber ist dieser
Meister?
Eine genauere Betrachtung des Harnisches, na-
mentlich des Stiles seiner Ornamente und des eigen- !
thümlichen Charakters seiner decorativen Ausstattung,
führt zur Ueberzeugung, dass wir in seinem Meister,
lediglich was die Ausführung im repousser betrifft,
jenen zu erblicken haben, der auch den weltberühmten
Prachtharnisch des Kurfürsten Christian II. im könig-
lichen historischen Museum zu Dresden (Paradesaal
Nr. 7), jenen des Herzogs Johann Georg I., eben-
falls daselbst (Paradesaal Nr. 12) und vermuthlich
auch den unvergleichlich schönen Prunkharnisch
Kaiser Rudolf II. in der Waffensammlung des kaiser-
lichen Hauses zu Wien (Saal XXXII, Nr. 706) ge-
fertigt hatte; darüber dürften sämmtliche Kunst-
historiker einerlei Ansicht sein. Es ist uns nun schon
aus Heppner und Büttner’s grossem Werke über
das königliche historische Museum, wie auch aus
A. Erbstein’s Beschreibung dieses Museums 1889
bekannt, dass der Harnisch des Kurfürsten Chri-
stian II. für Mann und Ross um 1600 (!) entstanden
und im September 1606 durch den Kurfürsten von
Heinrich Knopf aus Nürnberg zu Schleusingen um
8S00 Gulden oder 7700 Reichsthaler (ca. 35.000 Mark)
angekauft wurde. Wir übergehen hier die Zuschrei-
bungen älterer Schriftsteller an andere Meister, wie
Desiderius Colmann und Franz Grossschedel,
die ohne jede Kenntniss der Lebenszeit desselben aufs
Geradewohl gemacht worden sind, und wenden uns
zu den in der genannten Beschreibung von Erb-
stein ausgesprochenen Ansichten, die, wiewohl sie
nicht stichhältig erscheinen, doch verdienen, dass man
sich mit ihnen etwas beschäftigt. Erbstein fasst sein
Urtheil über den Meister in nachstehenden Worten
zusammen: «Heinrich Knopf, von dem sie (der
Harnisch) gekauft wurde, war nur der Unterhändler
(sic!), nicht der Verfertiger; er selbst war ein Gold-
schmied (!) und Conterfeter in Nürnberg, von dem
Schaugroschen bekannt sind, die er selbst gegossen.»
Wir wissen nun nicht, worauf Erbstein die Unter-
händlereigenschaft gründet, aber Knopf’s Handwerk
hätte ihn gerade dahin leiten sollen, in ihm den Fer-
tiger zu erblicken, weil eben der grösste Theil von
in Relief getriebenen Harnischen, Schilden und ge-
schnittenen Schwertgriffen etc. in Deutschland, Spa-
nien und Italien nicht von Plattnern, sondern von
Goldschmieden gefertigt worden sind. Wir dürfen
da nur auf Georg Sigman und M artin M arquart
in Augsburg, Pifanio Tacito in Florenz, Giovanni
B. Mantuano in Mantua, Giovanni B. Serabaglio
und Lucio Piccinino in Mailand hinweisen, die
Alle Goldschmiede gewesen sind. Wir könnten diese
Liste ohne viel Nachdenken auf das Zwanzigfache
ausdehnen.
Was nun Heinrich Knopf betrifft, so stammt
er aus einer Künstlerfamilie, die wir schon vom
XV. Jahrhundert verfolgen können, denn wir finden
einen Martin Knopf als Bildhauer schon 1467
zu Nürnberg. Ein Meister Johann Knopf, Gold-
schmied, erscheint 1538 als Besitzer eines nächst dem
Prager Schlösse unter dem weissen Thurm zwischen
den Thoren gelegenen Häuschens. Ein Johann
Knopf, deutscher Goldschmied, in der Bottega des
Fig. 1.
Martino Vizzardo in der Via Julia in Rom ar-
beitend, erscheint 1609 in einer Gerichtsverhandlung
dortselbst als Zeuge.
Der Name Knopf ist ja im Goldschmiedehand-
werk keine ephemere Erscheinung; auch in Wien
treffen wir einen «Frantz Knopff» in der Meisterliste
des Jahres 1548; er ist aber schon vorher selbst-
ständig thätig. Im Jahre 1549 ist er Zechmeister, und
6*