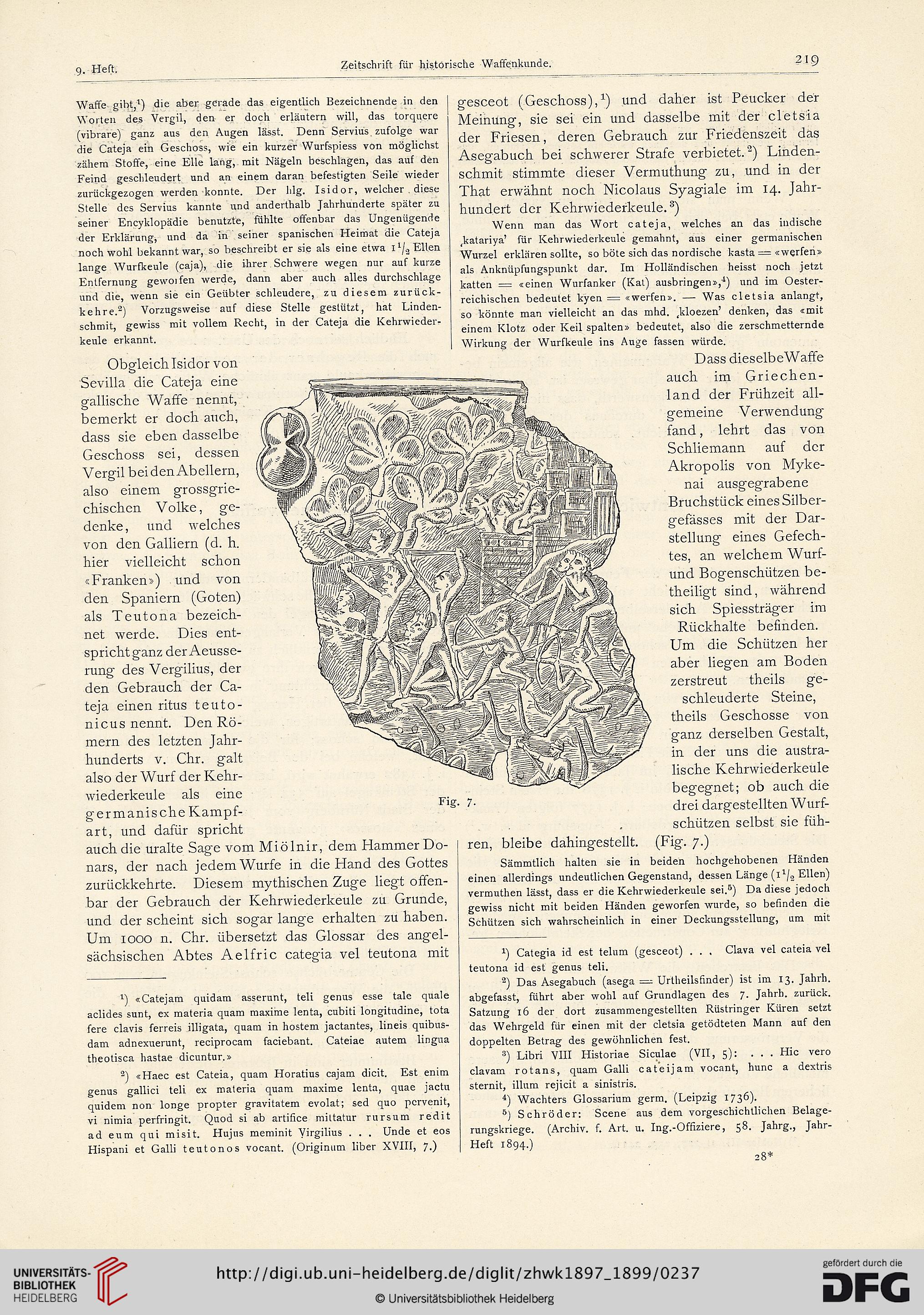9. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
219
Waffe gibt,1) die aber gerade das eigentlich Bezeichnende in den
Worten des Vergil, den er doch erläutern will, das torquere
(vibrare) ganz aus den Augen lässt. Denn Servius zufolge war
die Cateja ein Geschoss, wie ein kurzer Wurfspiess von möglichst
zähem Stoffe, eine Elle lang,, mit Nägeln beschlagen, das auf den
Feind geschleudert und an einem daran befestigten Seile wieder
zurückgezogen werden konnte. Der hlg. Isidor, welcher . diese
Stelle des Servius kannte und anderthalb Jahrhunderte später zu
seiner Enzyklopädie benutzte, fühlte offenbar das Ungenügende
der Erklärung, und da in seiner spanischen Heimat die Cateja
noch wohl bekannt war, so beschreibt er sie als eine etwa I1/^ Ellen
lange Wurfkeule (caja), die ihrer. Schwere wegen nur auf kurze
Entfernung gewoifen werde, dann aber auch alles durchschlage
und die, wenn sie ein Geübter schleudere, zu diesem zurück-
kehre.2 3) Vorzugsweise auf diese Stelle gestützt, hat Linden-
schmit, gewiss mit vollem Recht, in der Cateja die Kehrwieder-
keule erkannt.
Obgleich Isidor von
Sevilla die Cateja eine
gallische Waffe nennt,
bemerkt er doch auch,
dass sie eben dasselbe
Geschoss sei, dessen
Vergil beidenAbellern,
also einem grossgrie-
chischen Volke, ge-
denke , und welches
von den Galliern (d. h.
hier vielleicht schon
«Franken») und von
den Spaniern (Goten)
als Teutona bezeich-
net werde. Dies ent-
spricht ganz der Aeusse-
rung des Vergilius, der
den Gebrauch der Ca-
teja einen ritus teuto-
nicus nennt. Den Rö-
mern des letzten Jahr-
hunderts v. Chr. galt
also der Wurf der Kehr-
wiederkeule als eine
germanische Kampf-
art, und dafür spricht
auch die uralte Sage vom Miölnir, dem Hammer Do-
nars, der nach jedem Wurfe in die Hand des Gottes
zurückkehrte. Diesem mythischen Zuge liegt offen-
bar der Gebrauch der Kehrwiederkeule zu Grunde,
und der scheint sich sogar lange erhalten zu haben.
Um 1000 n. Chr. übersetzt das Glossar des angel-
sächsischen Abtes Aelfric categia vel teutona mit
1) «Catejam quidam asserunt, teli genus esse tale quäle
aclides sunt, ex materia quam maxime lenta, cubiti longitudine, tota
fere clavis ferreis jlligata, quam in hostem jactantes, lineis quibus-
dam adnexuerunt, reciprocam faciebant. Cateiae autem lingua
theotisca liastae dicuntur.»
2) «Haec est Cateia, quam Horatius cajam dicit. Est enim
genus gallici teli ex materia quam maxime lenta, quae jactu
quidem non longe propter gravitatem evolat; sed quo pervenit,
vi nimia perfringit. Quod si ab artifice miltatur rursum redit
ad eum qui misit. Hujus meminit Virgilius . . . Unde et eos
Hispani et Galli teutonos vocant. (Originum über XVIIf, 7*)
gesceot (Geschoss),1) und daher ist Peucker der
Meinung, sie sei ein und dasselbe mit der cletsia
der Friesen, deren Gebrauch zur Friedenszeit das
Asegabuch bei schwerer Strafe verbietet.2) Linden-
schmit stimmte dieser Vermuthung zu, und in der
That erwähnt noch Nicolaus Syagiale im 14. Jahr-
hundert der Kehrwiederkeule.8)
Wenn man das Wort cateja, welches an das indische
,katariya’ für Kehrwiederkeule gemahnt, aus einer germanischen
Wurzel erklären sollte, so böte sich das nordische kasta === «warfen»
als Anknüpfungspunkt dar. Im Holländischen heisst noch jetzt
katten == «einen Wurfanker (Kat) ausbringen»,4) und im Oester-
reichischen bedeutet kyen = «werfen». — Was cletsia anlangt,
so könnte man vielleicht an das mhd. Jdoezen’ denken, das «mit
einem Klotz oder Keil spalten» bedeutet, also die zerschmetternde
Wirkung der Wurfkeule ins Auge fassen würde.
Dass dieselbe Waffe
auch im Griechen-
land der Frühzeit all-
gemeine Verwendung
fand, lehrt das von
Schliemann auf der
Akropolis von Myke-
nai ausgegrabene
Bruchstück eines Silber-
gefässes mit der Dar-
stellung eines Gefech-
tes, an welchem Wurf-
und Bogenschützen be-
theiligt sind, während
sich Spiessträger im
Rückhalte befinden.
Um die Schützen her
aber liegen am Boden
zerstreut theils ge-
schleuderte Steine,
theils Geschosse von
ganz derselben Gestalt,
in der uns die austra-
lische Kehrwiederkeule
begegnet; ob auch die
drei dargestellten Wurf-
schützen seihst sie füh-
ren, bleibe dahingestellt. (Fig. 7.)
Sämmtlich halten sie in beiden hochgehobenen Händen
einen allerdings undeutlichen Gegenstand, dessen Länge (i1/2 Ellen)
vermuthen lässt, dass er die Kehrwiederkeule sei.5) Da diese jedoch
gewiss nicht mit beiden Händen geworfen wurde, so befinden die
Schützen sich wahrscheinlich in einer Deckungsstellung, um mit
*) Categia id est telum (gesceot) . . , Clava vel cateia vel
teutona id est genus teli.
2) Das Asegabuch (asega = Urtheilsfinder) ist im 13. Jahrh.
abgefasst, führt aber wohl auf Grundlagen des 7. Jahrh. zurück.
Satzung 16 der dort zusammengestellten Rüstringer Küren setzt
das Wehrgeld für einen mit der cletsia getödteten Mann auf den
doppelten Betrag des gewöhnlichen fest.
3) Libri VIII Historiae Siculae (VII, 5): ... Hic vero
clavam rotans, quam Galli cateijam vocant, hunc a dextris
sternit, illum rejicit a sinistris.
4) Wächters Glossarium germ. (Leipzig 1736).
5) Schröder: Scene aus dem vorgeschichtlichen Belage-
rungskriege. (Archiv, f. Art. u. Ing.-Offiziere, 58. Jahrg., Jahr-
Heft 1894.)
Fig. 7.
28*
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
219
Waffe gibt,1) die aber gerade das eigentlich Bezeichnende in den
Worten des Vergil, den er doch erläutern will, das torquere
(vibrare) ganz aus den Augen lässt. Denn Servius zufolge war
die Cateja ein Geschoss, wie ein kurzer Wurfspiess von möglichst
zähem Stoffe, eine Elle lang,, mit Nägeln beschlagen, das auf den
Feind geschleudert und an einem daran befestigten Seile wieder
zurückgezogen werden konnte. Der hlg. Isidor, welcher . diese
Stelle des Servius kannte und anderthalb Jahrhunderte später zu
seiner Enzyklopädie benutzte, fühlte offenbar das Ungenügende
der Erklärung, und da in seiner spanischen Heimat die Cateja
noch wohl bekannt war, so beschreibt er sie als eine etwa I1/^ Ellen
lange Wurfkeule (caja), die ihrer. Schwere wegen nur auf kurze
Entfernung gewoifen werde, dann aber auch alles durchschlage
und die, wenn sie ein Geübter schleudere, zu diesem zurück-
kehre.2 3) Vorzugsweise auf diese Stelle gestützt, hat Linden-
schmit, gewiss mit vollem Recht, in der Cateja die Kehrwieder-
keule erkannt.
Obgleich Isidor von
Sevilla die Cateja eine
gallische Waffe nennt,
bemerkt er doch auch,
dass sie eben dasselbe
Geschoss sei, dessen
Vergil beidenAbellern,
also einem grossgrie-
chischen Volke, ge-
denke , und welches
von den Galliern (d. h.
hier vielleicht schon
«Franken») und von
den Spaniern (Goten)
als Teutona bezeich-
net werde. Dies ent-
spricht ganz der Aeusse-
rung des Vergilius, der
den Gebrauch der Ca-
teja einen ritus teuto-
nicus nennt. Den Rö-
mern des letzten Jahr-
hunderts v. Chr. galt
also der Wurf der Kehr-
wiederkeule als eine
germanische Kampf-
art, und dafür spricht
auch die uralte Sage vom Miölnir, dem Hammer Do-
nars, der nach jedem Wurfe in die Hand des Gottes
zurückkehrte. Diesem mythischen Zuge liegt offen-
bar der Gebrauch der Kehrwiederkeule zu Grunde,
und der scheint sich sogar lange erhalten zu haben.
Um 1000 n. Chr. übersetzt das Glossar des angel-
sächsischen Abtes Aelfric categia vel teutona mit
1) «Catejam quidam asserunt, teli genus esse tale quäle
aclides sunt, ex materia quam maxime lenta, cubiti longitudine, tota
fere clavis ferreis jlligata, quam in hostem jactantes, lineis quibus-
dam adnexuerunt, reciprocam faciebant. Cateiae autem lingua
theotisca liastae dicuntur.»
2) «Haec est Cateia, quam Horatius cajam dicit. Est enim
genus gallici teli ex materia quam maxime lenta, quae jactu
quidem non longe propter gravitatem evolat; sed quo pervenit,
vi nimia perfringit. Quod si ab artifice miltatur rursum redit
ad eum qui misit. Hujus meminit Virgilius . . . Unde et eos
Hispani et Galli teutonos vocant. (Originum über XVIIf, 7*)
gesceot (Geschoss),1) und daher ist Peucker der
Meinung, sie sei ein und dasselbe mit der cletsia
der Friesen, deren Gebrauch zur Friedenszeit das
Asegabuch bei schwerer Strafe verbietet.2) Linden-
schmit stimmte dieser Vermuthung zu, und in der
That erwähnt noch Nicolaus Syagiale im 14. Jahr-
hundert der Kehrwiederkeule.8)
Wenn man das Wort cateja, welches an das indische
,katariya’ für Kehrwiederkeule gemahnt, aus einer germanischen
Wurzel erklären sollte, so böte sich das nordische kasta === «warfen»
als Anknüpfungspunkt dar. Im Holländischen heisst noch jetzt
katten == «einen Wurfanker (Kat) ausbringen»,4) und im Oester-
reichischen bedeutet kyen = «werfen». — Was cletsia anlangt,
so könnte man vielleicht an das mhd. Jdoezen’ denken, das «mit
einem Klotz oder Keil spalten» bedeutet, also die zerschmetternde
Wirkung der Wurfkeule ins Auge fassen würde.
Dass dieselbe Waffe
auch im Griechen-
land der Frühzeit all-
gemeine Verwendung
fand, lehrt das von
Schliemann auf der
Akropolis von Myke-
nai ausgegrabene
Bruchstück eines Silber-
gefässes mit der Dar-
stellung eines Gefech-
tes, an welchem Wurf-
und Bogenschützen be-
theiligt sind, während
sich Spiessträger im
Rückhalte befinden.
Um die Schützen her
aber liegen am Boden
zerstreut theils ge-
schleuderte Steine,
theils Geschosse von
ganz derselben Gestalt,
in der uns die austra-
lische Kehrwiederkeule
begegnet; ob auch die
drei dargestellten Wurf-
schützen seihst sie füh-
ren, bleibe dahingestellt. (Fig. 7.)
Sämmtlich halten sie in beiden hochgehobenen Händen
einen allerdings undeutlichen Gegenstand, dessen Länge (i1/2 Ellen)
vermuthen lässt, dass er die Kehrwiederkeule sei.5) Da diese jedoch
gewiss nicht mit beiden Händen geworfen wurde, so befinden die
Schützen sich wahrscheinlich in einer Deckungsstellung, um mit
*) Categia id est telum (gesceot) . . , Clava vel cateia vel
teutona id est genus teli.
2) Das Asegabuch (asega = Urtheilsfinder) ist im 13. Jahrh.
abgefasst, führt aber wohl auf Grundlagen des 7. Jahrh. zurück.
Satzung 16 der dort zusammengestellten Rüstringer Küren setzt
das Wehrgeld für einen mit der cletsia getödteten Mann auf den
doppelten Betrag des gewöhnlichen fest.
3) Libri VIII Historiae Siculae (VII, 5): ... Hic vero
clavam rotans, quam Galli cateijam vocant, hunc a dextris
sternit, illum rejicit a sinistris.
4) Wächters Glossarium germ. (Leipzig 1736).
5) Schröder: Scene aus dem vorgeschichtlichen Belage-
rungskriege. (Archiv, f. Art. u. Ing.-Offiziere, 58. Jahrg., Jahr-
Heft 1894.)
Fig. 7.
28*