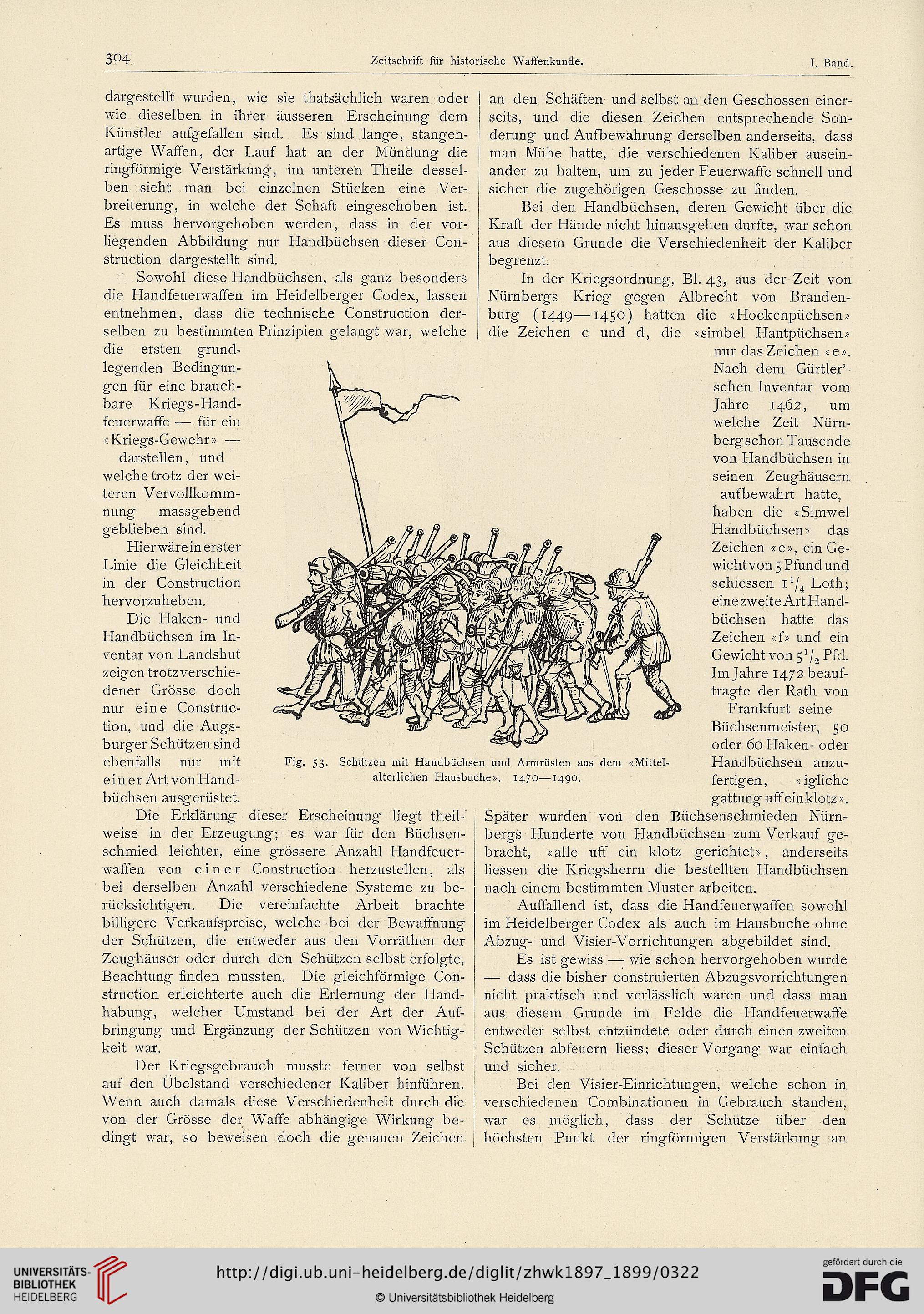3°4
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
I. Band.
dargestellt wurden, wie sie thatsächlich waren oder
wie dieselben in ihrer äusseren Erscheinung dem
Künstler aufgefallen sind. Es sind lange, stangen-
artige Waffen, der Lauf hat an der Mündung die
ringförmige Verstärkung, im unteren Theile dessel-
ben sieht man bei einzelnen Stücken eine Ver-
breiterung, in welche der Schaft eingeschoben ist.
Es muss hervorgehoben werden, dass in der vor-
liegenden Abbildung nur Handbüchsen dieser Con-
struction dargestellt sind.
Sowohl diese Handbüchsen, als ganz besonders
die Handfeuerwaffen im Heidelberger Codex, lassen
entnehmen, dass die technische Construction der-
selben zu bestimmten Prinzipien gelangt war, welche
die ersten grund-
legenden Bedingun-
gen für eine brauch-
bare Kriegs-Hand-
feuerwaffe — für ein
«Kriegs-Gewehr» —
darstellen, und
welche trotz der wei-
teren Vervollkomm-
nung massgebend
geblieben sind.
Hier wäre in erster
Linie die Gleichheit
in der Construction
hervorzuheben.
Die Haken- und
Handbüchsen im In-
ventar von Landshut
zeigen trotz verschie-
dener Grösse doch
nur eine Construc-
tion, und die Augs-
burger Schützen sind
ebenfalls nur mit
einer Art von Hand-
büchsen ausgerüstet.
Die Erklärung dieser Erscheinung liegt theil-
weise in der Erzeugung; es war für den Büchsen-
schmied leichter, eine grössere Anzahl Handfeuer-
waffen von einer Construction herzustellen, als
bei derselben Anzahl verschiedene Systeme zu be-
rücksichtigen. Die vereinfachte Arbeit brachte
billigere Verkaufspreise, welche bei der Bewaffnung
der Schützen, die entweder aus den Vorräthen der
Zeughäuser oder durch den Schützen selbst erfolgte,
Beachtung finden mussten. Die gleichförmige Con-
struction erleichterte auch die Erlernung der Hand-
habung, welcher Umstand bei der Art der Auf-
bringung und Ergänzung der Schützen von Wichtig-
keit war.
Der Kriegsgebrauch musste ferner von selbst
auf den Übelstand verschiedener Kaliber hinführen.
Wenn auch damals diese Verschiedenheit durch die
von der Grösse der Waffe abhängige Wirkung be-
dingt war, so beweisen doch die genauen Zeichen
an den Schäften und selbst an den Geschossen einer-
seits, und die diesen Zeichen entsprechende Son-
derung und Aufbewahrung derselben anderseits, dass
man Mühe hatte, die verschiedenen Kaliber ausein-
ander zu halten, um zu jeder Feuerwaffe schnell und
sicher die zugehörigen Geschosse zu finden.
Bei den Handbüchsen, deren Gewicht über die
Kraft der Hände nicht hinausgehen durfte, war schon
aus diesem Grunde die Verschiedenheit der Kaliber
begrenzt.
In der Kriegsordnung, Bl. 43, aus der Zeit von
Nürnbergs Krieg gegen Albrecht von Branden-
burg (1449—1450) hatten die «Hockenpüchsen»
die Zeichen c und d, die «simbel Hantpiichsen»
nur das Zeichen «e».
Nach dem Gürtler’-
schen Inventar vom
Jahre 1462, um
welche Zeit Nürn-
bergschon Tausende
von Hanclbiichsen in
seinen Zeughäusern
aufbewahrt hatte,
haben die «Simwel
Handbüchsen» das
Zeichen «e», ein Ge-
wicht von 5 Pfund und
schiessen il/4 Loth;
eine zweite Art Pland-
büchsen hatte das
Zeichen «f» und ein
Gewicht von S1/» Pfd.
Im Jahre 1472 beauf-
tragte der Rath von
Frankfurt seine
Büchsenmeister, 50
oder 60 Haken- oder
Handbüchsen anzu-
fertigen , «igliche
gattung uff einklotz».
Später wurden von den Büchsenschmieden Nürn-
bergs Plünderte von Handbüchsen zum Verkauf ge-
bracht, «alle uff ein klotz gerichtet», anderseits
Hessen die Kriegsherrn die bestellten Handbüchsen
nach einem bestimmten Muster arbeiten.
Auffallend ist, dass die Handfeuerwaffen sowohl
im Heidelberger Codex als auch im Hausbuche ohne
Abzug- und Visier-Vorrichtungen abgebildet sind.
Es ist eewiss — wie schon hervorgfehoben wurde
— dass die bisher construierten Abzugsvorrichtungen
nicht praktisch und verlässlich waren und dass man
aus diesem Grunde im Felde die Handfeuerwaffe
entweder selbst entzündete oder durch einen zweiten
Schützen abfeuern Hess; dieser Vorgang war einfach
und sicher.
Bei den Visier-Einrichtungen, welche schon in
verschiedenen Combinationen in Gebrauch standen,
war es möglich, dass der Schütze über den
höchsten Punkt der ringförmigen Verstärkung an
Fig. 53- Schützen mit Handbüchsen und Armrüsten aus dem «Mittel-
alterlichen Hausbuche». 1470—1490.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
I. Band.
dargestellt wurden, wie sie thatsächlich waren oder
wie dieselben in ihrer äusseren Erscheinung dem
Künstler aufgefallen sind. Es sind lange, stangen-
artige Waffen, der Lauf hat an der Mündung die
ringförmige Verstärkung, im unteren Theile dessel-
ben sieht man bei einzelnen Stücken eine Ver-
breiterung, in welche der Schaft eingeschoben ist.
Es muss hervorgehoben werden, dass in der vor-
liegenden Abbildung nur Handbüchsen dieser Con-
struction dargestellt sind.
Sowohl diese Handbüchsen, als ganz besonders
die Handfeuerwaffen im Heidelberger Codex, lassen
entnehmen, dass die technische Construction der-
selben zu bestimmten Prinzipien gelangt war, welche
die ersten grund-
legenden Bedingun-
gen für eine brauch-
bare Kriegs-Hand-
feuerwaffe — für ein
«Kriegs-Gewehr» —
darstellen, und
welche trotz der wei-
teren Vervollkomm-
nung massgebend
geblieben sind.
Hier wäre in erster
Linie die Gleichheit
in der Construction
hervorzuheben.
Die Haken- und
Handbüchsen im In-
ventar von Landshut
zeigen trotz verschie-
dener Grösse doch
nur eine Construc-
tion, und die Augs-
burger Schützen sind
ebenfalls nur mit
einer Art von Hand-
büchsen ausgerüstet.
Die Erklärung dieser Erscheinung liegt theil-
weise in der Erzeugung; es war für den Büchsen-
schmied leichter, eine grössere Anzahl Handfeuer-
waffen von einer Construction herzustellen, als
bei derselben Anzahl verschiedene Systeme zu be-
rücksichtigen. Die vereinfachte Arbeit brachte
billigere Verkaufspreise, welche bei der Bewaffnung
der Schützen, die entweder aus den Vorräthen der
Zeughäuser oder durch den Schützen selbst erfolgte,
Beachtung finden mussten. Die gleichförmige Con-
struction erleichterte auch die Erlernung der Hand-
habung, welcher Umstand bei der Art der Auf-
bringung und Ergänzung der Schützen von Wichtig-
keit war.
Der Kriegsgebrauch musste ferner von selbst
auf den Übelstand verschiedener Kaliber hinführen.
Wenn auch damals diese Verschiedenheit durch die
von der Grösse der Waffe abhängige Wirkung be-
dingt war, so beweisen doch die genauen Zeichen
an den Schäften und selbst an den Geschossen einer-
seits, und die diesen Zeichen entsprechende Son-
derung und Aufbewahrung derselben anderseits, dass
man Mühe hatte, die verschiedenen Kaliber ausein-
ander zu halten, um zu jeder Feuerwaffe schnell und
sicher die zugehörigen Geschosse zu finden.
Bei den Handbüchsen, deren Gewicht über die
Kraft der Hände nicht hinausgehen durfte, war schon
aus diesem Grunde die Verschiedenheit der Kaliber
begrenzt.
In der Kriegsordnung, Bl. 43, aus der Zeit von
Nürnbergs Krieg gegen Albrecht von Branden-
burg (1449—1450) hatten die «Hockenpüchsen»
die Zeichen c und d, die «simbel Hantpiichsen»
nur das Zeichen «e».
Nach dem Gürtler’-
schen Inventar vom
Jahre 1462, um
welche Zeit Nürn-
bergschon Tausende
von Hanclbiichsen in
seinen Zeughäusern
aufbewahrt hatte,
haben die «Simwel
Handbüchsen» das
Zeichen «e», ein Ge-
wicht von 5 Pfund und
schiessen il/4 Loth;
eine zweite Art Pland-
büchsen hatte das
Zeichen «f» und ein
Gewicht von S1/» Pfd.
Im Jahre 1472 beauf-
tragte der Rath von
Frankfurt seine
Büchsenmeister, 50
oder 60 Haken- oder
Handbüchsen anzu-
fertigen , «igliche
gattung uff einklotz».
Später wurden von den Büchsenschmieden Nürn-
bergs Plünderte von Handbüchsen zum Verkauf ge-
bracht, «alle uff ein klotz gerichtet», anderseits
Hessen die Kriegsherrn die bestellten Handbüchsen
nach einem bestimmten Muster arbeiten.
Auffallend ist, dass die Handfeuerwaffen sowohl
im Heidelberger Codex als auch im Hausbuche ohne
Abzug- und Visier-Vorrichtungen abgebildet sind.
Es ist eewiss — wie schon hervorgfehoben wurde
— dass die bisher construierten Abzugsvorrichtungen
nicht praktisch und verlässlich waren und dass man
aus diesem Grunde im Felde die Handfeuerwaffe
entweder selbst entzündete oder durch einen zweiten
Schützen abfeuern Hess; dieser Vorgang war einfach
und sicher.
Bei den Visier-Einrichtungen, welche schon in
verschiedenen Combinationen in Gebrauch standen,
war es möglich, dass der Schütze über den
höchsten Punkt der ringförmigen Verstärkung an
Fig. 53- Schützen mit Handbüchsen und Armrüsten aus dem «Mittel-
alterlichen Hausbuche». 1470—1490.