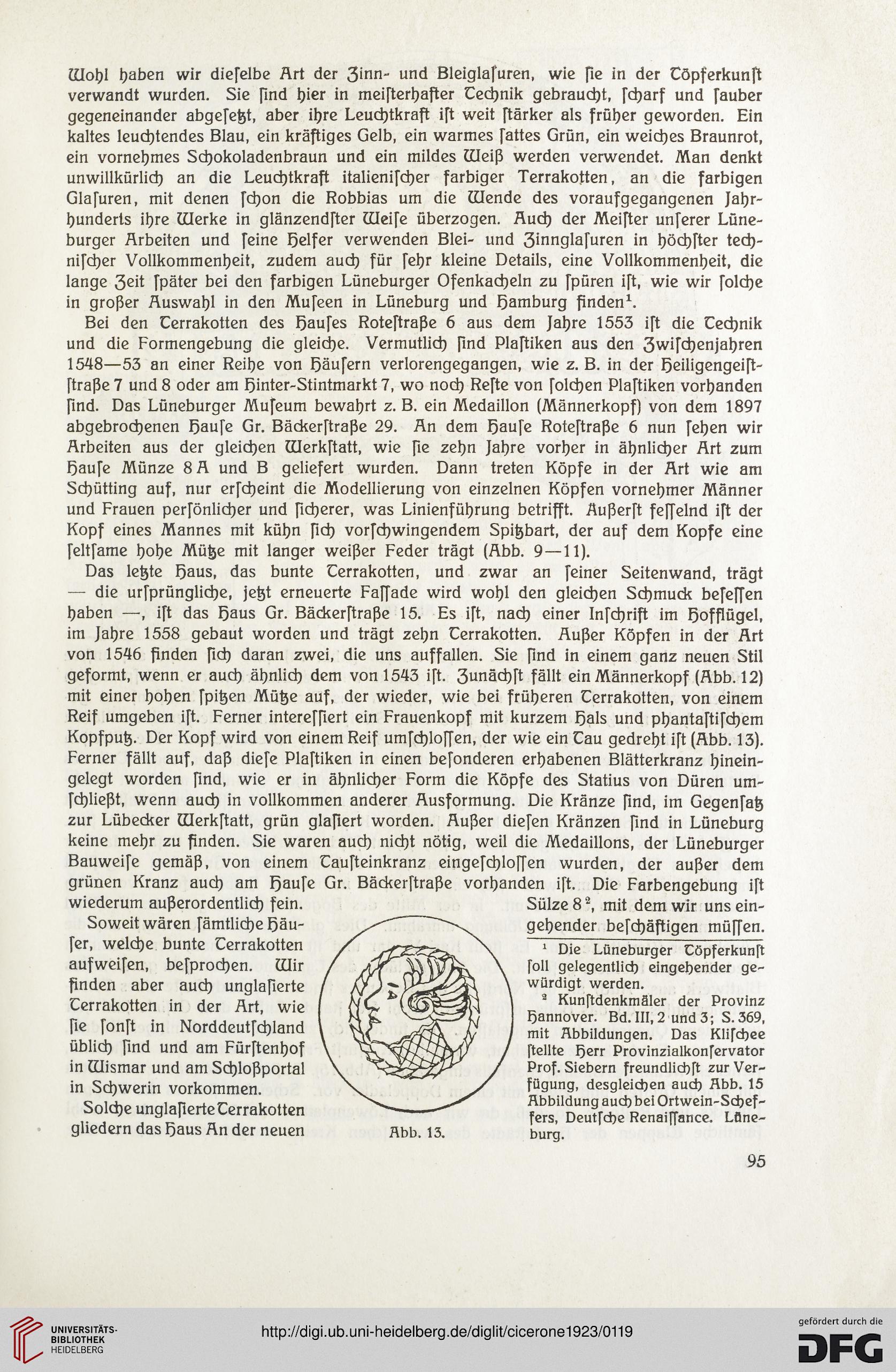Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 15.1923
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.39945#0119
DOI Heft:
Heft 2
DOI Artikel:Schröder, Hans: Lüneburger Terrakotten der Renaissance
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.39945#0119
tüohl traben wir diefelbe Art der 3{nn- und Bleiglafuren, wie fie in der Cöpferkunft
verwandt wurden. Sie find ijier in meifterfyafter Ced)nik gebraucht, fd^arf und [auber
gegeneinander abgefefet, aber ihre Leuchtkraft ift weit ftärker als früher geworden. Ein
kaltes leuchtendes Blau, ein kräftiges Gelb, ein warmes fattes Grün, ein weiches Braunrot,
ein vornehmes Schokoladenbraun und ein mildes öCIeiß werden verwendet. Man denkt
unwillkürlich an die Leuchtkraft italienifcher farbiger Terrakotten, an die farbigen
Glafuren, mit denen fchon die Robbias um die ttlende des voraufgegangenen Jahr-
hunderts ihre Cüerke in glänzendfter SJeife überzogen. Aud) der Meifter unferer Lüne-
burger Arbeiten und feine Fjelfer verwenden Blei- und 3innglafuren in höchfter ted)~
nifcher Vollkommenheit, zudem auch für fehr kleine Details, eine Vollkommenheit, die
lange 3eit fpäter bei den farbigen Lüneburger Ofenkacheln zu fpüren ift, wie wir fold)e
in großer Auswahl in den Mufeen in Lüneburg und Hamburg finden1.
Bei den Cerrakotten des Baufes Roteftraße 6 aus dem Jahre 1553 ift die Cedjnik
und die Formengebung die gleiche. Vermutlich ßnd Plaftiken aus den 3wifd)enjahren
1548—53 an einer Reihe von Käufern verlorengegangen, wie z. B. in der FJeiligengeift-
ftraße 7 und 8 oder am Fjinter-Stintmarkt 7, wo noch Refte von folchen Plaftiken vorhanden
find. Das Lüneburger Mufeum bewahrt z. B. ein Medaillon (Männerkopf) von dem 1897
abgebrochenen ßaufe Gr. Bäckerftraße 29. An dem Baufe Roteftraße 6 nun fehen wir
Arbeiten aus der gleichen GUerkftatt, wie ße zehn Jahre vorher in ähnlicher Art zum
Baufe Münze 8 A und B geliefert wurden. Dann treten Köpfe in der Art wie am
Schütting auf, nur erfcheint die Modellierung von einzelnen Köpfen vornehmer Männer
und Frauen perfönlicher und pcherer, was Linienführung betrifft. Außerft feffelnd ift der
Kopf eines Mannes mit kühn fid) vorfchwingendem Spitjbart, der auf dem Kopfe eine
feltfame hohe Müfee mit langer weißer Feder trägt (Abb. 9—11).
Das letzte Baus, das bunte Cerrakotten, und zwar an feiner Seitenwand, trägt
— die urfprüngliche, jetjt erneuerte Faffade wird woßl den gleichen Schmuck befeffen
haben —, ift das Baus Gr. Bäckerftraße 15. Es ift, nach einer Infchrift im Bofflügel,
im Jahre 1558 gebaut worden und trägt zehn Cerrakotten. Außer Köpfen in der Art
von 1546 finden fid) daran zwei, die uns auffallen. Sie ßnd in einem ganz neuen Stil
geformt, wenn er auch ähnlich dem von 1543 ift. 3unäd)ft fällt ein Männerkopf (Abb. 12)
mit einer hohen fpifeen Mütje auf, der wieder, wie bei früheren Cerrakotten, von einem
Reif umgeben ift. Ferner intereffiert ein Frauenkopf mit kurzem Bals und phantaftifchem
Kopfputs. Der Kopf wird von einem Reif umfd)loffen, der wie ein Cau gedreht ift (Abb. 13).
Ferner fällt auf, daß diefe Plaftiken in einen befonderen erhabenen Blätterkranz hinein-
gelegt worden ßnd, wie er in ähnlicher Form die Köpfe des Statius von Düren um-
fd)ließt, wenn auch in vollkommen anderer Ausformung. Die Kränze ßnd, im Gegenfafs
zur Lübecker GQerkftatt, grün glaßert worden. Außer diefen Kränzen ßnd in Lüneburg
keine mehr zu ßnden. Sie waren auch nicht nötig, weil die Medaillons, der Lüneburger
Bauweife gemäß, von einem Caufteinkranz eingefcßloffen wurden, der außer dem
grünen Kranz auch am Baufe Gr. Bäckerftraße vorhanden ift. Die Farbengebung ift
wiederum außerordentlich fein.
Soweit wären fämtliche Bäu-
fer, welche bunte Cerrakotten
aufweifen, befprocßen. £IIir
ßnden aber auch unglaperte
Cerrakotten in der Art, wie
ße fonft in Norddeutfcßland
üblich ßnd und am Fürftenhof
in ülismar und am Schloßportal
in Schwerin Vorkommen.
Solche unglaperte Cerrakotten
gliedern das Baus An der neuen
Abb. 13.
Sülze 82, mit dem wir uns ein-
gehender befchäßigen müffen.
1 Die Lüneburger Cöpferkunft
foll gelegentlich eingebender ge-
würdigt werden.
2 Kunftdenkmäler der Provinz
Bannover. Bd. III, 2 und 3; S. 369,
mit Abbildungen. Das Klifcbee
ftellte Berr Provinzialkonfervator
Prof. Siebern freundlicbft zur Ver-
fügung, desgleichen auch Abb. 15
Abbildung auch bei Ortwein-Schef-
fers, Deutfcbe Renaiffance. Lüne-
burg.
95
verwandt wurden. Sie find ijier in meifterfyafter Ced)nik gebraucht, fd^arf und [auber
gegeneinander abgefefet, aber ihre Leuchtkraft ift weit ftärker als früher geworden. Ein
kaltes leuchtendes Blau, ein kräftiges Gelb, ein warmes fattes Grün, ein weiches Braunrot,
ein vornehmes Schokoladenbraun und ein mildes öCIeiß werden verwendet. Man denkt
unwillkürlich an die Leuchtkraft italienifcher farbiger Terrakotten, an die farbigen
Glafuren, mit denen fchon die Robbias um die ttlende des voraufgegangenen Jahr-
hunderts ihre Cüerke in glänzendfter SJeife überzogen. Aud) der Meifter unferer Lüne-
burger Arbeiten und feine Fjelfer verwenden Blei- und 3innglafuren in höchfter ted)~
nifcher Vollkommenheit, zudem auch für fehr kleine Details, eine Vollkommenheit, die
lange 3eit fpäter bei den farbigen Lüneburger Ofenkacheln zu fpüren ift, wie wir fold)e
in großer Auswahl in den Mufeen in Lüneburg und Hamburg finden1.
Bei den Cerrakotten des Baufes Roteftraße 6 aus dem Jahre 1553 ift die Cedjnik
und die Formengebung die gleiche. Vermutlich ßnd Plaftiken aus den 3wifd)enjahren
1548—53 an einer Reihe von Käufern verlorengegangen, wie z. B. in der FJeiligengeift-
ftraße 7 und 8 oder am Fjinter-Stintmarkt 7, wo noch Refte von folchen Plaftiken vorhanden
find. Das Lüneburger Mufeum bewahrt z. B. ein Medaillon (Männerkopf) von dem 1897
abgebrochenen ßaufe Gr. Bäckerftraße 29. An dem Baufe Roteftraße 6 nun fehen wir
Arbeiten aus der gleichen GUerkftatt, wie ße zehn Jahre vorher in ähnlicher Art zum
Baufe Münze 8 A und B geliefert wurden. Dann treten Köpfe in der Art wie am
Schütting auf, nur erfcheint die Modellierung von einzelnen Köpfen vornehmer Männer
und Frauen perfönlicher und pcherer, was Linienführung betrifft. Außerft feffelnd ift der
Kopf eines Mannes mit kühn fid) vorfchwingendem Spitjbart, der auf dem Kopfe eine
feltfame hohe Müfee mit langer weißer Feder trägt (Abb. 9—11).
Das letzte Baus, das bunte Cerrakotten, und zwar an feiner Seitenwand, trägt
— die urfprüngliche, jetjt erneuerte Faffade wird woßl den gleichen Schmuck befeffen
haben —, ift das Baus Gr. Bäckerftraße 15. Es ift, nach einer Infchrift im Bofflügel,
im Jahre 1558 gebaut worden und trägt zehn Cerrakotten. Außer Köpfen in der Art
von 1546 finden fid) daran zwei, die uns auffallen. Sie ßnd in einem ganz neuen Stil
geformt, wenn er auch ähnlich dem von 1543 ift. 3unäd)ft fällt ein Männerkopf (Abb. 12)
mit einer hohen fpifeen Mütje auf, der wieder, wie bei früheren Cerrakotten, von einem
Reif umgeben ift. Ferner intereffiert ein Frauenkopf mit kurzem Bals und phantaftifchem
Kopfputs. Der Kopf wird von einem Reif umfd)loffen, der wie ein Cau gedreht ift (Abb. 13).
Ferner fällt auf, daß diefe Plaftiken in einen befonderen erhabenen Blätterkranz hinein-
gelegt worden ßnd, wie er in ähnlicher Form die Köpfe des Statius von Düren um-
fd)ließt, wenn auch in vollkommen anderer Ausformung. Die Kränze ßnd, im Gegenfafs
zur Lübecker GQerkftatt, grün glaßert worden. Außer diefen Kränzen ßnd in Lüneburg
keine mehr zu ßnden. Sie waren auch nicht nötig, weil die Medaillons, der Lüneburger
Bauweife gemäß, von einem Caufteinkranz eingefcßloffen wurden, der außer dem
grünen Kranz auch am Baufe Gr. Bäckerftraße vorhanden ift. Die Farbengebung ift
wiederum außerordentlich fein.
Soweit wären fämtliche Bäu-
fer, welche bunte Cerrakotten
aufweifen, befprocßen. £IIir
ßnden aber auch unglaperte
Cerrakotten in der Art, wie
ße fonft in Norddeutfcßland
üblich ßnd und am Fürftenhof
in ülismar und am Schloßportal
in Schwerin Vorkommen.
Solche unglaperte Cerrakotten
gliedern das Baus An der neuen
Abb. 13.
Sülze 82, mit dem wir uns ein-
gehender befchäßigen müffen.
1 Die Lüneburger Cöpferkunft
foll gelegentlich eingebender ge-
würdigt werden.
2 Kunftdenkmäler der Provinz
Bannover. Bd. III, 2 und 3; S. 369,
mit Abbildungen. Das Klifcbee
ftellte Berr Provinzialkonfervator
Prof. Siebern freundlicbft zur Ver-
fügung, desgleichen auch Abb. 15
Abbildung auch bei Ortwein-Schef-
fers, Deutfcbe Renaiffance. Lüne-
burg.
95