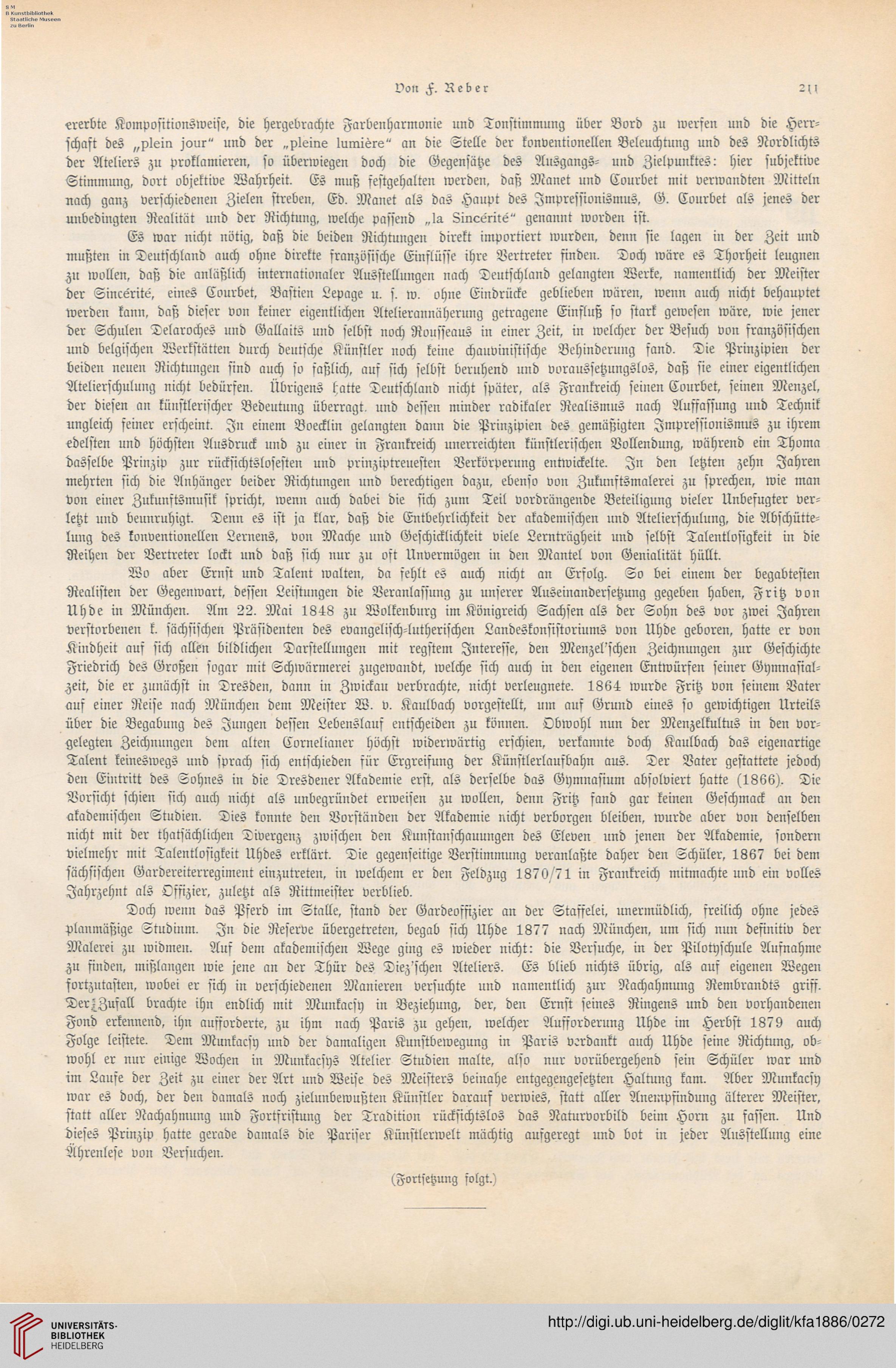von F. Reber
2U
ererbte Kompositionsweise, die hergebrachte Farbenharmonie und Tonstimmung über Bord zu werfen und die Herr-
schaft des „plein sour" und der „pleine luiniers" an die Stelle der konventionellen Beleuchtung und des Nordlichts
der Ateliers zu proklamieren, so nberwiegen doch die Gegensütze des Ausgangs- und Zielpunktes: hier subjektive
Stimmung, dort objektive Wahrheit. Es muß festgehalten werden, daß Manet und Courbet mit verwandten Mitteln
nach ganz verschiedenen Zielen strebeu, Ed. Manet als das Haupt des Jmpressionismus, G. Courbet als jenes der
unbedingten Realität und der Richtung, welche passend „la Linceriie" genannt worden ist.
Es war nicht nötig, daß die beiden Richtungen direkt importiert wurden, denn sie lagen in der Zeit und
mußten in Deutschland auch ohne direkte französische Einslüsse ihre Vertreter finden. Doch wäre es Thorheit leugnen
zn wollen, daß die anläßlich internationaler Ausstellungen nach Deutschland gelangten Werke, namentlich der Meister
der Sincerite, eines Courbet, Bastieu Lepage u. s. w. ohne Eindrücke geblieben würen, wenn auch nicht behauptet
werden kann, daß dieser von keiner eigentlichen Atelierannäherung getragene Einsluß so stark gewesen würe, wie jener
der Schulen Delaroches und Gallaits und selbst noch Rousseaus in einer Zeit, in welcher der Besuch von sranzösischen
nnd belgischen Werkstätten durch deutsche Künstler noch keine chauvinistische Behinderung fand. Die Prinzipien der
beiden neuen Richtungen sind auch so faßlich, auf sich selbst beruhend und vvraussetzungslos, daß sie einer eigentlichen
Atelierschulung nicht bedürfen. Übrigens hatte Deutschland nicht später, als Frankreich seinen Courbet, seinen Menzel,
der diesen an künstlerischer Bedeutnng überragt. und dessen minder radikaler Realismus nach Auffassung und Technik
ungleich feiner erscheint. Jn einem Boecklin gelangten dann die Prinzipien des gemäßigten Jmpressionismus zu ihrem
edelsten und höchsten Ausdruck uud zu einer in Frankreich unerreichten künstlerischen Vollendung, während ein Thoma
dasselbe Prinzip zur rücksichtslosesten und prinziptreuesten Verkörperung entwickelte. Jn den letzten zehn Jahren
mehrten sich die Anhänger beider Richtungen und berechtigen dazu, ebenso von Zukunstsmalerei zu sprechen, wie man
von eiuer Zukunftsmusik spricht, wenn auch dabei die sich zuni Teil vordrängende Beteiligung vieler Unbefugter ver-
letzt und beunruhigt. Denn es ist ja klar, daß die Entbehrlichkeit der akademischen und Atelierschulung, die Abschütte-
lung des konventionellen Lernens, von Mache und Geschicklichkeit viele Lernträgheit und selbst Talentlosigkeit in die
Reihen der Vertreter lockt und daß sich nur zu oft Unvermögen in den Mantel von Genialität hüllt.
Wo aber Ernst und Talent walten, da sehlt es anch nicht an Erfolg. So bei einem der begabtesten
Realisten der Gegenwart, dessen Leistungen die Veranlassung zu unserer Auseinandersetzung gegeben haben, Fritz von
Uhde in München. Am 22. Mai 1848 zu Wolkenburg im Königreich Sachsen als der Sohn des vor zwei Jahren
verstorbenen k. sächsischen Präsidenten des evangelisch-lutherischen Landeskonsistoriums von Uhde geboren, hatte er von
Kindheit aus sich allen bildlichen Darstellungen mit regstem Jnteresse, den Menzel'schen Zeichnungen zur Geschichte
Friedrich des Großen sogar mit Schwärmerei zugewandt, welche sich auch in den eigenen Entwürfen seiner Gymnasial-
zeit, die er zunächst in Dresden, dann in Zwickau verbrachte, nicht verleugnete. 1864 wurde Fritz von seinem Vater
auf einer Reise nach München dem Meister W. v. Kaulbach vorgestellt, um aus Grund eines so gewichtigen Urteils
über die Begabung des Jungen dessen Lebenslauf entscheiden zu können. Obwohl nun der Menzelkultus in den vor-
gelegten Zeichnungen dem alten Cornelianer höchst widerwärtig erschien, verkannte doch Kaulbach das eigenartige
Talent keineswegs und sprach sich entschieden sür Ergreifung der Künstlerlausbahn aus. Der Vater gestattete jedoch
den Eintritt des Sohues in die Dresdener Akademie erst, als derselbe das Gymnasium absolviert hatte (1866). Die
Vorsicht schien sich auch nicht als unbegründet erweisen zu wollen, denn Fritz fand gar keinen Geschmack an den
akademischen Studien. Dies konnte den Vorständen der Akademie nicht verborgen bleiben, wurde aber von densetben
nicht mit der thatsächlichen Tivergeuz zwischen den Kunstanschauungen des Eleven und jenen der Akademie, sondern
vielmehr mit Talentlosigkeit Uhdes erklärt. Die gegenseitige Verstimmung veranlaßte daher den Schüler, 1867 bei dem
sächsischen Gardereiterregiment einzutreten, in welchem er den Feldzug 1870/71 in Frankreich mitmachte und ein volles
Jahrzehnt als Ofsizier, zuletzt als Rittmeister verblieb.
Doch wenn das Pferd im Stalle, stand der Gardeoffizier an der Staffelei, unermüdlich, freilich ohne jedes
planmäßige Studinm. Jn die Reserve übergetreten, begab sich Uhde 1877 nach München, um sich nun definitiv der
Malerei zu widmen. Auf dem akademischen Wege ging es wieder nicht: die Versuche, in der Pilotyschule Ausnahme
zu findeii, mißlangen wie jene an der Thür des Diez'schen Ateliers. Es blieb nichts übrig, als auf eigenen Wegen
sortzutasten, wobei er sich in verschiedenen Manieren versuchte und namentlich zur Nachahmung Rembrandts griff.
Der^Zusall brachte ihn endlich mit Munkacsy in Beziehnng, der, den Ernst seines Ringens und den vorhandenen
Fond erkennend, ihn aufforderte, zu ihm nach Paris zu gehen, welcher Aufforderung Uhde im Herbst 1879 auch
Folge leistete. Dem Munkacsy und der damaligen Kunstbewegung in Paris verdankt auch Uhde seine Richtung, ob-
wohl er nur einige Wochen in Munkacsys Atelier Studien malte, also nur vorübergehend sein Schüler war und
im Laufe der Zeit zu einer der Art und Weise des Meisters beinahe entgegengesetzten Haltung kam. Aber Munkacsy
war es doch, der den damals noch zielunbewnßten Künstler daraus verwies, statt aller Anempsindung älterer Meister,
statt aller Nachahmung und Fortfristung der Tradition rücksichtslos das Naturvorbild beim Horn zu fassen. Und
dieses Prinzip hatte gerade damals die Pariser Künstlerwelt mächtig aufgeregt und bot in jeder Ausstellung eine
Ährenlese von Versuchen.
(Fortsetzung folgt.)
2U
ererbte Kompositionsweise, die hergebrachte Farbenharmonie und Tonstimmung über Bord zu werfen und die Herr-
schaft des „plein sour" und der „pleine luiniers" an die Stelle der konventionellen Beleuchtung und des Nordlichts
der Ateliers zu proklamieren, so nberwiegen doch die Gegensütze des Ausgangs- und Zielpunktes: hier subjektive
Stimmung, dort objektive Wahrheit. Es muß festgehalten werden, daß Manet und Courbet mit verwandten Mitteln
nach ganz verschiedenen Zielen strebeu, Ed. Manet als das Haupt des Jmpressionismus, G. Courbet als jenes der
unbedingten Realität und der Richtung, welche passend „la Linceriie" genannt worden ist.
Es war nicht nötig, daß die beiden Richtungen direkt importiert wurden, denn sie lagen in der Zeit und
mußten in Deutschland auch ohne direkte französische Einslüsse ihre Vertreter finden. Doch wäre es Thorheit leugnen
zn wollen, daß die anläßlich internationaler Ausstellungen nach Deutschland gelangten Werke, namentlich der Meister
der Sincerite, eines Courbet, Bastieu Lepage u. s. w. ohne Eindrücke geblieben würen, wenn auch nicht behauptet
werden kann, daß dieser von keiner eigentlichen Atelierannäherung getragene Einsluß so stark gewesen würe, wie jener
der Schulen Delaroches und Gallaits und selbst noch Rousseaus in einer Zeit, in welcher der Besuch von sranzösischen
nnd belgischen Werkstätten durch deutsche Künstler noch keine chauvinistische Behinderung fand. Die Prinzipien der
beiden neuen Richtungen sind auch so faßlich, auf sich selbst beruhend und vvraussetzungslos, daß sie einer eigentlichen
Atelierschulung nicht bedürfen. Übrigens hatte Deutschland nicht später, als Frankreich seinen Courbet, seinen Menzel,
der diesen an künstlerischer Bedeutnng überragt. und dessen minder radikaler Realismus nach Auffassung und Technik
ungleich feiner erscheint. Jn einem Boecklin gelangten dann die Prinzipien des gemäßigten Jmpressionismus zu ihrem
edelsten und höchsten Ausdruck uud zu einer in Frankreich unerreichten künstlerischen Vollendung, während ein Thoma
dasselbe Prinzip zur rücksichtslosesten und prinziptreuesten Verkörperung entwickelte. Jn den letzten zehn Jahren
mehrten sich die Anhänger beider Richtungen und berechtigen dazu, ebenso von Zukunstsmalerei zu sprechen, wie man
von eiuer Zukunftsmusik spricht, wenn auch dabei die sich zuni Teil vordrängende Beteiligung vieler Unbefugter ver-
letzt und beunruhigt. Denn es ist ja klar, daß die Entbehrlichkeit der akademischen und Atelierschulung, die Abschütte-
lung des konventionellen Lernens, von Mache und Geschicklichkeit viele Lernträgheit und selbst Talentlosigkeit in die
Reihen der Vertreter lockt und daß sich nur zu oft Unvermögen in den Mantel von Genialität hüllt.
Wo aber Ernst und Talent walten, da sehlt es anch nicht an Erfolg. So bei einem der begabtesten
Realisten der Gegenwart, dessen Leistungen die Veranlassung zu unserer Auseinandersetzung gegeben haben, Fritz von
Uhde in München. Am 22. Mai 1848 zu Wolkenburg im Königreich Sachsen als der Sohn des vor zwei Jahren
verstorbenen k. sächsischen Präsidenten des evangelisch-lutherischen Landeskonsistoriums von Uhde geboren, hatte er von
Kindheit aus sich allen bildlichen Darstellungen mit regstem Jnteresse, den Menzel'schen Zeichnungen zur Geschichte
Friedrich des Großen sogar mit Schwärmerei zugewandt, welche sich auch in den eigenen Entwürfen seiner Gymnasial-
zeit, die er zunächst in Dresden, dann in Zwickau verbrachte, nicht verleugnete. 1864 wurde Fritz von seinem Vater
auf einer Reise nach München dem Meister W. v. Kaulbach vorgestellt, um aus Grund eines so gewichtigen Urteils
über die Begabung des Jungen dessen Lebenslauf entscheiden zu können. Obwohl nun der Menzelkultus in den vor-
gelegten Zeichnungen dem alten Cornelianer höchst widerwärtig erschien, verkannte doch Kaulbach das eigenartige
Talent keineswegs und sprach sich entschieden sür Ergreifung der Künstlerlausbahn aus. Der Vater gestattete jedoch
den Eintritt des Sohues in die Dresdener Akademie erst, als derselbe das Gymnasium absolviert hatte (1866). Die
Vorsicht schien sich auch nicht als unbegründet erweisen zu wollen, denn Fritz fand gar keinen Geschmack an den
akademischen Studien. Dies konnte den Vorständen der Akademie nicht verborgen bleiben, wurde aber von densetben
nicht mit der thatsächlichen Tivergeuz zwischen den Kunstanschauungen des Eleven und jenen der Akademie, sondern
vielmehr mit Talentlosigkeit Uhdes erklärt. Die gegenseitige Verstimmung veranlaßte daher den Schüler, 1867 bei dem
sächsischen Gardereiterregiment einzutreten, in welchem er den Feldzug 1870/71 in Frankreich mitmachte und ein volles
Jahrzehnt als Ofsizier, zuletzt als Rittmeister verblieb.
Doch wenn das Pferd im Stalle, stand der Gardeoffizier an der Staffelei, unermüdlich, freilich ohne jedes
planmäßige Studinm. Jn die Reserve übergetreten, begab sich Uhde 1877 nach München, um sich nun definitiv der
Malerei zu widmen. Auf dem akademischen Wege ging es wieder nicht: die Versuche, in der Pilotyschule Ausnahme
zu findeii, mißlangen wie jene an der Thür des Diez'schen Ateliers. Es blieb nichts übrig, als auf eigenen Wegen
sortzutasten, wobei er sich in verschiedenen Manieren versuchte und namentlich zur Nachahmung Rembrandts griff.
Der^Zusall brachte ihn endlich mit Munkacsy in Beziehnng, der, den Ernst seines Ringens und den vorhandenen
Fond erkennend, ihn aufforderte, zu ihm nach Paris zu gehen, welcher Aufforderung Uhde im Herbst 1879 auch
Folge leistete. Dem Munkacsy und der damaligen Kunstbewegung in Paris verdankt auch Uhde seine Richtung, ob-
wohl er nur einige Wochen in Munkacsys Atelier Studien malte, also nur vorübergehend sein Schüler war und
im Laufe der Zeit zu einer der Art und Weise des Meisters beinahe entgegengesetzten Haltung kam. Aber Munkacsy
war es doch, der den damals noch zielunbewnßten Künstler daraus verwies, statt aller Anempsindung älterer Meister,
statt aller Nachahmung und Fortfristung der Tradition rücksichtslos das Naturvorbild beim Horn zu fassen. Und
dieses Prinzip hatte gerade damals die Pariser Künstlerwelt mächtig aufgeregt und bot in jeder Ausstellung eine
Ährenlese von Versuchen.
(Fortsetzung folgt.)