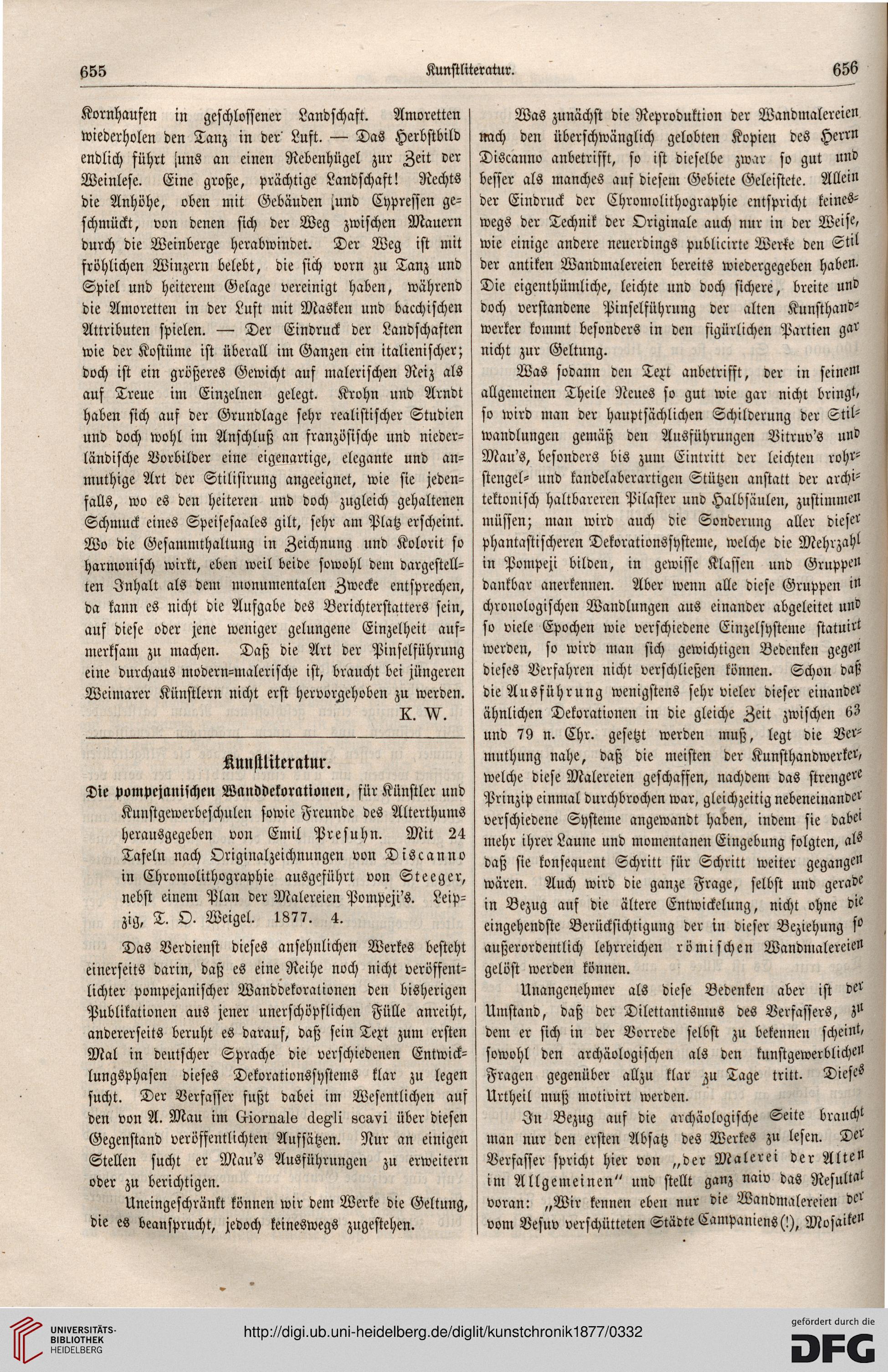655
Kunstliteratur.
656
Kornhaufen in geschlossener Landschaft. Amoretten
wiederholen den Tanz in der Luft. — Das Herbstbild
endlich führt chns an einen Rebenhügel zur Zeit ver
Weinlese. Eine große, prächtige Landschaft! Rechts
die Anhöhe, oben mit Gebäuden iund Cypressen ge-
schmückt, von denen sich der Weg zwischen Mauern
durch die Weinberge herabwindet. Der Weg ist mit
fröhlichen Winzern belebt, die sich vorn zu Tanz und
Spiel und heitcrem Gelage vereinigt haben, während
die Amoretten in der Luft mit Masken und bacchischen
Attributen spielen. — Der Eindruck der Landschaften
wie der Kostüme ist überall im Ganzen ein italienischer;
doch ist ein größeres Gewicht auf malerischen Reiz als
auf Treue im Einzelnen gelegt. Krohn und Arndt
haben sich auf der Grundlage sehr realistischer Studien
und doch wohl im Anschluß an französische und nieder-
ländische Borbilder eine eigenartige, elegante und an-
muthige Art der Stilisirnng angeeignet, wie sie jeden-
falls, wo es den heiteren und doch zugleich gehaltenen
Schmuck eines Speisesaales gilt, sehr am Platz erscheint.
Wo die Gesammthaltung in Zeichnung und Kolorit so
harmonisch wirkt, eben weil beide sowohl dem dargestell-
ten Jnhalt als dem monumentalen Zwecke entsprechen,
da kann es nicht die Aufgabe des Berichterstatters sein,
auf diese oder jene weniger gelungene Einzelheit auf-
merksam zu machen. Daß die Art der Pinselführung
eine durchaus modern-malerische ist, braucht bei jüngeren
Weimarer Künstlern nicht erst hervorLehoben zu werden.
X.
kuustliteratur.
Die pompcjanischc» Wanddekorationen, für Künstler und
Kunstgewerbeschulen sowie Freunde des Alterthums
herausgegeben von Emil Presuhn. Mit 24
Tafeln nach Originalzeichnungen von Discanno
in Chromolithographie ausgeführt von Steeger,
nebst einem Plan der Malereien Pompeji's. Leip-
zig, T. O- Weigel. 1877. 4.
Das Berdienst dieses ansehnlichen Werkes bestcht
einerseits darin, daß es eine Reihe noch nicht veröffent-
lichter pvmpejanischer Wanddekorationen den bisherigen
Publikationen aus jener unerschöpflichen Fülle anreiht,
andererseits beruht es darauf, daß sein Text zum ersten
Mal in deutscher Sprache die verschiedenen Entwick-
lungsphasen dieses Dekorationssystems klar zu legen
sucht. Der Verfasser fußt dabei im Wesentlichen aus
den von A. Mau im 6-iornuts äsKli souvi über diesen
Gegenstand veröffentlichten Aufsätzen. Nur an einigen
Stellen sucht er Mau's Ausführungen zu erweitern
oder zu berichtigen.
Uneingeschränkt können wir dem Werke die Geltung,
die es beansprucht, jedoch keineswegs zugestehen.
Was zunächst die Reproduktion der Wandmalereien
nach den überschwänglich gelobten Kopien des Herrn
Discanno anbetrifft, so ist dieselbe zwar so gut und
besser als manches aus diesem Gebiete Geleistete. Allein
der Eindruck der Chromolithographie cntspricht keines-
wegs der Technik der Originale auch nnr in der Weisi',
wie einige andere neucrdings publicirte Werle den Stsi
der antiken Wandmalereien bereits wiedergegeben habew
Die eigenthümliche, leichte und doch sichere, breite und
doch verstandcne Pinselführung der alten Kunsthanv-
werker kommt besonders in den figürlichen Partien gar'
nicht zur Geltung.
Was sodann den Text anbetrifft, ver in seincin
allgemeinen Theile Neues so gut wie gar nicht bringsi
so wird man der hauptsächlichen Schilderung der Stil-
wandlungen gemäß den Ausführungen Vitruv's und
Mau's, besonders bis zum Eintritt der leichten rohr-
stengel- und kandelaberartigen Stützen anstatt der archsi
tektonisch haltbareren Pilaster unv Halbsäulen, zustimmen
müssen; man wird auch die Sonderung aller diesir'
phantastischeren Dekorationssysteme, welche die Mehrzahl
in Pompeji bilden, in gewisse Klassen und Gruppen
dankbar anerkennen. Aber wenn alle diese Gruppen iu
chrouvlogischen Wandlungen aus einander abgeleitet und
so viele Epochen wie verschiedene Einzelsysteme statuirt
werden, so wird man sich gewichtigen Bedenken gegeN
dieses Verfahren nicht verschließen können. Schon daß
die Ansführung wenigstens sehr vieler dieser einander'
ähnlichen Dekorationen in die gleiche Zeit zwischen 63
und 79 n- Chr. gesetzt werden muß, legt die Ber-
muthung nahe, daß die meisten der Kunsthandwerker,
welche diese Malereien geschaffen, nachdem das strengere
Prinzip eimnal durchbrochen war, gleichzeitig nebeneinandcr'
verschiedene Shsteme angewandt haben, indem sie dabei
mehr ihrer Laune und momentanen Eingebung folgten, ats
daß sie konsequent Schritt für Schritt weiter gegangen
wären. Auch wird die ganze Frage, selbst und geradc
in Bezug anf die ältere Entwickelung, nicht ohne die
eingehendste Berücksichtigung der in dieser Beziehung si
außerordentlich lehrreichen römischen WandmalereieN
gelöst werden können.
Unangenehmer als diese Bedenken aber ist der
Umstand, daß der Dilettantismus des Verfassers, z"
dem er sich in der Vorrede selbst zu bekennen scheint,
sowohl den archäologischen als den kunstgewerblichesi
Fragen gegenüber allzu klar zu Tage tritt. Diesis
Urtheil muß motivirt werden.
Jn Bezug auf die archäologische Seite brausisi
man nur den ersten Absatz des Werkcs zu lesen. Der'
Verfasser spricht hier von „der Malerei der Altesi
im Allgemeinen" und stellt ganz naiv das Resultsik
voran: „Wir kennen eben nur die Wandmalereien dcr'
vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens(!), Mosaikesi
Kunstliteratur.
656
Kornhaufen in geschlossener Landschaft. Amoretten
wiederholen den Tanz in der Luft. — Das Herbstbild
endlich führt chns an einen Rebenhügel zur Zeit ver
Weinlese. Eine große, prächtige Landschaft! Rechts
die Anhöhe, oben mit Gebäuden iund Cypressen ge-
schmückt, von denen sich der Weg zwischen Mauern
durch die Weinberge herabwindet. Der Weg ist mit
fröhlichen Winzern belebt, die sich vorn zu Tanz und
Spiel und heitcrem Gelage vereinigt haben, während
die Amoretten in der Luft mit Masken und bacchischen
Attributen spielen. — Der Eindruck der Landschaften
wie der Kostüme ist überall im Ganzen ein italienischer;
doch ist ein größeres Gewicht auf malerischen Reiz als
auf Treue im Einzelnen gelegt. Krohn und Arndt
haben sich auf der Grundlage sehr realistischer Studien
und doch wohl im Anschluß an französische und nieder-
ländische Borbilder eine eigenartige, elegante und an-
muthige Art der Stilisirnng angeeignet, wie sie jeden-
falls, wo es den heiteren und doch zugleich gehaltenen
Schmuck eines Speisesaales gilt, sehr am Platz erscheint.
Wo die Gesammthaltung in Zeichnung und Kolorit so
harmonisch wirkt, eben weil beide sowohl dem dargestell-
ten Jnhalt als dem monumentalen Zwecke entsprechen,
da kann es nicht die Aufgabe des Berichterstatters sein,
auf diese oder jene weniger gelungene Einzelheit auf-
merksam zu machen. Daß die Art der Pinselführung
eine durchaus modern-malerische ist, braucht bei jüngeren
Weimarer Künstlern nicht erst hervorLehoben zu werden.
X.
kuustliteratur.
Die pompcjanischc» Wanddekorationen, für Künstler und
Kunstgewerbeschulen sowie Freunde des Alterthums
herausgegeben von Emil Presuhn. Mit 24
Tafeln nach Originalzeichnungen von Discanno
in Chromolithographie ausgeführt von Steeger,
nebst einem Plan der Malereien Pompeji's. Leip-
zig, T. O- Weigel. 1877. 4.
Das Berdienst dieses ansehnlichen Werkes bestcht
einerseits darin, daß es eine Reihe noch nicht veröffent-
lichter pvmpejanischer Wanddekorationen den bisherigen
Publikationen aus jener unerschöpflichen Fülle anreiht,
andererseits beruht es darauf, daß sein Text zum ersten
Mal in deutscher Sprache die verschiedenen Entwick-
lungsphasen dieses Dekorationssystems klar zu legen
sucht. Der Verfasser fußt dabei im Wesentlichen aus
den von A. Mau im 6-iornuts äsKli souvi über diesen
Gegenstand veröffentlichten Aufsätzen. Nur an einigen
Stellen sucht er Mau's Ausführungen zu erweitern
oder zu berichtigen.
Uneingeschränkt können wir dem Werke die Geltung,
die es beansprucht, jedoch keineswegs zugestehen.
Was zunächst die Reproduktion der Wandmalereien
nach den überschwänglich gelobten Kopien des Herrn
Discanno anbetrifft, so ist dieselbe zwar so gut und
besser als manches aus diesem Gebiete Geleistete. Allein
der Eindruck der Chromolithographie cntspricht keines-
wegs der Technik der Originale auch nnr in der Weisi',
wie einige andere neucrdings publicirte Werle den Stsi
der antiken Wandmalereien bereits wiedergegeben habew
Die eigenthümliche, leichte und doch sichere, breite und
doch verstandcne Pinselführung der alten Kunsthanv-
werker kommt besonders in den figürlichen Partien gar'
nicht zur Geltung.
Was sodann den Text anbetrifft, ver in seincin
allgemeinen Theile Neues so gut wie gar nicht bringsi
so wird man der hauptsächlichen Schilderung der Stil-
wandlungen gemäß den Ausführungen Vitruv's und
Mau's, besonders bis zum Eintritt der leichten rohr-
stengel- und kandelaberartigen Stützen anstatt der archsi
tektonisch haltbareren Pilaster unv Halbsäulen, zustimmen
müssen; man wird auch die Sonderung aller diesir'
phantastischeren Dekorationssysteme, welche die Mehrzahl
in Pompeji bilden, in gewisse Klassen und Gruppen
dankbar anerkennen. Aber wenn alle diese Gruppen iu
chrouvlogischen Wandlungen aus einander abgeleitet und
so viele Epochen wie verschiedene Einzelsysteme statuirt
werden, so wird man sich gewichtigen Bedenken gegeN
dieses Verfahren nicht verschließen können. Schon daß
die Ansführung wenigstens sehr vieler dieser einander'
ähnlichen Dekorationen in die gleiche Zeit zwischen 63
und 79 n- Chr. gesetzt werden muß, legt die Ber-
muthung nahe, daß die meisten der Kunsthandwerker,
welche diese Malereien geschaffen, nachdem das strengere
Prinzip eimnal durchbrochen war, gleichzeitig nebeneinandcr'
verschiedene Shsteme angewandt haben, indem sie dabei
mehr ihrer Laune und momentanen Eingebung folgten, ats
daß sie konsequent Schritt für Schritt weiter gegangen
wären. Auch wird die ganze Frage, selbst und geradc
in Bezug anf die ältere Entwickelung, nicht ohne die
eingehendste Berücksichtigung der in dieser Beziehung si
außerordentlich lehrreichen römischen WandmalereieN
gelöst werden können.
Unangenehmer als diese Bedenken aber ist der
Umstand, daß der Dilettantismus des Verfassers, z"
dem er sich in der Vorrede selbst zu bekennen scheint,
sowohl den archäologischen als den kunstgewerblichesi
Fragen gegenüber allzu klar zu Tage tritt. Diesis
Urtheil muß motivirt werden.
Jn Bezug auf die archäologische Seite brausisi
man nur den ersten Absatz des Werkcs zu lesen. Der'
Verfasser spricht hier von „der Malerei der Altesi
im Allgemeinen" und stellt ganz naiv das Resultsik
voran: „Wir kennen eben nur die Wandmalereien dcr'
vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens(!), Mosaikesi