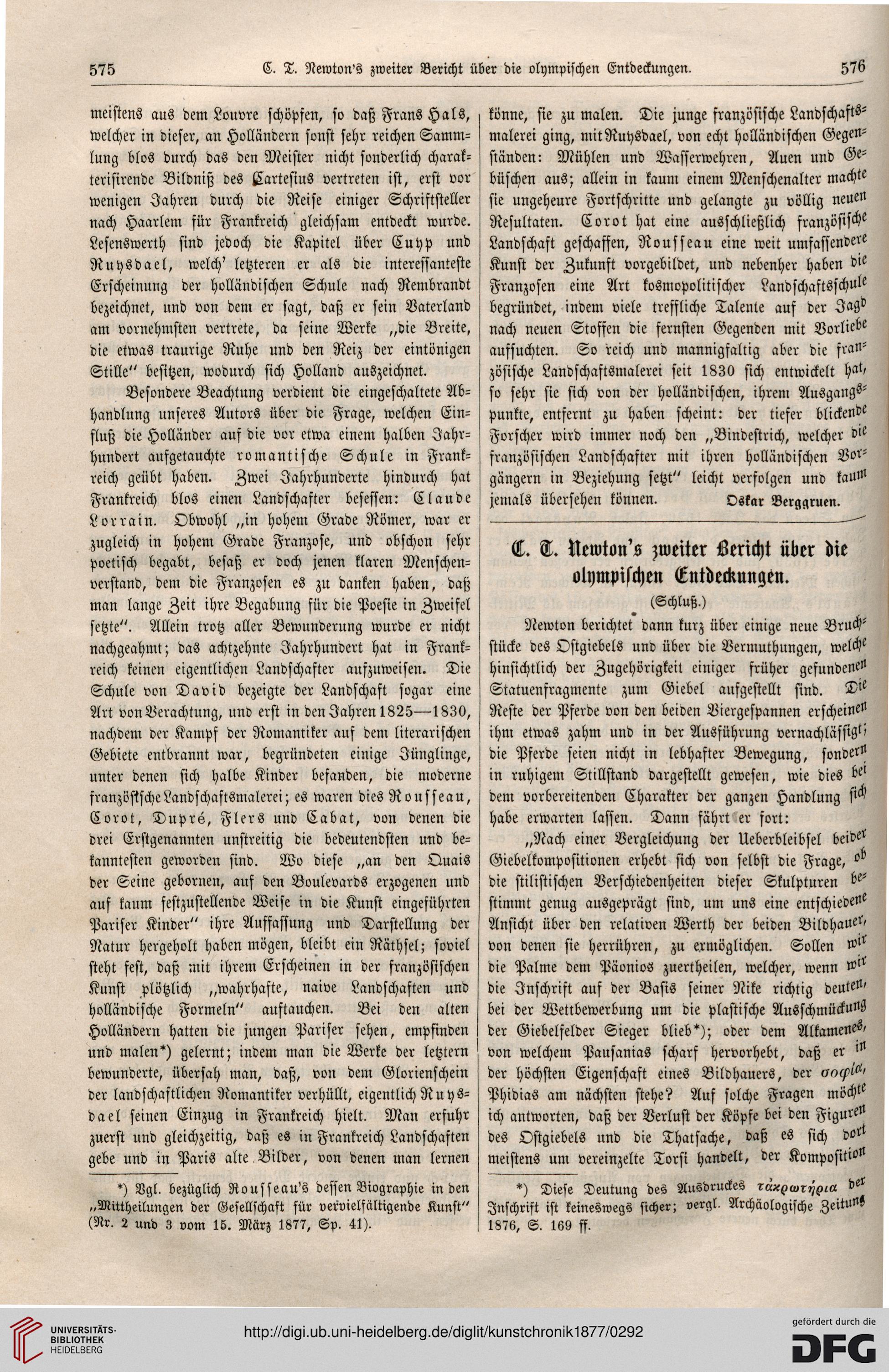575
C. T. Newton's zweiter Bericht über die olympischen Entdeckungen.
576
meistens aus dem Louvre schöpfen, so daß Frans Hals,
welcher in dieser, an Holländern sonst sehr reichen Samm-
lung blos durch das den Meister nicht sonderlich charak-
terisirende Bildniß des Cartesius vertreten ist, erst vor
wenigen Jahren durch die Reise einiger Schriftsteller
nach Haarlem für Frankreich gleichsam entdeckt wurde.
Lesenswerth sind jedoch die Kapitel Lber Cuhp und
Ruysdael, welch' letzteren er als die interessanteste
Erscheinung der holländischen Schule nach Rembrandt
bezeichnet, und von dem er sagt, daß er sein Vaterland
am vornehmsten vertrete, da seine Werke „die Breite,
die etwas traurige Ruhe und den Neiz der eintönigen
Stille" besitzen, wodurch sich Holland auszeichnet.
Besondere Beachtung verdient die eingeschaltete Ab-
handlung nnseres Autors über die Frage, welchen Ein-
fluß die Holländer auf die vor etwa einem halben Jahr-
hundert aufgetauchte romantische Schule in Frank-
reich geübt haben. Zwei Jahrhunderte hindurch hat
Frankreich blos einen Landschafter besessen: Claude
Lorrain. Obwohl „in hohem Grade Römer, war er
zngleich in hohem Grade Franzose, und obschon sehr
poetisch Legabt, besaß er doch jenen klaren Menschen-
verstand, dem die Franzosen es zu danken haben, daß
man lange Zeit ihre Begabung für die Poesie in Zweifel
setzte". Allein trotz aller Bewunderung wurde er nicht
nachgeahmt; das achtzehnte Jahrhundert hat in Frank-
reich keinen eigentlichen Landschafter aufzuwcisen. Die
Schnle von David bezeigte der Landschaft sogar eine
Art von Verachtung, und erst in den Jahren1825—1830,
nachdem dcr Kampf der Romantiker auf dem literarischen
Gebiete entbrannt war, begründeten einige Jünglinge,
unter denen sich halbe Kinder befanden, die moderne
französtsche Landschaftsmalerei; es waren dies Rousseau,
Corot, Duprs, Flers uud Cabat, von denen die
drei Erstgenannten unstreitig die bedeutendsten und be-
kanntesten geworden sind. Wv diese „an dcn Quais
der Seine gebornen, auf den Boulevards erzogenen und
auf kaum festzustellende Weise in die Kunst eingeführten
Pariser Kinder" ihre Auffassung nnd Darstcllung der
Natur hergeholt haben mögen, bleibt ein Räthsel; soviel
steht fest, daß mit ihrem Erscheinen in der französischen
Kunst Plötzlich „wahrhafte, naive Landschaften und
holländische Formeln" auftauchen. Bei den alten
Holländern hatten die jungen Pariser sehen, empfinden
und malen*) gelernt; indem man die Werke der letztern
bewunderte, übersah man, daß, vou dem Glorienschein
der landschaftlichen Romantiker verhüllt, eigentlich Ruys-
dael seinen Einzug in Frankreich hielt. Man erfuhr
zuerst und gleichzeitig, daß es in Frankreich Landschaften
gebe und in Paris alte Bilder, von denen man lernen
*) Vgl. bezüglich Rousseau's dessen Biographie in den
„Mittheilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst"
(Nr. 2 und 3 vom 15. März 1877, Sp. 41).
könne, sie zu malen. Die junge französische Landschafts-
malerei ging, mitRuysdael, von echt holländischen Gegen-
ständen: Mühlen und Wasserwehren, Auen und Ge-
büschen aus; allein in kauni einem Menschenalter mackste
sie ungeheure Fortschritte und gelangte zu völlig neuen
Resultaten. Corot hat eine ausschließlich französisch^
Landschaft geschaffen, Rousseau eine weit umfassendere
Kunst der Zukunft vorgebildet, und nebenher haben die
Franzosen eine Art kosmopolitischer Landschaftsschule
begründet, indem viele treffliche Talente auf der Jagb
nach neuen Stoffen die fernsten Gegenden mit Vorliebe
aufsuchten. So reich und mannigfaltig aber die fraw
zösische Landschaftsmalerei seit 1830 sich entwickelt hall
so sehr sie sich von der holländischen, ihrem Ausgangs'
punkte, entfernt zu haben scheint: der tiefer blickende
Forscher wird immer noch den „Bindestrich, welcher d>c
französischcn Landschafter mit ihren holländischen Vw"
gängern in Beziehung setzt" leicht verfolgen und kai»»
jemals übersehen können. Oskar Berggruen.
C. T. Newton's zweiter Lericht über -ie
otympischen Ent-eckungen.
(Schluß.)
Newton berichtet dann kurz über einige neue Bruck'
stücke des Ostgiebels und über die Vermuthungen, welch'-
hinstchtlich der Zugehörigkeit einiger früher gefundeneN
Statuenfragmente zum Giebel aufgestellt sind. D^
Reste der Pferde von den beiden Viergespannen erscheineN
ihm etwas zahm und in der Ausführung vernachlässich'
die Pferde seien nicht in lebhafter Bewegung, sonderN
in ruhigem Stillstand dargestellt gewesen, wie dies be>
dem vorbereitenden Charakler der ganzen Handlung s>^
habe erwarten lassen. Dann fährt er fort:
„Nach einer Vergleichung der Ueberbleibsel beid^
Giebelkompositionen erhebt sich von selbst die Frage, ^
die stilistischen Berschiedenheiten dieser Skulpturen be-
stimmt genug ausgeprägt sind, um uns eine entschiedene
Ansicht über den relativen Werth der beiden BildhaueO
von denen sie herrühren, zu ermöglichen. Sollen nB
die Palme dem Päonios zuertheilen, welcher, wenn nB
die Jnschrift auf der Basis seiner Nike richtig deuteN'
bei der Wetibewerbung um die plastische Ausschmiickunh
der Giebelfelder Sieger blieb*); oder dem Alkamenes,
von welchem Pausanias scharf hervorhebt, daß er
der höchsten Eigenschaft eines Bildhauers, der
Phidias am nächsten stehe? Auf solche Fragen möchte
ich antworten, daß der Verlust der Köpfe bei den FigureN
des Ostgiebels und die Thalsache, daß es sich dorl
meistens um vereinzelte Torsi handelt, der Kompositw"
*) Diese Deutung des Ausdruckes rck^wr^,« der
Juschrift ist keineswegs sich-r; vergl. Archäologische ZeituN«
1876, S. 169 ff.
C. T. Newton's zweiter Bericht über die olympischen Entdeckungen.
576
meistens aus dem Louvre schöpfen, so daß Frans Hals,
welcher in dieser, an Holländern sonst sehr reichen Samm-
lung blos durch das den Meister nicht sonderlich charak-
terisirende Bildniß des Cartesius vertreten ist, erst vor
wenigen Jahren durch die Reise einiger Schriftsteller
nach Haarlem für Frankreich gleichsam entdeckt wurde.
Lesenswerth sind jedoch die Kapitel Lber Cuhp und
Ruysdael, welch' letzteren er als die interessanteste
Erscheinung der holländischen Schule nach Rembrandt
bezeichnet, und von dem er sagt, daß er sein Vaterland
am vornehmsten vertrete, da seine Werke „die Breite,
die etwas traurige Ruhe und den Neiz der eintönigen
Stille" besitzen, wodurch sich Holland auszeichnet.
Besondere Beachtung verdient die eingeschaltete Ab-
handlung nnseres Autors über die Frage, welchen Ein-
fluß die Holländer auf die vor etwa einem halben Jahr-
hundert aufgetauchte romantische Schule in Frank-
reich geübt haben. Zwei Jahrhunderte hindurch hat
Frankreich blos einen Landschafter besessen: Claude
Lorrain. Obwohl „in hohem Grade Römer, war er
zngleich in hohem Grade Franzose, und obschon sehr
poetisch Legabt, besaß er doch jenen klaren Menschen-
verstand, dem die Franzosen es zu danken haben, daß
man lange Zeit ihre Begabung für die Poesie in Zweifel
setzte". Allein trotz aller Bewunderung wurde er nicht
nachgeahmt; das achtzehnte Jahrhundert hat in Frank-
reich keinen eigentlichen Landschafter aufzuwcisen. Die
Schnle von David bezeigte der Landschaft sogar eine
Art von Verachtung, und erst in den Jahren1825—1830,
nachdem dcr Kampf der Romantiker auf dem literarischen
Gebiete entbrannt war, begründeten einige Jünglinge,
unter denen sich halbe Kinder befanden, die moderne
französtsche Landschaftsmalerei; es waren dies Rousseau,
Corot, Duprs, Flers uud Cabat, von denen die
drei Erstgenannten unstreitig die bedeutendsten und be-
kanntesten geworden sind. Wv diese „an dcn Quais
der Seine gebornen, auf den Boulevards erzogenen und
auf kaum festzustellende Weise in die Kunst eingeführten
Pariser Kinder" ihre Auffassung nnd Darstcllung der
Natur hergeholt haben mögen, bleibt ein Räthsel; soviel
steht fest, daß mit ihrem Erscheinen in der französischen
Kunst Plötzlich „wahrhafte, naive Landschaften und
holländische Formeln" auftauchen. Bei den alten
Holländern hatten die jungen Pariser sehen, empfinden
und malen*) gelernt; indem man die Werke der letztern
bewunderte, übersah man, daß, vou dem Glorienschein
der landschaftlichen Romantiker verhüllt, eigentlich Ruys-
dael seinen Einzug in Frankreich hielt. Man erfuhr
zuerst und gleichzeitig, daß es in Frankreich Landschaften
gebe und in Paris alte Bilder, von denen man lernen
*) Vgl. bezüglich Rousseau's dessen Biographie in den
„Mittheilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst"
(Nr. 2 und 3 vom 15. März 1877, Sp. 41).
könne, sie zu malen. Die junge französische Landschafts-
malerei ging, mitRuysdael, von echt holländischen Gegen-
ständen: Mühlen und Wasserwehren, Auen und Ge-
büschen aus; allein in kauni einem Menschenalter mackste
sie ungeheure Fortschritte und gelangte zu völlig neuen
Resultaten. Corot hat eine ausschließlich französisch^
Landschaft geschaffen, Rousseau eine weit umfassendere
Kunst der Zukunft vorgebildet, und nebenher haben die
Franzosen eine Art kosmopolitischer Landschaftsschule
begründet, indem viele treffliche Talente auf der Jagb
nach neuen Stoffen die fernsten Gegenden mit Vorliebe
aufsuchten. So reich und mannigfaltig aber die fraw
zösische Landschaftsmalerei seit 1830 sich entwickelt hall
so sehr sie sich von der holländischen, ihrem Ausgangs'
punkte, entfernt zu haben scheint: der tiefer blickende
Forscher wird immer noch den „Bindestrich, welcher d>c
französischcn Landschafter mit ihren holländischen Vw"
gängern in Beziehung setzt" leicht verfolgen und kai»»
jemals übersehen können. Oskar Berggruen.
C. T. Newton's zweiter Lericht über -ie
otympischen Ent-eckungen.
(Schluß.)
Newton berichtet dann kurz über einige neue Bruck'
stücke des Ostgiebels und über die Vermuthungen, welch'-
hinstchtlich der Zugehörigkeit einiger früher gefundeneN
Statuenfragmente zum Giebel aufgestellt sind. D^
Reste der Pferde von den beiden Viergespannen erscheineN
ihm etwas zahm und in der Ausführung vernachlässich'
die Pferde seien nicht in lebhafter Bewegung, sonderN
in ruhigem Stillstand dargestellt gewesen, wie dies be>
dem vorbereitenden Charakler der ganzen Handlung s>^
habe erwarten lassen. Dann fährt er fort:
„Nach einer Vergleichung der Ueberbleibsel beid^
Giebelkompositionen erhebt sich von selbst die Frage, ^
die stilistischen Berschiedenheiten dieser Skulpturen be-
stimmt genug ausgeprägt sind, um uns eine entschiedene
Ansicht über den relativen Werth der beiden BildhaueO
von denen sie herrühren, zu ermöglichen. Sollen nB
die Palme dem Päonios zuertheilen, welcher, wenn nB
die Jnschrift auf der Basis seiner Nike richtig deuteN'
bei der Wetibewerbung um die plastische Ausschmiickunh
der Giebelfelder Sieger blieb*); oder dem Alkamenes,
von welchem Pausanias scharf hervorhebt, daß er
der höchsten Eigenschaft eines Bildhauers, der
Phidias am nächsten stehe? Auf solche Fragen möchte
ich antworten, daß der Verlust der Köpfe bei den FigureN
des Ostgiebels und die Thalsache, daß es sich dorl
meistens um vereinzelte Torsi handelt, der Kompositw"
*) Diese Deutung des Ausdruckes rck^wr^,« der
Juschrift ist keineswegs sich-r; vergl. Archäologische ZeituN«
1876, S. 169 ff.