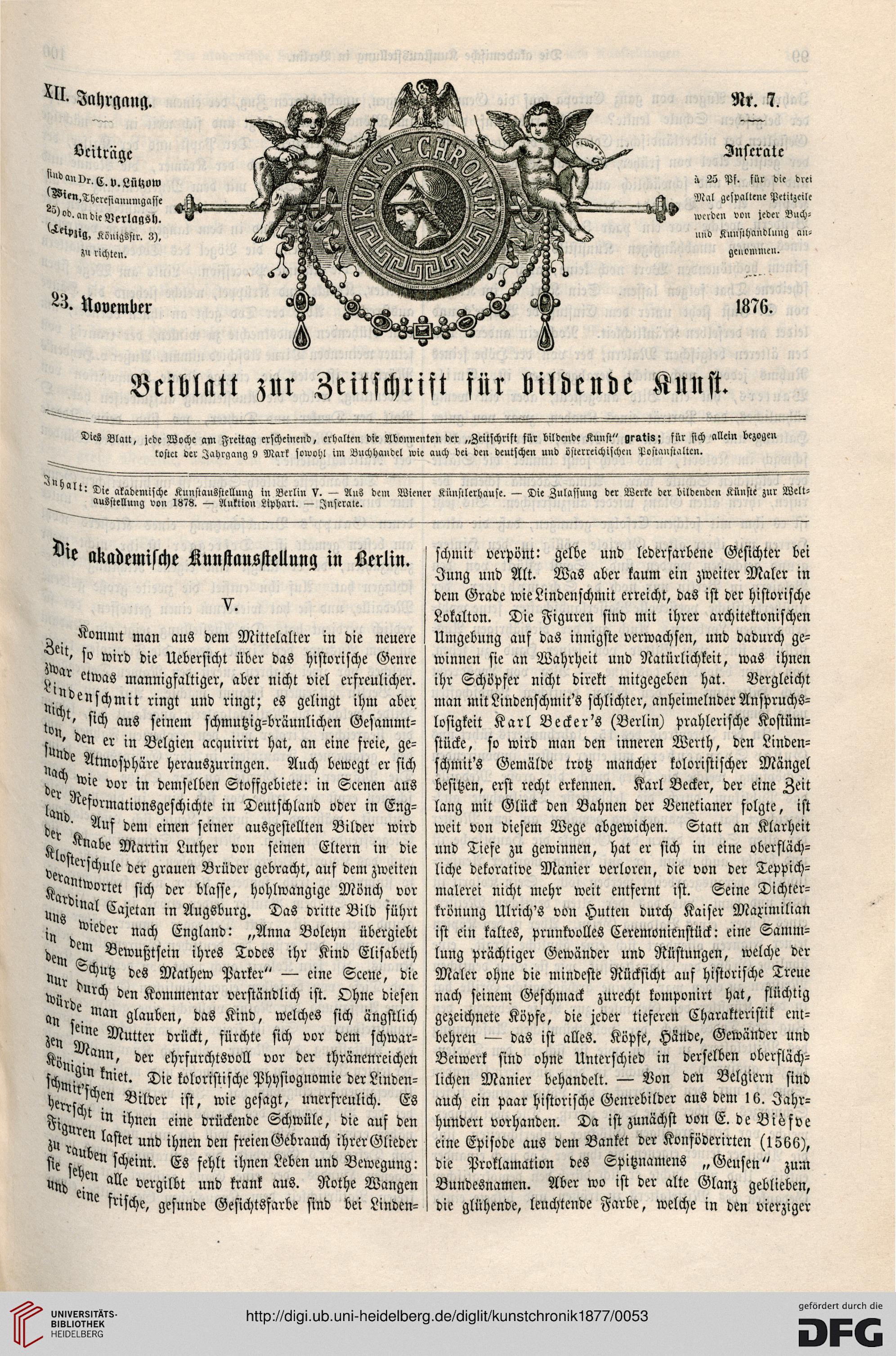Lciträgc
^^iMow
^^^'Thcresianunigasse
°)°d.->nUeBcrl<ias».
^^lig, Königsstr. S),
»u nchte».
Rovember
Nr. 7.
Znscratc
L 25 Pf. für die drei
Mal gespaltene Petitzeile
werden von jeder Buch-
»lnd Kuni'lhcmdlung an-
ge»l0mmen.
1876.
Bciblatt znr Zntschrist siir vildende Kunst.
Dies Blatt, jede Woche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst" grati8; für sich allein bezogen
kostel der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel wie auch bei den deutschen und Lsterreichischen Postanstalten.
^"halt
Die akademische Kunstausstellung in Berlin V. — Aus dem Wiener Künstlerhause. — Die Zulassung der Werke der bildenden Künste zur Welt-
ausstellung von 1878. — Auktion Liphart. — Inserate.
^ie akademische ÄunstanSstellung in Gerlin.
v.
2 Kommt man aus dem Mittelalter in die ncuere
^ Ucbersicht über das historische Genre
^ elwas mannigfaltiger, aber nicht viel erfreulicher.
'udenschmit ringt und ringt; es gelingt ihm aber
^ airs seinem schmutzig-bräunlichen Gesammt-
^ ^ ^elgien acquirirt hat, an eine freie, ge-
„ ^ ^lmosphäre herauszuringen. Auch bewegt er sich
de,.^^E dor in demselben Stoffgebiete: in Scenen aus
^^^l°rmationsgeschichte in Deutschland oder in Eng-
dex ^ ^em binen seiner ausgestellten Bilder wird
^nabe Marlin Luther von seinen Eltern in die
^Uchule der grauen Brüder gebracht, auf dem zweiten
^^?^°Aet sich der blasse, hohlwangige Mönch vor
u»s ^ujetan in Augsburg. Das dritte Bild führt
i» ^kder nach England: „Anna Boleyn übergiebt
^n, ^ ^ewußtsein ihres Todes ihr Kind Elisabcth
^chutz des Mathew Parker" — eine Scene, die
wj) . den Kommentar verständlich ist. Ohne diesen
»n glauben, das Kind, welches sich ängstlich
ien ^utter drückt, sürchte sich vor dem schwar-
tzjz . . ^uu, tzor ehrfurchtsvoll vor der thränenreichen
^lndu? Die koloristische Physiognomie der Linden-
hx^! '^su Bilder ist, wie gesagt, unerfreulich. Es
Fjg ^ ^u ihnm eine drückende Schwüle, die auf den
iu ra ? und ihnen den freienGebrauch ihrerGlieder
sie k." EU scheint. Es fehlt ihnen Leben und Bewegung:
UNd E vergilbt und krank aus. Rothe Wangen
'Ue frischo, gesunde Gesichtsfarbe sind bei Linden-
schmlt verpönt: gelbe und lederfarbene Gesichter bei
Jung und Alt- Was aber kaum ein zweiter Malcr in
dem Grade wieLindenschmit erreicht, das ist der historische
Lokalton. Die Figuren sind mit ihrer architektonischen
Umgebung auf das innigste verwachsen, und dadurch ge-
winnen sie an Wahrheit und Natürlichkeit, was ihnen
ihr Schöpfer nicht direkt mitgegeben hat. Vergleicht
man mit Lindenschmit's schlichter, anheimelnder Anspruchs-
losigkeit Karl Becker's (Berlin) prahlerische Kostüm-
stücke, so wird man den inneren Werth, den Linden-
schmit's Gemälde trotz mancher koloristischer Mängel
besitzen, erst recht erkennen. Karl Becker, der eine Zeit
lang mit Glück den Bahnen der Venetianer folgte, ist
weit von Liesem Wege abgewichen. Statt an Klarheit
und Tiefe zu gewinnen, hat er sich in eine oberfläch-
liche dekorative Manier verloreu, die von der Teppich-
malerei nicht mehr weit entfernt ist. Seine Dichter-
krönung Ulrich's von Hutten durch Kaiser Maximilian
ist eiu kältes, prunkvolles Ceremonicnstück: eine Samm-
lung prächtiger Gewänder und Rüstungen, welche dcr
Malcr ohne die mindeste Rücksicht auf historische Treue
nach seinem Geschmack zurecht komponirt hat, flüchlig
gezeichnete Köpfe, die jeder tieferen Charakteristik ent-
behren — das ist alles. Köpfe, Hände, Gewänder und
Beiwcrk sind ohne Unterschied in derselben oberfläch-
lichen Manier behandelt. — Von den Belgiern sind
auch ein paar historische Genrebilder aus dem 16. Jahr-
hundert vorhanden. Da ist zunächst von E. de Biäfve
eine Episode aus dem Banket dcr Konföderirten (1566),
die Proklamation deS Spitznamens „Geusen" zum
Bundesnamen. Aber wo ist der alte Glanz geblieben,
die glühende, leuchtcnde Farbe, welche in den vierziger