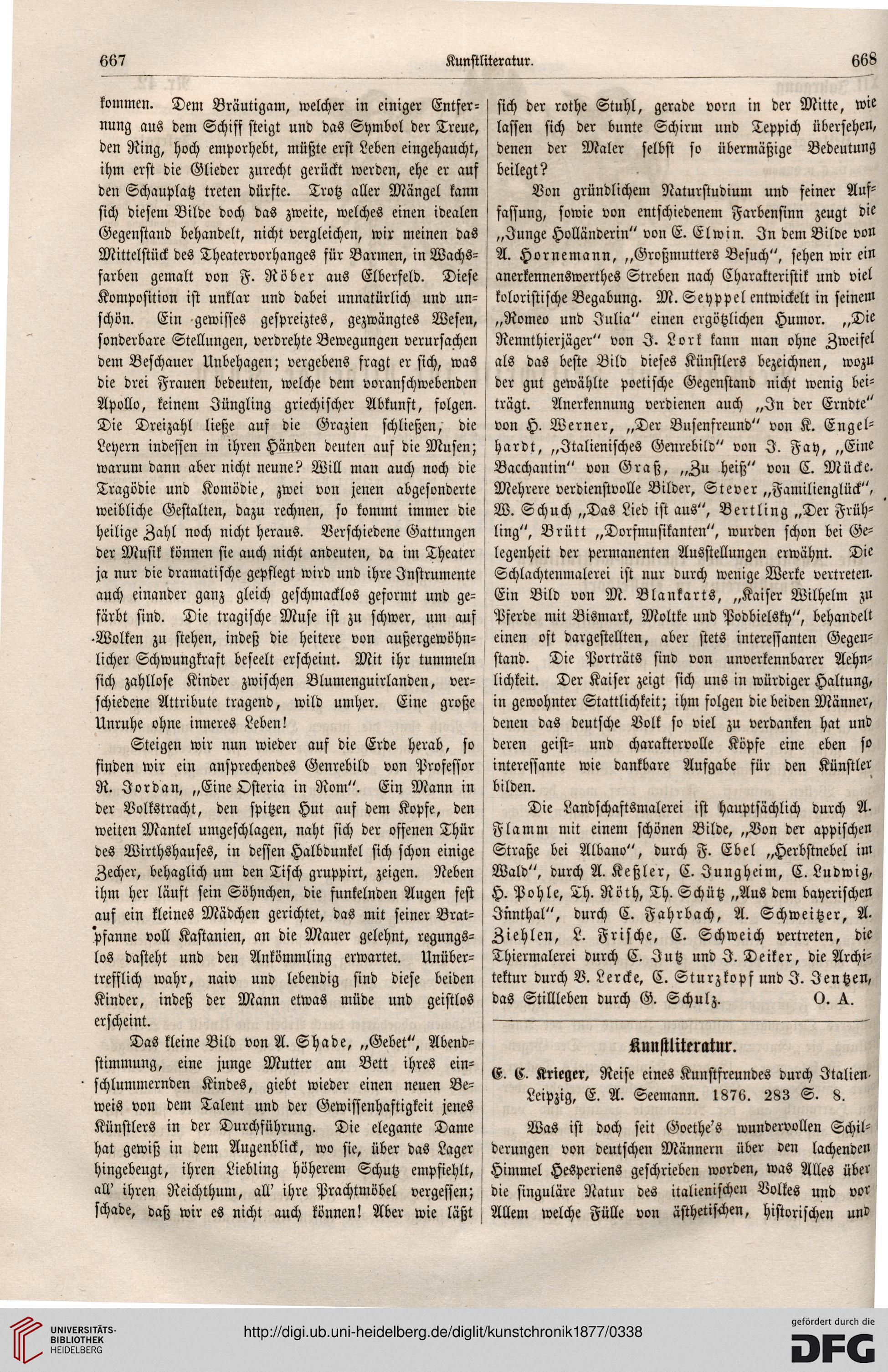667
Kunstliteratur,
668
kommeii. Dem Bräutigam, welcher in einiger Entfer-
riung aus dem Schiff steigt und das Symbol der Treue,
den Ring, hoch emporhebt, müßte erst Leben eingehaucht,
ihm erst die Glieder zurecht gerückt werden, ehe er auf
den Schauplatz treten dürfte. Trotz aller Mängel kann
sich diesem Bilde doch das zweite, welches einen idealen
Gegenstand behandelt, nicht vergleichen, wir meinen das
Mittelstück des Theatervorhanges für Barmen, in Wachs-
farben gemalt von F. Röber aus Elberfeld. Diese
Komposition ist unklar und dabei unnatürlich und un-
schön. Ein gewisses gespreiztes, gezwängtes Wesen,
sonderbare Stellungen, verdrehte Bewegungen verursachen
dem Beschauer Unbehagen; vergebens fragt er sich, was
die drei Frauen bedeuten, welche dem voranschwebenden
Apollo, keinem Jüngling griechischer Abkunft, folgen.
Die Dreizahl ließe auf die Grazien schließen, die
Leyern indessen in ihren Händen deuten auf die Musen;
warum dann aber nicht neune? Will man auch noch die
Tragödie und Komödie, zwei von jenen abgesonderte
weibliche Gestalten, dazu rechnen, so kommt immer die
heilige Zahl noch nicht heraus. Verschiedene Gattungen
der Musik können sie auch nicht andeuten, da im Theater
ja nur die dramatische gepflegt wird und ihre Jnstrumente
auch einander ganz gleich geschmacklos geformt und ge-
färbt sind. Die tragische Muse ist zu schwer, um auf
-Wolken zu stehen, indeß die heitere von außergewöhn-
licher Schwungkraft bcseelt erscheint. Mit ihr tummeln
sich zahllose Kinder zwischen Blumenguirlanden, ver-
schiedene Attribute tragend, wild umher. Eine große
Unruhe ohne inneres Leben!
Steigen wir nun wieder auf die Erde herab, so
finden wir ein ansprechendes Genrebild von Professor
R. Iordan, „Eine Osteria in Rom". Ein Mann in
der Volkstracht, den spitzen Hut auf dem Kopfe, den
weiten Mantel umgeschlagen, naht sich der offenen Thür
des Wirthshauses, in dessen Halbdunkel sich schon einige
Zecher, behaglich um den Tisch gruppirt, zeigen. Neben
ihm her läuft sein Söhnchen, die funkelnden Augen fest
auf ein kleines Mädchen gerichtet, das mit seiner Brat-
pfanne voll Kastanien, an die Mauer gelehnt, regungs-
los dasteht und den Ankömmling erwartet. Unüber-
trefflich wahr, naiv unv lebendig sind diese beiden
Kinder, indeß der Mann etwas müde und geistlos
erscheint.
Das kleine Bild von A. Shade, „Gebet", Abend-
stimmung, eine junge Mutter am Bett ihres ein-
schlummernden Kindes, giebt wieder einen neuen Be-
weis von dcm Talent und der Gewissenhaftigkeit jenes
Künstlers in der Durchführung. Die elegante Dame
hat gewiß in dem Augenblick, wo sie, über das Lager
hingebeugt, ihren Liebling höherem Schutz empfiehlt,
aü' ihren Reichthum, all' ihre Prachtmöbel vergessen;
schade, daß wir es nicht auch können! Aber wie läßt
sich der rothe Stuhl, gerade vorn in der Mitte, wie
lassen sich der bunte Schirm und Teppich übersehen,
denen der Maler selbst so übermäßige Bedeutung
beilegt?
Von gründlichem Naturstudium und feiner Auf-
fassung, sowie von entschiedenem Farbensinn zeugt die
„Junge Holländerin" von E. Elwin. Jn dem Bilde von
A. Hornemann, „Großmutters Besuch", sehen wir ein
anerkennenswerthes Streben nach Charakteristik und viel
koloristische Begabung. M. Seyppel entwickelt in seinein
„Romeo und Julia" eineu ergötzlichen Humor. „Die
Rennthierjäger" von I. Lork kann man ohne Zweifel
als das beste Bild dieses Künstlers bezeichnen, wozu
der gut gewählte poetische Gegenstand nicht wenig bei-
trägt. Anerkennung verdienen auch „Jn der Erndtc"
von H. Werner, „Der Busenfreund" von K. Engel-
hardt, „Jtalienisches Genrebild" von I. Fay, „Einc
Bacchantin" von Graß, „Zu heiß" von C. Mückc.
Mehrere verdienstvolle Bilder, Stever „Familienglück",
W. Schuch „Das Lied ist aus", Bertling „Der Früh-
ling", Brütt „Dorfmusikanten", wurden schon bei Ge-
legenheit der permanenten Ausstellungen erwähnt. Die
Schlachteumalerei ist nur Lurch wenige Werke vertreten-
Ein Bild von M. Blankarts, „Kaiser Wilhelm zu
Pferde mil Bismark, Moltke und Podbielsky", behandelt
einen oft dargestelllen, aber stets interessanten Gegen-
stand. Die Porträts stnd von unverkennbarer Aehn-
lichkeit. Der Kaiser zeigt sich uns in würdiger Haltung,
in gewohnter Stattlichkeit; ihm folgen die beiden Männer,
denen das deutsche Volk so viel zu verdanken hat und
Leren geist- und charaktervolle Köpfe eine eben so
interessante wie dankbare Aufgabe für den Künstler
bilden.
Die Landschaftsmalerei ist hauptsächlich durch A-
Flamm mit einem schönen Bilde, „Von der appischen
Straße bei Albano", durch F. Ebel „Herbstnebel üu
Wald", durch A. Keßler, C. Jungheim, C. Ludwig,
H. Pohle, Th. Röth, Th. Schütz „Aus dem bayerischcn
Innthal", durch C. Fahrbach, A. Schweitzer, A-
Ziehlen, L. Frische, C. Schweich vertreten, dic
Thiermalerei durch C. Äutz und I. Deiker, die Archi-
tektur durch V. Lercke, C. Sturzkopf und I. Jentzen,
das Stillleben durch G. Schulz. 0.
kuMiteratur.
E. E. Kriegcr, Reise eines Kunstfreundes durch Ätalien-
Leipzig, E. A. Seemann. 1876. 283 S. 8.
Was ist doch seit Goethe's wundervollen Schil-
dcrungen von deutschen Männern über ven lachendeu
Himmel Hesperiens geschrieben worden, was Alles über
die singuläre Nalur bes italienischen Volkes und vor
Allem welche Fülle von ästhetischen, historischen unv
Kunstliteratur,
668
kommeii. Dem Bräutigam, welcher in einiger Entfer-
riung aus dem Schiff steigt und das Symbol der Treue,
den Ring, hoch emporhebt, müßte erst Leben eingehaucht,
ihm erst die Glieder zurecht gerückt werden, ehe er auf
den Schauplatz treten dürfte. Trotz aller Mängel kann
sich diesem Bilde doch das zweite, welches einen idealen
Gegenstand behandelt, nicht vergleichen, wir meinen das
Mittelstück des Theatervorhanges für Barmen, in Wachs-
farben gemalt von F. Röber aus Elberfeld. Diese
Komposition ist unklar und dabei unnatürlich und un-
schön. Ein gewisses gespreiztes, gezwängtes Wesen,
sonderbare Stellungen, verdrehte Bewegungen verursachen
dem Beschauer Unbehagen; vergebens fragt er sich, was
die drei Frauen bedeuten, welche dem voranschwebenden
Apollo, keinem Jüngling griechischer Abkunft, folgen.
Die Dreizahl ließe auf die Grazien schließen, die
Leyern indessen in ihren Händen deuten auf die Musen;
warum dann aber nicht neune? Will man auch noch die
Tragödie und Komödie, zwei von jenen abgesonderte
weibliche Gestalten, dazu rechnen, so kommt immer die
heilige Zahl noch nicht heraus. Verschiedene Gattungen
der Musik können sie auch nicht andeuten, da im Theater
ja nur die dramatische gepflegt wird und ihre Jnstrumente
auch einander ganz gleich geschmacklos geformt und ge-
färbt sind. Die tragische Muse ist zu schwer, um auf
-Wolken zu stehen, indeß die heitere von außergewöhn-
licher Schwungkraft bcseelt erscheint. Mit ihr tummeln
sich zahllose Kinder zwischen Blumenguirlanden, ver-
schiedene Attribute tragend, wild umher. Eine große
Unruhe ohne inneres Leben!
Steigen wir nun wieder auf die Erde herab, so
finden wir ein ansprechendes Genrebild von Professor
R. Iordan, „Eine Osteria in Rom". Ein Mann in
der Volkstracht, den spitzen Hut auf dem Kopfe, den
weiten Mantel umgeschlagen, naht sich der offenen Thür
des Wirthshauses, in dessen Halbdunkel sich schon einige
Zecher, behaglich um den Tisch gruppirt, zeigen. Neben
ihm her läuft sein Söhnchen, die funkelnden Augen fest
auf ein kleines Mädchen gerichtet, das mit seiner Brat-
pfanne voll Kastanien, an die Mauer gelehnt, regungs-
los dasteht und den Ankömmling erwartet. Unüber-
trefflich wahr, naiv unv lebendig sind diese beiden
Kinder, indeß der Mann etwas müde und geistlos
erscheint.
Das kleine Bild von A. Shade, „Gebet", Abend-
stimmung, eine junge Mutter am Bett ihres ein-
schlummernden Kindes, giebt wieder einen neuen Be-
weis von dcm Talent und der Gewissenhaftigkeit jenes
Künstlers in der Durchführung. Die elegante Dame
hat gewiß in dem Augenblick, wo sie, über das Lager
hingebeugt, ihren Liebling höherem Schutz empfiehlt,
aü' ihren Reichthum, all' ihre Prachtmöbel vergessen;
schade, daß wir es nicht auch können! Aber wie läßt
sich der rothe Stuhl, gerade vorn in der Mitte, wie
lassen sich der bunte Schirm und Teppich übersehen,
denen der Maler selbst so übermäßige Bedeutung
beilegt?
Von gründlichem Naturstudium und feiner Auf-
fassung, sowie von entschiedenem Farbensinn zeugt die
„Junge Holländerin" von E. Elwin. Jn dem Bilde von
A. Hornemann, „Großmutters Besuch", sehen wir ein
anerkennenswerthes Streben nach Charakteristik und viel
koloristische Begabung. M. Seyppel entwickelt in seinein
„Romeo und Julia" eineu ergötzlichen Humor. „Die
Rennthierjäger" von I. Lork kann man ohne Zweifel
als das beste Bild dieses Künstlers bezeichnen, wozu
der gut gewählte poetische Gegenstand nicht wenig bei-
trägt. Anerkennung verdienen auch „Jn der Erndtc"
von H. Werner, „Der Busenfreund" von K. Engel-
hardt, „Jtalienisches Genrebild" von I. Fay, „Einc
Bacchantin" von Graß, „Zu heiß" von C. Mückc.
Mehrere verdienstvolle Bilder, Stever „Familienglück",
W. Schuch „Das Lied ist aus", Bertling „Der Früh-
ling", Brütt „Dorfmusikanten", wurden schon bei Ge-
legenheit der permanenten Ausstellungen erwähnt. Die
Schlachteumalerei ist nur Lurch wenige Werke vertreten-
Ein Bild von M. Blankarts, „Kaiser Wilhelm zu
Pferde mil Bismark, Moltke und Podbielsky", behandelt
einen oft dargestelllen, aber stets interessanten Gegen-
stand. Die Porträts stnd von unverkennbarer Aehn-
lichkeit. Der Kaiser zeigt sich uns in würdiger Haltung,
in gewohnter Stattlichkeit; ihm folgen die beiden Männer,
denen das deutsche Volk so viel zu verdanken hat und
Leren geist- und charaktervolle Köpfe eine eben so
interessante wie dankbare Aufgabe für den Künstler
bilden.
Die Landschaftsmalerei ist hauptsächlich durch A-
Flamm mit einem schönen Bilde, „Von der appischen
Straße bei Albano", durch F. Ebel „Herbstnebel üu
Wald", durch A. Keßler, C. Jungheim, C. Ludwig,
H. Pohle, Th. Röth, Th. Schütz „Aus dem bayerischcn
Innthal", durch C. Fahrbach, A. Schweitzer, A-
Ziehlen, L. Frische, C. Schweich vertreten, dic
Thiermalerei durch C. Äutz und I. Deiker, die Archi-
tektur durch V. Lercke, C. Sturzkopf und I. Jentzen,
das Stillleben durch G. Schulz. 0.
kuMiteratur.
E. E. Kriegcr, Reise eines Kunstfreundes durch Ätalien-
Leipzig, E. A. Seemann. 1876. 283 S. 8.
Was ist doch seit Goethe's wundervollen Schil-
dcrungen von deutschen Männern über ven lachendeu
Himmel Hesperiens geschrieben worden, was Alles über
die singuläre Nalur bes italienischen Volkes und vor
Allem welche Fülle von ästhetischen, historischen unv