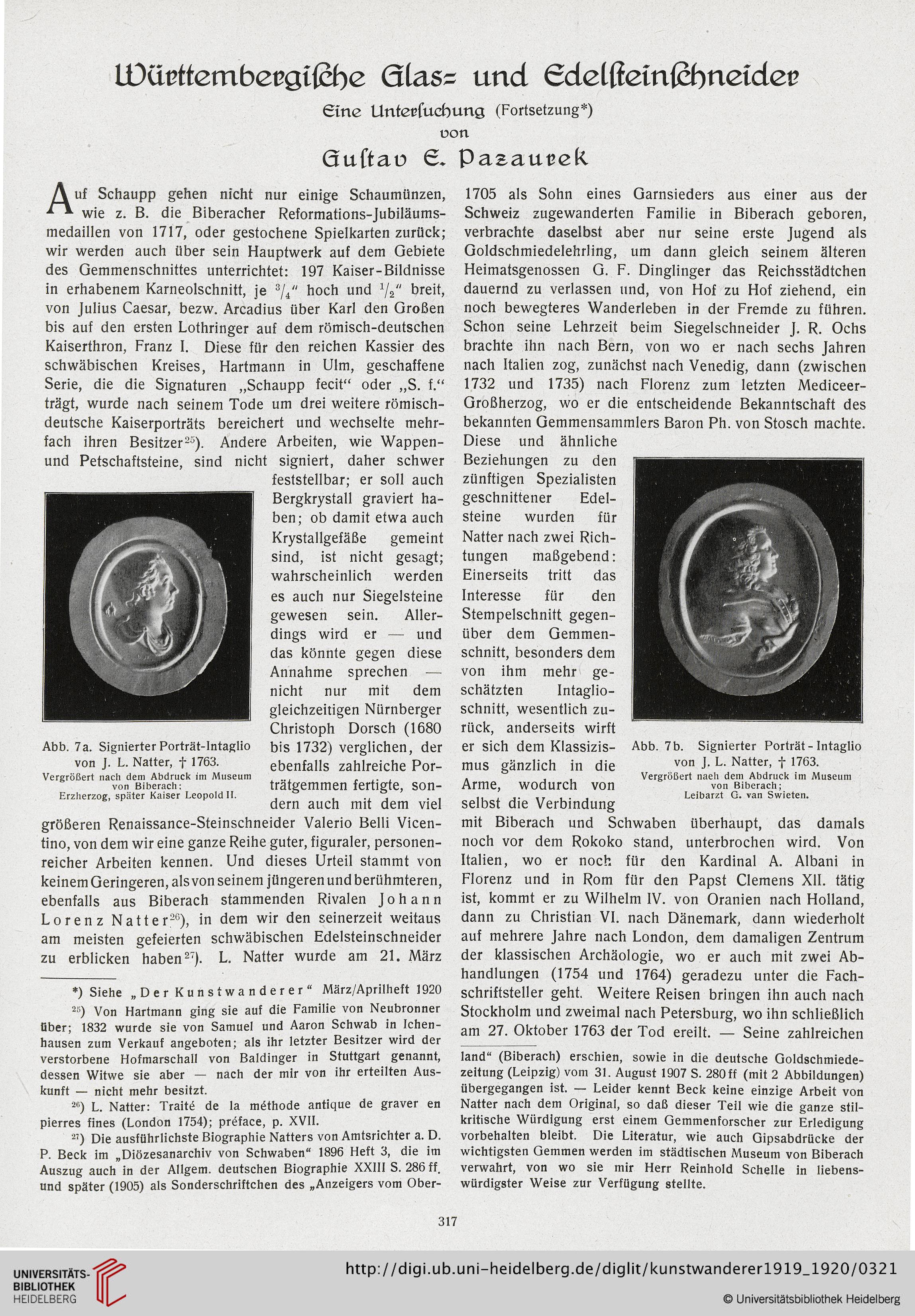LÜüt?ttembet?gt{cbe Glas? und edctßemlcbncidet?
eine Untecfucbung (Fortsetzung*)
oon
öuftaü 6. paEautJßk
A uf Schaupp gehen nicht nur einige Schaumünzen,
wie z. B. die Biberacher Reformations-Jubiläums-
medaillen von 1717, oder gestochene Spielkarten zurück;
wir werden auch über sein Hauptwerk auf dem Gebiete
des Gemmenschnittes unterrichtet: 197 Kaiser-Bildnisse
in erhabenem Karneolschnitt, je 3/4" hoch und 1j&" breit,
von Julius Caesar, bezw. Arcadius über Karl den Großen
bis auf den ersten Lothringer auf dem römisch-deutschen
Kaiserthron, Franz 1. Diese für den reichen Kassier des
schwäbischen Kreises, Hartmann in Ulm, geschaffene
Serie, die die Signaturen „Schaupp fecit“ oder „S. f.“
trägt, wurde nach seinem Tode um drei weitere römisch-
deutsche Kaiserporträts bereichert und wechselte mehr-
fach ihren Besitzer25). Andere Arbeiten, wie Wappen-
und Petschaftsteine, sind nicht signiert, daher schwer
feststellbar; er soll auch
Bergkrystall graviert ha-
ben; ob damit etwa auch
Krystallgefäße gemeint
sind, ist nicht gesagt;
wahrscheinlich werden
es auch nur Siegelsteine
gewesen sein. Aller-
dings wird er — und
das könnte gegen diese
Annahme sprechen —
nicht nur mit dem
gleichzeitigen Nürnberger
Christoph Dorsch (1680
bis 1732) verglichen, der
ebenfalls zahlreiche Por-
trätgemmen fertigte, son-
dern auch mit dem viel
größeren Renaissance-Steinschneider Valerio Belli Vicen-
tino, von dem wir eine ganze Reihe guter, figuraler, personen-
reicher Arbeiten kennen. Und dieses Urteil stammt von
keinem Geringeren, als von seinem jüngeren und berühmteren,
ebenfalls aus Biberach stammenden Rivalen Johann
Lorenz Natter26), in dem wir den seinerzeit weitaus
am meisten gefeierten schwäbischen Edelsteinschneider
zu erblicken haben27). L. Natter wurde am 21. März
*) Siehe „Der Kunstwanderer“ März/Aprilheft 1920
25) Von Hartmann ging sie auf die Familie von Neubronner
über; 1832 wurde sie von Samuel und Aaron Schwab in Ichen-
hausen zum Verkauf angeboten; als ihr letzter Besitzer wird der
verstorbene Hofmarschall von Baidinger in Stuttgart genannt,
dessen Witwe sie aber — nach der mir von ihr erteilten Aus-
kunft — nicht mehr besitzt.
26) L. Natter: Traitd de la mdthode antique de graver en
pierres fines (London 1754); pröface, p. XVII.
2;) Die ausführlichste Biographie Natters von Amtsrichter a. D.
P. Beck im „Diözesanarchiv von Schwaben“ 1896 Heft 3, die im
Auszug auch in der Allgem. deutschen Biographie XXIII S. 286 ff.
und später (1905) als Sonderschriftchen des „Anzeigers vom Ober-
1705 als Sohn eines Garnsieders aus einer aus der
Schweiz zugewanderten Familie in Biberach geboren,
verbrachte daselbst aber nur seine erste Jugend als
Goldschmiedelehrling, um dann gleich seinem älteren
Heimatsgenossen G. F. Dinglinger das Reichsstädtchen
dauernd zu verlassen und, von Hof zu Hof ziehend, ein
noch bewegteres Wanderleben in der Fremde zu führen.
Schon seine Lehrzeit beim Siegelschneider J. R. Ochs
brachte ihn nach Bern, von wo er nach sechs Jahren
nach Italien zog, zunächst nach Venedig, dann (zwischen
1732 und 1735) nach Florenz zum letzten Mediceer-
Großherzog, wo er die entscheidende Bekanntschaft des
bekannten Gemmensammlers Baron Ph. von Stosch machte.
Diese und ähnliche
Beziehungen zu den
zünftigen Spezialisten
geschnittener Edel-
steine wurden für
Natter nach zwei Rich-
tungen maßgebend:
Einerseits tritt das
Interesse für den
Stempelschnitt gegen-
über dem Gemmen-
schnitt, besonders dem
von ihm mehr ge-
schätzten Intaglio-
schnitt, wesentlich zu-
rück, anderseits wirft
er sich dem Klassizis-
mus gänzlich in die
Arme, wodurch von
selbst die Verbindung
mit Biberach und Schwaben überhaupt, das damals
noch vor dem Rokoko stand, unterbrochen wird. Von
Italien, wo er noch für den Kardinal A. Albani in
Florenz und in Rom für den Papst Clemens XII. tätig
ist, kommt er zu Wilhelm IV. von Oranien nach Holland,
dann zu Christian VI. nach Dänemark, dann wiederholt
auf mehrere Jahre nach London, dem damaligen Zentrum
der klassischen Archäologie, wo er auch mit zwei Ab-
handlungen (1754 und 1764) geradezu unter die Fach-
schriftsteller geht. Weitere Reisen bringen ihn auch nach
Stockholm und zweimal nach Petersburg, wo ihn schließlich
am 27. Oktober 1763 der Tod ereilt. — Seine zahlreichen
land“ (Biberach) erschien, sowie in die deutsche Goldschmiede-
zeitung (Leipzig) vom 31. August 1907 S. 280 ff (mit 2 Abbildungen)
übergegangen ist. — Leider kennt Beck keine einzige Arbeit von
Natter nach dem Original, so daß dieser Teil wie die ganze stil-
kritische Würdigung erst einem Gemmenforscher zur Erledigung
Vorbehalten bleibt. Die Literatur, wie auch Gipsabdrücke der
wichtigsten Gemmen werden im städtischen Museum von Biberach
verwahrt, von wo sie mir Herr Reinhold Schelle in liebens-
würdigster Weise zur Verfügung stellte.
Abb. 7a. Signierter Porträt-Intaglio
von J. L. Natter, f 1763.
Vergrößert nach dem Abdruck im Museum
von Biberach:
Erzherzog, später Kaiser Leopold II.
Abb. 7b. Signierter Porträt-Intaglio
von J. L. Natter, f 1763.
Vergrößert naeh dem Abdruck im Museum
von Biberach;
Leibarzt G. van Swieten.
317
eine Untecfucbung (Fortsetzung*)
oon
öuftaü 6. paEautJßk
A uf Schaupp gehen nicht nur einige Schaumünzen,
wie z. B. die Biberacher Reformations-Jubiläums-
medaillen von 1717, oder gestochene Spielkarten zurück;
wir werden auch über sein Hauptwerk auf dem Gebiete
des Gemmenschnittes unterrichtet: 197 Kaiser-Bildnisse
in erhabenem Karneolschnitt, je 3/4" hoch und 1j&" breit,
von Julius Caesar, bezw. Arcadius über Karl den Großen
bis auf den ersten Lothringer auf dem römisch-deutschen
Kaiserthron, Franz 1. Diese für den reichen Kassier des
schwäbischen Kreises, Hartmann in Ulm, geschaffene
Serie, die die Signaturen „Schaupp fecit“ oder „S. f.“
trägt, wurde nach seinem Tode um drei weitere römisch-
deutsche Kaiserporträts bereichert und wechselte mehr-
fach ihren Besitzer25). Andere Arbeiten, wie Wappen-
und Petschaftsteine, sind nicht signiert, daher schwer
feststellbar; er soll auch
Bergkrystall graviert ha-
ben; ob damit etwa auch
Krystallgefäße gemeint
sind, ist nicht gesagt;
wahrscheinlich werden
es auch nur Siegelsteine
gewesen sein. Aller-
dings wird er — und
das könnte gegen diese
Annahme sprechen —
nicht nur mit dem
gleichzeitigen Nürnberger
Christoph Dorsch (1680
bis 1732) verglichen, der
ebenfalls zahlreiche Por-
trätgemmen fertigte, son-
dern auch mit dem viel
größeren Renaissance-Steinschneider Valerio Belli Vicen-
tino, von dem wir eine ganze Reihe guter, figuraler, personen-
reicher Arbeiten kennen. Und dieses Urteil stammt von
keinem Geringeren, als von seinem jüngeren und berühmteren,
ebenfalls aus Biberach stammenden Rivalen Johann
Lorenz Natter26), in dem wir den seinerzeit weitaus
am meisten gefeierten schwäbischen Edelsteinschneider
zu erblicken haben27). L. Natter wurde am 21. März
*) Siehe „Der Kunstwanderer“ März/Aprilheft 1920
25) Von Hartmann ging sie auf die Familie von Neubronner
über; 1832 wurde sie von Samuel und Aaron Schwab in Ichen-
hausen zum Verkauf angeboten; als ihr letzter Besitzer wird der
verstorbene Hofmarschall von Baidinger in Stuttgart genannt,
dessen Witwe sie aber — nach der mir von ihr erteilten Aus-
kunft — nicht mehr besitzt.
26) L. Natter: Traitd de la mdthode antique de graver en
pierres fines (London 1754); pröface, p. XVII.
2;) Die ausführlichste Biographie Natters von Amtsrichter a. D.
P. Beck im „Diözesanarchiv von Schwaben“ 1896 Heft 3, die im
Auszug auch in der Allgem. deutschen Biographie XXIII S. 286 ff.
und später (1905) als Sonderschriftchen des „Anzeigers vom Ober-
1705 als Sohn eines Garnsieders aus einer aus der
Schweiz zugewanderten Familie in Biberach geboren,
verbrachte daselbst aber nur seine erste Jugend als
Goldschmiedelehrling, um dann gleich seinem älteren
Heimatsgenossen G. F. Dinglinger das Reichsstädtchen
dauernd zu verlassen und, von Hof zu Hof ziehend, ein
noch bewegteres Wanderleben in der Fremde zu führen.
Schon seine Lehrzeit beim Siegelschneider J. R. Ochs
brachte ihn nach Bern, von wo er nach sechs Jahren
nach Italien zog, zunächst nach Venedig, dann (zwischen
1732 und 1735) nach Florenz zum letzten Mediceer-
Großherzog, wo er die entscheidende Bekanntschaft des
bekannten Gemmensammlers Baron Ph. von Stosch machte.
Diese und ähnliche
Beziehungen zu den
zünftigen Spezialisten
geschnittener Edel-
steine wurden für
Natter nach zwei Rich-
tungen maßgebend:
Einerseits tritt das
Interesse für den
Stempelschnitt gegen-
über dem Gemmen-
schnitt, besonders dem
von ihm mehr ge-
schätzten Intaglio-
schnitt, wesentlich zu-
rück, anderseits wirft
er sich dem Klassizis-
mus gänzlich in die
Arme, wodurch von
selbst die Verbindung
mit Biberach und Schwaben überhaupt, das damals
noch vor dem Rokoko stand, unterbrochen wird. Von
Italien, wo er noch für den Kardinal A. Albani in
Florenz und in Rom für den Papst Clemens XII. tätig
ist, kommt er zu Wilhelm IV. von Oranien nach Holland,
dann zu Christian VI. nach Dänemark, dann wiederholt
auf mehrere Jahre nach London, dem damaligen Zentrum
der klassischen Archäologie, wo er auch mit zwei Ab-
handlungen (1754 und 1764) geradezu unter die Fach-
schriftsteller geht. Weitere Reisen bringen ihn auch nach
Stockholm und zweimal nach Petersburg, wo ihn schließlich
am 27. Oktober 1763 der Tod ereilt. — Seine zahlreichen
land“ (Biberach) erschien, sowie in die deutsche Goldschmiede-
zeitung (Leipzig) vom 31. August 1907 S. 280 ff (mit 2 Abbildungen)
übergegangen ist. — Leider kennt Beck keine einzige Arbeit von
Natter nach dem Original, so daß dieser Teil wie die ganze stil-
kritische Würdigung erst einem Gemmenforscher zur Erledigung
Vorbehalten bleibt. Die Literatur, wie auch Gipsabdrücke der
wichtigsten Gemmen werden im städtischen Museum von Biberach
verwahrt, von wo sie mir Herr Reinhold Schelle in liebens-
würdigster Weise zur Verfügung stellte.
Abb. 7a. Signierter Porträt-Intaglio
von J. L. Natter, f 1763.
Vergrößert nach dem Abdruck im Museum
von Biberach:
Erzherzog, später Kaiser Leopold II.
Abb. 7b. Signierter Porträt-Intaglio
von J. L. Natter, f 1763.
Vergrößert naeh dem Abdruck im Museum
von Biberach;
Leibarzt G. van Swieten.
317