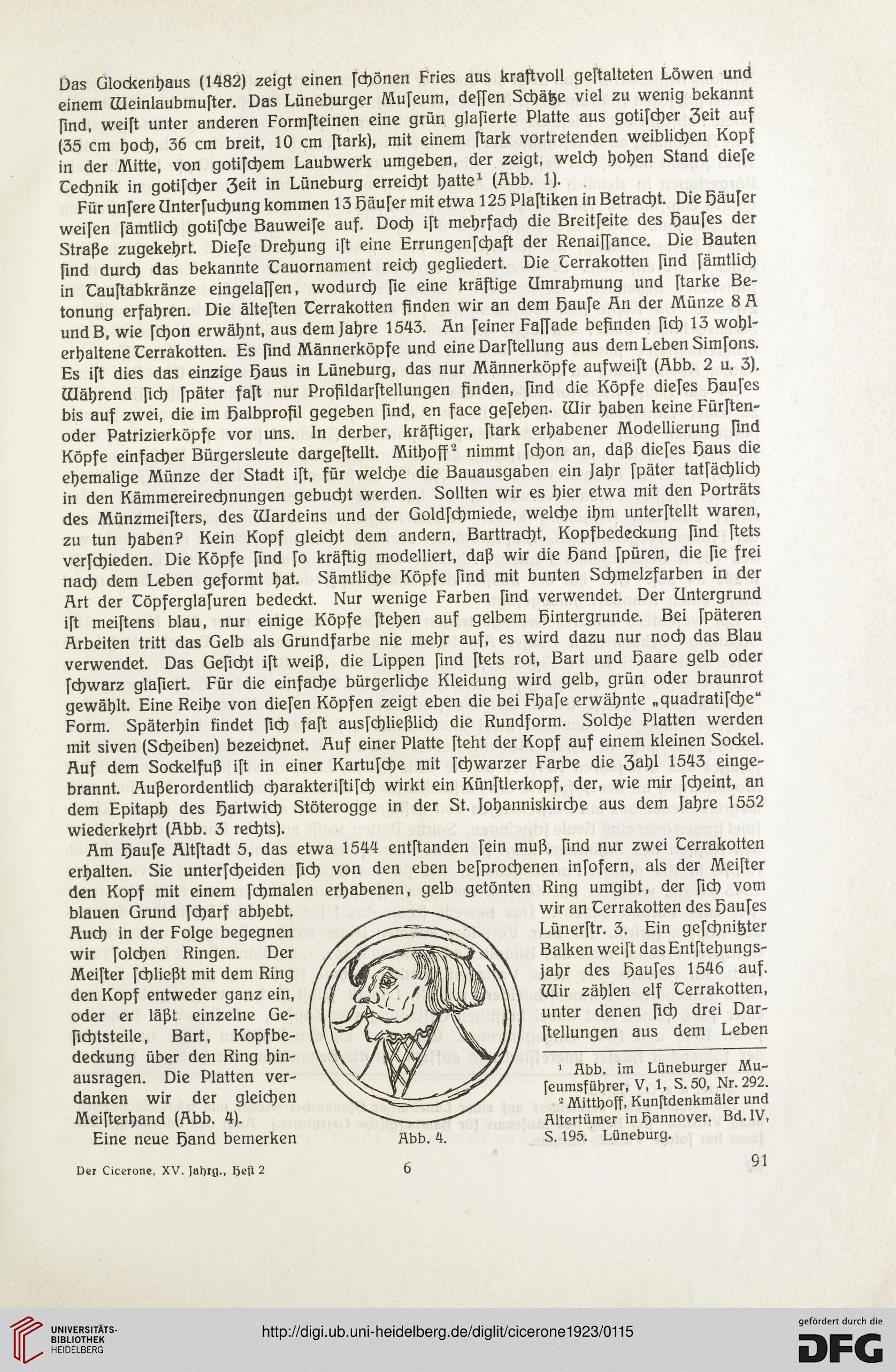Das Glockenbaus (1482) zeigt einen [dtjönen Fries aus kraftvoll geftalteten Löwen und
einem tüeinlaubmufter. Das Lüneburger Mufeum, deffen Scbä&e viel zu wenig bekannt
find, weift unter anderen Formfteinen eine grün glaflerte Platte aus gotifdjer 3eit auf
(35 cm hoch, 36 cm breit, 10 cm ftark), mit einem ftark vortretenden weiblichen Kopf
in der Mitte, von gotifd)em Laubwerk umgeben, der zeigt, welch hoben Stand diefe
Technik in gotifdjer 3eit in Lüneburg erreicht hatte1 (Äbb. 1).
Für unfere Unterfucbung kommen 13 Däufer mit etwa 125 Plaftiken in Betracht. Die Däufer
weifen fämtlich gotifdje Bauweife auf. Doch ift mehrfach die Breitfeite des Daufes der
Straße zugekehrt. Diefe Drehung ift eine Errungenfchaft der Renaiffance. Die Bauten
find durch das bekannte Tauornament reich gegliedert. Die Terrakotten pnd fämtlich
in Tauftabkränze eingela^en, wodurch pe eine kräpige Umrahmung und ftarke Be-
tonung erfahren. Die älteften Terrakotten pnden wir an dem Fjaufe der Münze 8 Ä
undB, wie fdjon erwähnt, aus dem Jahre 1543. Än feiner Fapade bepnden pch 13 wohl-
erhaltene Terrakotten. Es pnd Männerköpfe und eine Darftellung aus dem Leben Simfons.
Es ift dies das einzige Daus in Lüneburg, das nur Männerköpfe aufweift (Äbb. 2 u. 3).
CUährend pch fpäter faft nur Propldarftellungen pnden, pnd die Köpfe diefes Daufes
bis auf zwei, die im Fjalbproßl gegeben pnd, en face gefehen. Ulir haben keine Fürften-
oder Patrizierköpfe vor uns. In derber, kräpiger, ftark erhabener Modellierung pnd
Köpfe einfacher Bürgersleute dargeftellt. Mithop2 nimmt fetjon an, daß diefes Daus die
ehemalige Münze der Stadt ift, für welche die Bauausgaben ein Jahr fpäter tatsächlich
in den Kämmereirechnungen gebucht werden. Sollten wir es hier etwa mit den Porträts
des Münzmeifters, des Ulardeins und der Goldfehmiede, welche ihm unterteilt waren,
zu tun haben? Kein Kopf gleicht dem andern, Barttracht, Kopfbedeckung pnd ftets
verfchieden. Die Köpfe find fo kräpig modelliert, daß wir die Dand fpüren, die pe frei
nach dem Leben geformt hat. Sämtliche Köpfe pnd mit bunten Schmelzfarben in der
Ärt der Töpferglafuren bedeckt. Nur wenige Farben find verwendet. Der Untergrund
ift meiftens blau, nur einige Köpfe pepen auf gelbem Dintergrunde. Bei fpäteren
Arbeiten tritt das Gelb als Grundfarbe nie mehr auf, es wird dazu nur noch das Blau
verwendet. Das Gepdp ift weiß, die Lippen pnd ftets rot, Bart und Daare gelb oder
fchwarz glapert. Für die einfache bürgerliche Kleidung wird gelb, grün oder braunrot
gewählt. Eine Reihe von diefen Köpfen zeigt eben die bei Fhafe erwähnte „quadratifche“
Form. Späterhin findet pch faft ausfchließlich die Rundform. Solche Platten werden
mit siven (Scheiben) bezeichnet. Äuf einer Platte fteht der Kopf auf einem kleinen Sockel.
Äuf dem Sockelfuß ift in einer Kartufcße mit fcpwarzer Farbe die 3aßl 1543 einge-
brannt. Außerordentlich charakteriftifd) wirkt ein Künftlerkopf, der, wie mir fcheint, an
dem Epitaph des Dartwicp Stöterogge in der St. Johanniskirche aus dem Jahre 1552
wiederkehrt (Äbb. 3 rechts).
Am Daufe Ältftadt 5, das etwa 1544 entftanden fein muß, pnd nur zwei Terrakotten
erhalten. Sie unterfcheiden pch von den eben befproepenen infofern, als der Meifter
den Kopf mit einem fchmalen erhabenen, gelb getönten Ring umgibt, der pch vom
blauen Grund feparf abhebt.
Auch in der Folge begegnen
wir folchen Ringen. Der
Meifter fdpießt mit dem Ring
den Kopf entweder ganz ein,
oder er läßt einzelne Ge-
pchtsteile, Bart, Kopfbe-
deckung über den Ring hin-
ausragen. Die Platten ver-
danken wir der gleichen
Meifterhand (Äbb. 4).
Eine neue Dand bemerken
Der Cicerone, XV. Jabrfl., f)efl 2
wir an Terrakotten des Daufes
Lünerftr. 3. Ein gefcpnitjter
Balken weift das Entftepungs-
jahr des Daufes 1546 auf.
ödir zählen elf Terrakotten,
unter denen pch drei Dar-
ftellungen aus dem Leben
1 Hbb. im Lüneburger Mu-
feumsfübrer, V, 1, S. 50, Nr. 292.
3 Mittboff, Kunftdenkmäler und
Altertümer inDannover- Bd. IV,
S. 195. Lüneburg.
6 91
einem tüeinlaubmufter. Das Lüneburger Mufeum, deffen Scbä&e viel zu wenig bekannt
find, weift unter anderen Formfteinen eine grün glaflerte Platte aus gotifdjer 3eit auf
(35 cm hoch, 36 cm breit, 10 cm ftark), mit einem ftark vortretenden weiblichen Kopf
in der Mitte, von gotifd)em Laubwerk umgeben, der zeigt, welch hoben Stand diefe
Technik in gotifdjer 3eit in Lüneburg erreicht hatte1 (Äbb. 1).
Für unfere Unterfucbung kommen 13 Däufer mit etwa 125 Plaftiken in Betracht. Die Däufer
weifen fämtlich gotifdje Bauweife auf. Doch ift mehrfach die Breitfeite des Daufes der
Straße zugekehrt. Diefe Drehung ift eine Errungenfchaft der Renaiffance. Die Bauten
find durch das bekannte Tauornament reich gegliedert. Die Terrakotten pnd fämtlich
in Tauftabkränze eingela^en, wodurch pe eine kräpige Umrahmung und ftarke Be-
tonung erfahren. Die älteften Terrakotten pnden wir an dem Fjaufe der Münze 8 Ä
undB, wie fdjon erwähnt, aus dem Jahre 1543. Än feiner Fapade bepnden pch 13 wohl-
erhaltene Terrakotten. Es pnd Männerköpfe und eine Darftellung aus dem Leben Simfons.
Es ift dies das einzige Daus in Lüneburg, das nur Männerköpfe aufweift (Äbb. 2 u. 3).
CUährend pch fpäter faft nur Propldarftellungen pnden, pnd die Köpfe diefes Daufes
bis auf zwei, die im Fjalbproßl gegeben pnd, en face gefehen. Ulir haben keine Fürften-
oder Patrizierköpfe vor uns. In derber, kräpiger, ftark erhabener Modellierung pnd
Köpfe einfacher Bürgersleute dargeftellt. Mithop2 nimmt fetjon an, daß diefes Daus die
ehemalige Münze der Stadt ift, für welche die Bauausgaben ein Jahr fpäter tatsächlich
in den Kämmereirechnungen gebucht werden. Sollten wir es hier etwa mit den Porträts
des Münzmeifters, des Ulardeins und der Goldfehmiede, welche ihm unterteilt waren,
zu tun haben? Kein Kopf gleicht dem andern, Barttracht, Kopfbedeckung pnd ftets
verfchieden. Die Köpfe find fo kräpig modelliert, daß wir die Dand fpüren, die pe frei
nach dem Leben geformt hat. Sämtliche Köpfe pnd mit bunten Schmelzfarben in der
Ärt der Töpferglafuren bedeckt. Nur wenige Farben find verwendet. Der Untergrund
ift meiftens blau, nur einige Köpfe pepen auf gelbem Dintergrunde. Bei fpäteren
Arbeiten tritt das Gelb als Grundfarbe nie mehr auf, es wird dazu nur noch das Blau
verwendet. Das Gepdp ift weiß, die Lippen pnd ftets rot, Bart und Daare gelb oder
fchwarz glapert. Für die einfache bürgerliche Kleidung wird gelb, grün oder braunrot
gewählt. Eine Reihe von diefen Köpfen zeigt eben die bei Fhafe erwähnte „quadratifche“
Form. Späterhin findet pch faft ausfchließlich die Rundform. Solche Platten werden
mit siven (Scheiben) bezeichnet. Äuf einer Platte fteht der Kopf auf einem kleinen Sockel.
Äuf dem Sockelfuß ift in einer Kartufcße mit fcpwarzer Farbe die 3aßl 1543 einge-
brannt. Außerordentlich charakteriftifd) wirkt ein Künftlerkopf, der, wie mir fcheint, an
dem Epitaph des Dartwicp Stöterogge in der St. Johanniskirche aus dem Jahre 1552
wiederkehrt (Äbb. 3 rechts).
Am Daufe Ältftadt 5, das etwa 1544 entftanden fein muß, pnd nur zwei Terrakotten
erhalten. Sie unterfcheiden pch von den eben befproepenen infofern, als der Meifter
den Kopf mit einem fchmalen erhabenen, gelb getönten Ring umgibt, der pch vom
blauen Grund feparf abhebt.
Auch in der Folge begegnen
wir folchen Ringen. Der
Meifter fdpießt mit dem Ring
den Kopf entweder ganz ein,
oder er läßt einzelne Ge-
pchtsteile, Bart, Kopfbe-
deckung über den Ring hin-
ausragen. Die Platten ver-
danken wir der gleichen
Meifterhand (Äbb. 4).
Eine neue Dand bemerken
Der Cicerone, XV. Jabrfl., f)efl 2
wir an Terrakotten des Daufes
Lünerftr. 3. Ein gefcpnitjter
Balken weift das Entftepungs-
jahr des Daufes 1546 auf.
ödir zählen elf Terrakotten,
unter denen pch drei Dar-
ftellungen aus dem Leben
1 Hbb. im Lüneburger Mu-
feumsfübrer, V, 1, S. 50, Nr. 292.
3 Mittboff, Kunftdenkmäler und
Altertümer inDannover- Bd. IV,
S. 195. Lüneburg.
6 91