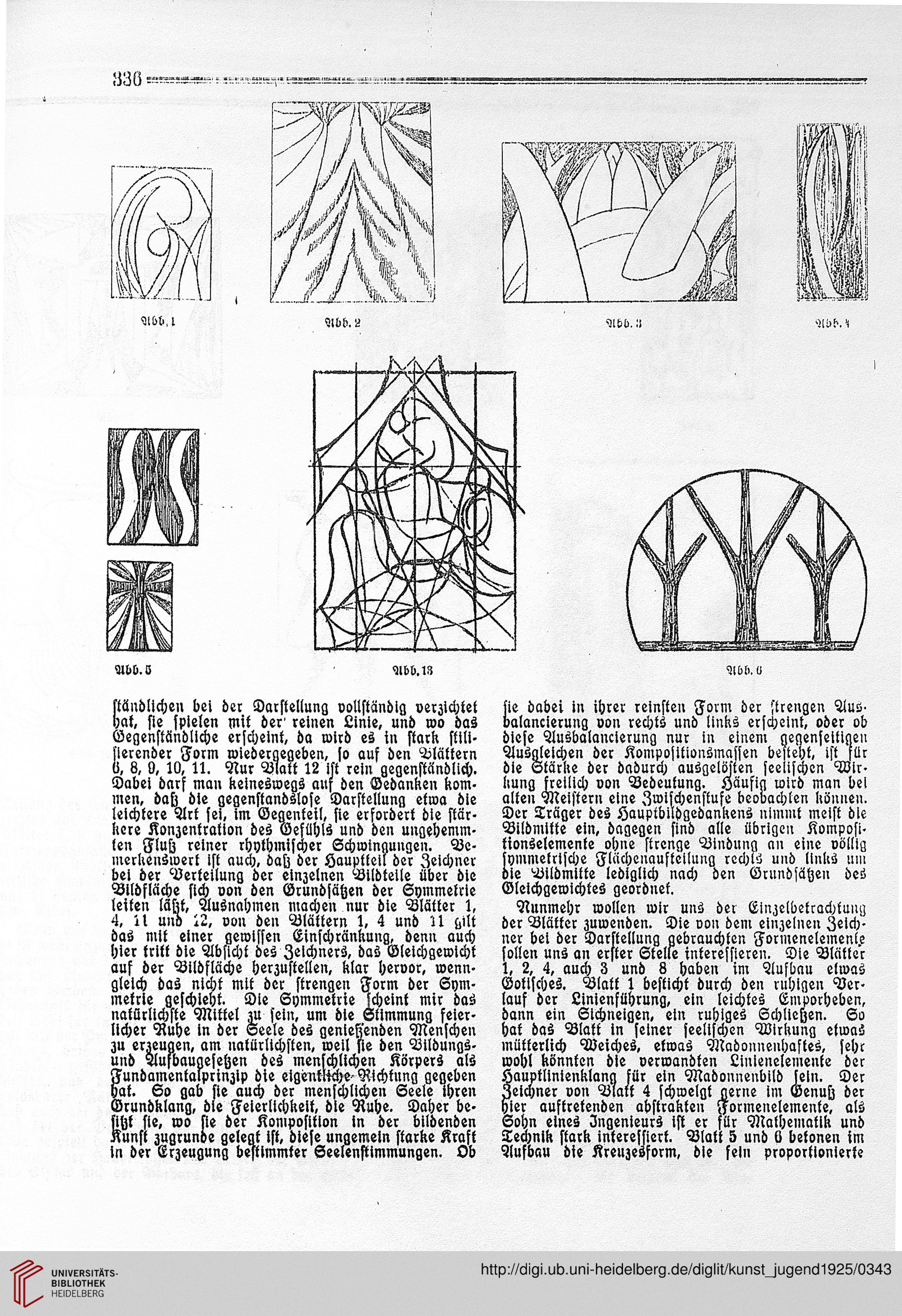Bund Deutscher Kunsterzieher [Hrsg.]
Kunst und Jugend
— N.F. 5.1925
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.22865#0343
DOI Heft:
Heft 12 (Dezember 1925)
DOI Artikel:Könitzer, Paul: Wege zur Seele des Kunstwerkes: Zeichnen und Kunstbetrachtung in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung und Befruchtung, ein Lehrgespräch auf der Oberstufe
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.22865#0343
Abb.ü
Abb. U
ständlichen bei der Darftellung vollständlg verzichtet
yat, sie splelen mit der^ reinen Linie, und wo das
Gegenständliche erscheint, da wird es in stark stili.
slerender Form wiedergegsben, so auf den Blältern
ti, 6, 0, 10, 11. Nur Blatt 12 Ist rein gegenständlich.
Dabei darf ma» keineswegs a»f den Gedanken kom-
men, dak die gegenstandslose Darstejlung elwa die
leichtere Art sei, im Gegenteil, sie erfordert die stär-
kere Konzentration des Geftihls und den ungehemm-
ten Flusz reiner rhythmischer Schwinaungen. Be-
inerkenSwert Ist auch, bast der Hauvkteil der Zeichner
bei der Berteilung der einzelnen Bildteile über die
Bildfläche sich von den Grundsätzen der Symmelrie
leiten läht, Ausnahmen machen nur die Blätlsr 1,
4, 1l uns 12, von den Blättern 1, 4 und 11 gilt
das mit einer gewissen Einschränkung, dsnn auch
hier trilt dis Absicht des ZelchnerS, das Gleichgewicht
auf dsr Bildflächs herzustellen, klar hervor, wenn-
gleich das nicht mit der strengen Form der Sym-
mekrle geschieht. Die Symmetrie Zcheint mir das
natürlichste Mittel zu setn, um die Stlmmung feier-
licher Ruhe in der Seele des genieffenden Menschen
zu erzeugen, am nalürlichsten, weil fle den Vildungs-
und Aufbauaesetzen des menschlichen Körpers als
Fundamenkalprinzip die eigentttche-Nichtung gegeben
hat. So gab sie auch der menschlichen Seele ihren
Drundklang, die Feierlichkeit, die Ruhe. Daher be-
sttzt sie, wo ste der Komposition in der bildenden
Kunst zugrunde gelegt ist, diese ungemein starke Kraft
in der Erzeugung destimmter Seelenstimmungen. Ob
sie dabei in ihrer reinsten Form Ler strengen Aus-
balanclerung von rechts und links erscheint, oder ob
diese Ausbalanclerung nur in eineni gegenseitigeii
Ausgleichen der Kompositionsmassen beneht, ist llr
dle Vkärke der dadurch ausgelösten seelischen Wir-
kung freilich von Bedeukung. Zäufig wird man bei
alten Meistern eine Zwischenskufe beobachten können.
Der Träger des Hauplbildgedankens nlmmt meist die
Bildmitte ein, dagegen sind alle übrigcn Komposi-
tionselemente ohne strenge Binduna an eine völlig
symmekrische Flüchenaufteilung rechls und links um
die Bildmitte lediglich nach den Grundsätzen des
Gleichgewichtes geordnet.
Nunmehr wollen wir uns der Einzelbekrachtung
der Blätker zuwenden. Die von dem einzelnen Zelch-
ner bei der Darstellung gebrauchken Formenelsmenl.e
sollen uns an erster Stelle interessieren. Die Blätter
1, 2, 4, auch 3 und 8 haben im Aufbau elwas
Gotisches. Blatk 1 besticht durch den ruhigen Ber-
lauf der Linienführung, ein leichtes Emporheben,
dann ein Sichneigen, ein ruhiges Schliegen. So
hat das Blatt in seiner seelischen Wirkung etwaS
mütterlich Weiches, ekwas Madonnenhaftes, sehc
wohl könnken die verwandtsn Linlenelemenke der
Hauvtlinienklang für ein Madonnenbild sein. Der
Zeichner von Blakt 4 schwelgk gerne im Genutz der
hier auftrekenden abstrakken Formenelemente. als
Sohn eines tzngenieurs ist er für Malhemakik und
Technik stark inkeressierk. Blatt 5 und ü bekonen im
Aufbau die Kreuzesform, die fein proportionierte
Abb. U
ständlichen bei der Darftellung vollständlg verzichtet
yat, sie splelen mit der^ reinen Linie, und wo das
Gegenständliche erscheint, da wird es in stark stili.
slerender Form wiedergegsben, so auf den Blältern
ti, 6, 0, 10, 11. Nur Blatt 12 Ist rein gegenständlich.
Dabei darf ma» keineswegs a»f den Gedanken kom-
men, dak die gegenstandslose Darstejlung elwa die
leichtere Art sei, im Gegenteil, sie erfordert die stär-
kere Konzentration des Geftihls und den ungehemm-
ten Flusz reiner rhythmischer Schwinaungen. Be-
inerkenSwert Ist auch, bast der Hauvkteil der Zeichner
bei der Berteilung der einzelnen Bildteile über die
Bildfläche sich von den Grundsätzen der Symmelrie
leiten läht, Ausnahmen machen nur die Blätlsr 1,
4, 1l uns 12, von den Blättern 1, 4 und 11 gilt
das mit einer gewissen Einschränkung, dsnn auch
hier trilt dis Absicht des ZelchnerS, das Gleichgewicht
auf dsr Bildflächs herzustellen, klar hervor, wenn-
gleich das nicht mit der strengen Form der Sym-
mekrle geschieht. Die Symmetrie Zcheint mir das
natürlichste Mittel zu setn, um die Stlmmung feier-
licher Ruhe in der Seele des genieffenden Menschen
zu erzeugen, am nalürlichsten, weil fle den Vildungs-
und Aufbauaesetzen des menschlichen Körpers als
Fundamenkalprinzip die eigentttche-Nichtung gegeben
hat. So gab sie auch der menschlichen Seele ihren
Drundklang, die Feierlichkeit, die Ruhe. Daher be-
sttzt sie, wo ste der Komposition in der bildenden
Kunst zugrunde gelegt ist, diese ungemein starke Kraft
in der Erzeugung destimmter Seelenstimmungen. Ob
sie dabei in ihrer reinsten Form Ler strengen Aus-
balanclerung von rechts und links erscheint, oder ob
diese Ausbalanclerung nur in eineni gegenseitigeii
Ausgleichen der Kompositionsmassen beneht, ist llr
dle Vkärke der dadurch ausgelösten seelischen Wir-
kung freilich von Bedeukung. Zäufig wird man bei
alten Meistern eine Zwischenskufe beobachten können.
Der Träger des Hauplbildgedankens nlmmt meist die
Bildmitte ein, dagegen sind alle übrigcn Komposi-
tionselemente ohne strenge Binduna an eine völlig
symmekrische Flüchenaufteilung rechls und links um
die Bildmitte lediglich nach den Grundsätzen des
Gleichgewichtes geordnet.
Nunmehr wollen wir uns der Einzelbekrachtung
der Blätker zuwenden. Die von dem einzelnen Zelch-
ner bei der Darstellung gebrauchken Formenelsmenl.e
sollen uns an erster Stelle interessieren. Die Blätter
1, 2, 4, auch 3 und 8 haben im Aufbau elwas
Gotisches. Blatk 1 besticht durch den ruhigen Ber-
lauf der Linienführung, ein leichtes Emporheben,
dann ein Sichneigen, ein ruhiges Schliegen. So
hat das Blatt in seiner seelischen Wirkung etwaS
mütterlich Weiches, ekwas Madonnenhaftes, sehc
wohl könnken die verwandtsn Linlenelemenke der
Hauvtlinienklang für ein Madonnenbild sein. Der
Zeichner von Blakt 4 schwelgk gerne im Genutz der
hier auftrekenden abstrakken Formenelemente. als
Sohn eines tzngenieurs ist er für Malhemakik und
Technik stark inkeressierk. Blatt 5 und ü bekonen im
Aufbau die Kreuzesform, die fein proportionierte