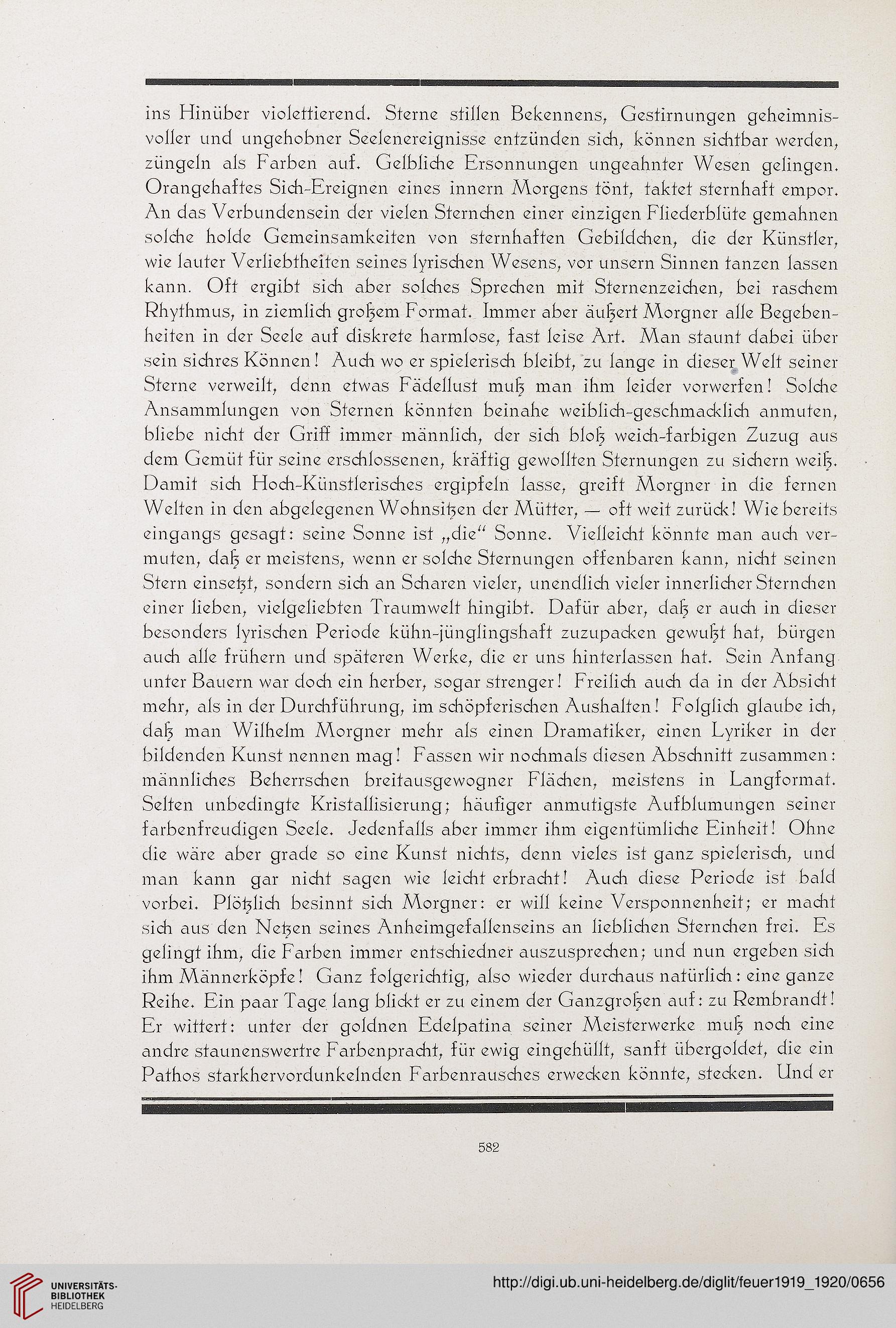Feuer: Monatsschrift für Kunst und künstlerische Kultur — 1.1919/1920
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.29152#0656
DOI Heft:
Mai-Heft
DOI Artikel:Däubler, Theodor: Wilhelm Morgner
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.29152#0656
ins Hinüber violettierend. Sterne stillen Bekennens, Gestirnungen geheimnis-
voller und ungehobner Seelenereignisse entzünden sich, können sichtbar werden,
züngeln als Farben auf. Gelbliche Ersonnungen ungeahnter Wesen gelingen.
Orangehaftes Sich-Ereignen eines innern Morgens tönt, taktet sternhaft empor.
An das Verbundensein der vielen Sternchen einer einzigen Fliederblüte gemahnen
solche holde Gemeinsamkeiten von sternhaften Gebildchen, die der Künstler,
wie lauter Verliebtheiten seines lyrischen Wesens, vor unsern Sinnen tanzen lassen
kann. Oft ergibt sich aber solches Sprechen mit Sternenzeichen, bei raschem
Rhythmus, in ziemlich großem Format. Immer aber äußert Morgner alle Begeben-
heiten in der Seele auf diskrete harmlose, fast leise Art. Man staunt dabei über
sein sichres Können! Auch wo er spielerisch bleibt, zu lange in dieser Welt seiner
Sterne verweilt, denn etwas Fädellust mu| man ihm leider vorwerfen! Solche
Ansammlungen von Sternen könnten beinahe weiblich-geschmacklich anmuten,
bliebe nicht der Griff immer männlich, der sich blof> weich-farbigen Zuzug aus
dem Gemüt für seine erschlossenen, kräftig gewollten Sternungen zu sichern weih.
Damit sich Hoch-Künstlerisches ergipfeln lasse, greift Morgner in die fernen
Weifen in den abgelegenen Wohnsitzen der Mütter, — oft weit zurück! Wie bereits
eingangs gesagt: seine Sonne ist „die“ Sonne. Vielleicht könnte man auch ver-
muten, dah er meistens, wenn er solche Sfernungen offenbaren kann, nicht seinen
Stern einsehf, sondern sich an Scharen vieler, unendlich vieler innerlicher Sternchen
einer lieben, vielgeliebten Traumwelt hingibf. Dafür aber, dah er auch in dieser
besonders lyrisdien Periode kühn-jünglingshaft zuzupacken gewußt hat, bürgen
auch alle frühem und späteren Werke, die er uns hinterlassen hat. Sein Anfang
unter Bauern war doch ein herber, sogar strenger! Freilich auch da in der Absicht
mehr, als in der Durchführung, im sdiöpferisdien Aushalfen! Folglidi glaube ich,
dah man Wilhelm Morgner mehr als einen Dramatiker, einen Lyriker in der
bildenden Kunst nennen mag! Fassen wir nochmals diesen Abschnitt zusammen:
männliches Beherrschen breifausgewogner Flächen, meistens in Langformaf.
Seifen unbedingte Kristallisierung; häufiger anmutigste Aufblumungen seiner
farbenfreudigen Seele. Jedenfalls aber immer ihm eigentümliche Einheit! Ohne
die wäre aber grade so eine Kunst nichts, denn vieles ist ganz spielerisch, und
man kann gar nicht sagen wie leicht erbracht! Audi diese Periode ist bald
vorbei. PJötdich besinnt sich Morgner: er will keine Versponnenheif; er macht
sich aus den Netzen seines Anheimgefallenseins an lieblichen Sternchen frei. Es
gelingt ihm, die Farben immer entschiedner auszusprechen; und nun ergeben sich
ihm Männerköpfe! Ganz folgerichtig, also wieder durchaus natürlich: eine ganze
Reihe. Ein paar Tage lang blickt er zu einem der Ganzgroben auf: zu Rembrandt!
Er wittert: unter der goldnen Edelpatina seiner Meisterwerke mufz noch eine
andre staunenswerte Farbenpracht, für ewig eingehüilf, sanft übergoldet, die ein
Pathos sfarkhervordunkelnden Farbenrausches erwecken könnte, stecken. Und er
582
voller und ungehobner Seelenereignisse entzünden sich, können sichtbar werden,
züngeln als Farben auf. Gelbliche Ersonnungen ungeahnter Wesen gelingen.
Orangehaftes Sich-Ereignen eines innern Morgens tönt, taktet sternhaft empor.
An das Verbundensein der vielen Sternchen einer einzigen Fliederblüte gemahnen
solche holde Gemeinsamkeiten von sternhaften Gebildchen, die der Künstler,
wie lauter Verliebtheiten seines lyrischen Wesens, vor unsern Sinnen tanzen lassen
kann. Oft ergibt sich aber solches Sprechen mit Sternenzeichen, bei raschem
Rhythmus, in ziemlich großem Format. Immer aber äußert Morgner alle Begeben-
heiten in der Seele auf diskrete harmlose, fast leise Art. Man staunt dabei über
sein sichres Können! Auch wo er spielerisch bleibt, zu lange in dieser Welt seiner
Sterne verweilt, denn etwas Fädellust mu| man ihm leider vorwerfen! Solche
Ansammlungen von Sternen könnten beinahe weiblich-geschmacklich anmuten,
bliebe nicht der Griff immer männlich, der sich blof> weich-farbigen Zuzug aus
dem Gemüt für seine erschlossenen, kräftig gewollten Sternungen zu sichern weih.
Damit sich Hoch-Künstlerisches ergipfeln lasse, greift Morgner in die fernen
Weifen in den abgelegenen Wohnsitzen der Mütter, — oft weit zurück! Wie bereits
eingangs gesagt: seine Sonne ist „die“ Sonne. Vielleicht könnte man auch ver-
muten, dah er meistens, wenn er solche Sfernungen offenbaren kann, nicht seinen
Stern einsehf, sondern sich an Scharen vieler, unendlich vieler innerlicher Sternchen
einer lieben, vielgeliebten Traumwelt hingibf. Dafür aber, dah er auch in dieser
besonders lyrisdien Periode kühn-jünglingshaft zuzupacken gewußt hat, bürgen
auch alle frühem und späteren Werke, die er uns hinterlassen hat. Sein Anfang
unter Bauern war doch ein herber, sogar strenger! Freilich auch da in der Absicht
mehr, als in der Durchführung, im sdiöpferisdien Aushalfen! Folglidi glaube ich,
dah man Wilhelm Morgner mehr als einen Dramatiker, einen Lyriker in der
bildenden Kunst nennen mag! Fassen wir nochmals diesen Abschnitt zusammen:
männliches Beherrschen breifausgewogner Flächen, meistens in Langformaf.
Seifen unbedingte Kristallisierung; häufiger anmutigste Aufblumungen seiner
farbenfreudigen Seele. Jedenfalls aber immer ihm eigentümliche Einheit! Ohne
die wäre aber grade so eine Kunst nichts, denn vieles ist ganz spielerisch, und
man kann gar nicht sagen wie leicht erbracht! Audi diese Periode ist bald
vorbei. PJötdich besinnt sich Morgner: er will keine Versponnenheif; er macht
sich aus den Netzen seines Anheimgefallenseins an lieblichen Sternchen frei. Es
gelingt ihm, die Farben immer entschiedner auszusprechen; und nun ergeben sich
ihm Männerköpfe! Ganz folgerichtig, also wieder durchaus natürlich: eine ganze
Reihe. Ein paar Tage lang blickt er zu einem der Ganzgroben auf: zu Rembrandt!
Er wittert: unter der goldnen Edelpatina seiner Meisterwerke mufz noch eine
andre staunenswerte Farbenpracht, für ewig eingehüilf, sanft übergoldet, die ein
Pathos sfarkhervordunkelnden Farbenrausches erwecken könnte, stecken. Und er
582