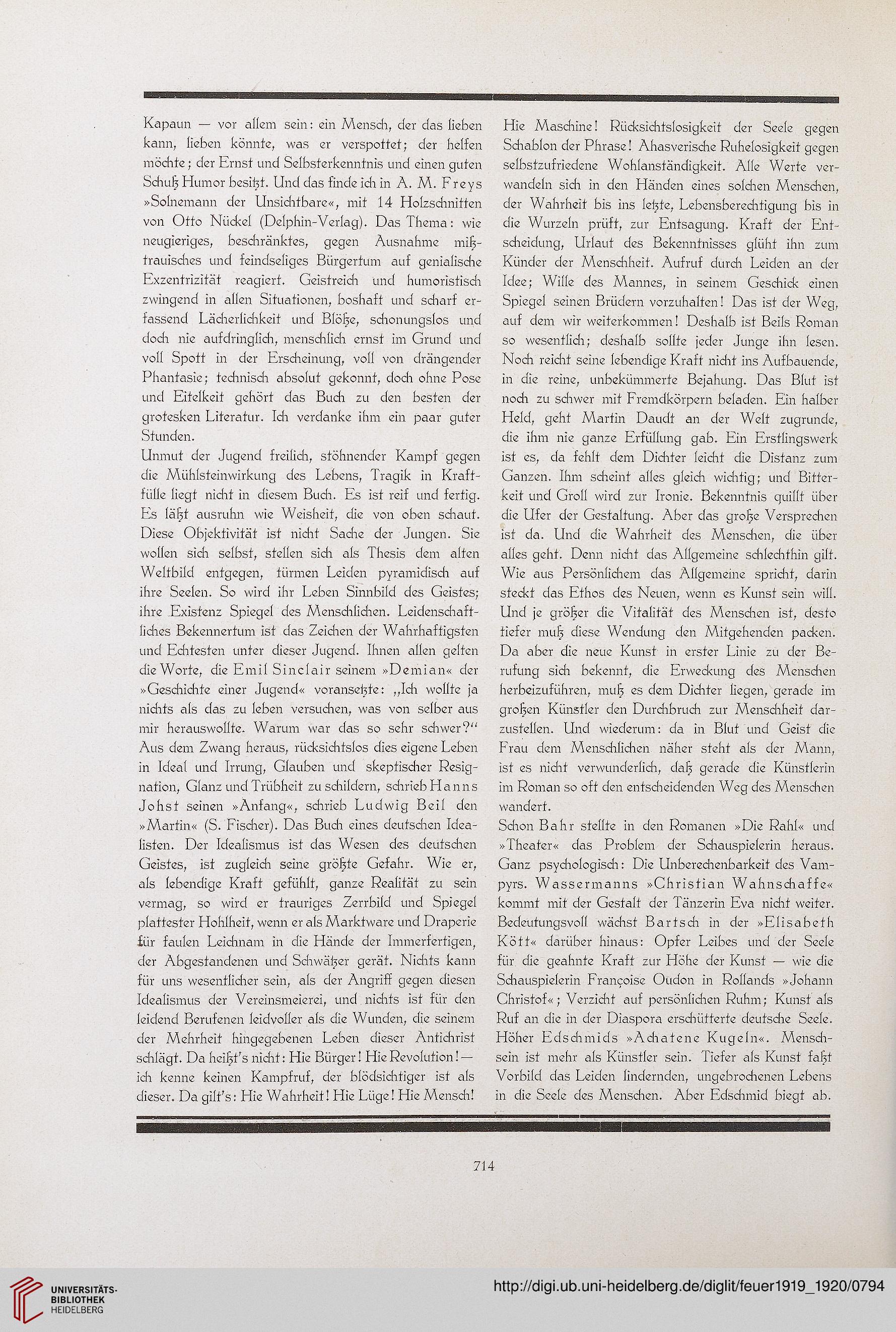Kapaun — vor allem sein: ein Mensch, der das lieben
kann, lieben könnte, was er verspottet; der helfen
möchte; der Ernst und Selbsterkenntnis und einen guten
Schuß Humor besitzt. Und das finde idr in A. M. Freys
»Solnemann der Unsidrfbare«, mit 14 Holzschnitten
von Otto Nückel (Delphin-Verlag). Das Thema: wie
neugieriges, beschränktes, gegen Ausnahme miß-
trauisches und feindseliges Bürgertum auf genialische
Exzentrizität reagiert. Geistreidi und humoristisch
zwingend in allen Situationen, boshaft und sdiarf er-
fassend Lädrerlichkeif und Blöße, schonungslos und
dodi nie aufdringlich, menschlich ernst im Grund und
voll Spott in der Ersdreinung, voll von drängender
Phantasie; technisch absolut gekonnt, doch ohne Pose
und Eitelkeit gehört das Budi zu den besten der
grotesken Literatur. Idr verdanke ihm ein paar guter
Stunden.
Unmut der Jugend freilidr, stöhnender Kampf gegen
die Mühlsfeinwirkung des Lebens, Tragik in Kraff-
fiille liegt nkhf in diesem Budi. Es ist reif und fertig.
Es läßt ausruhn wie Weisheit, die von oben sdiauf.
Diese Objektivität ist nicht Sadre der Jungen. Sie
wollen sidr selbst, stellen sidr als Thesis dem alten
Weltbild entgegen, türmen Leiden pyramidisch auf
ihre Seelen. So wird ihr Leben Sinnbild des Geistes;
ihre Existenz Spiegel des Mensdilidien. Leidensdiaft-
lidies Bekennerfum ist das Zeidicn der Wahrhaftigsten
und Edifesfen unter dieser Jugend. Ihnen allen gelten
die Worte, die Emil Sinclair seinem »Demian« der
»Gesdiidife einer Jugend« voranseßfe: „Ich wollte ja
nidifs als das zu leben versuchen, was von selber aus
mir herauswollfe. Warum war das so sehr schwer ?“
Aus dem Zwang heraus, rücksichtslos dies eigene Leben
in Ideal und Irrung, Glauben und skeptisdicr Resig-
nation, Glanz und Trübheit zu sdrildern, schrieb Hanns
Johsf seinen »Anfang«, schrieb Ludwig Beil den
»Martin« (S. Fisdier). Das Budi eines deutschen Idea-
listen. Der Idealismus ist das Wesen des deutschen
Geistes, ist zugleich seine größte Gefahr. Wie er,
als lebendige Kraft gefühlt, ganze Realität zu sein
vermag, so wird er trauriges Zerrbild und Spiegel
plattester Hohlheit, wenn er als Marktware und Draperie
für faulen Leichnam in die Hände der Immerferfigen,
der Abgestandenen und Schwäßer gerät. Nidifs kann
für uns wescnflidier sein, als der Angriff gegen diesen
Idealismus der Vereinsmeierei, und nichts ist für den
leidend Berufenen leidvoller als die Wunden, die seinem
der Mehrheit hingegebenen Leben dieser Antichrist
schlägt. Da heißLs nicht: Hie Bürger! Hie Revolution! —
ich kenne keinen Kampfruf, der blödsichfiger ist als
dieser. Da gilf's: Hie Wahrheit! Hie Lüge! Hie Mensch!
Hie Maschine! Rücksichtslosigkeit der Seele gegen
Schabion der Phrase! Ahasverische Ruhelosigkeit gegen
selbstzufriedene Wohlansfändigkeif. Alle Werte ver-
wandeln sidi in den Händen eines solchen Menschen,
der Wahrheit bis ins leßfe, Lebensbcredifigung bis in
die Wurzeln prüft, zur Entsagung. Kraft der Ent-
scheidung, Urlauf des Bekenntnisses glüht ihn zum
Künder der Menschheit, Aufruf durch Leiden an der
Idee; Wille des Mannes, in seinem Geschick einen
Spiegel seinen Brüdern vorzuhalfen! Das ist der Weg,
auf dem wir weiferkommen! Deshalb ist Beils Roman
so wesenflidi; deshalb sollte jeder Junge ihn lesen.
Nodr reidrf seine lebendige Kraft nidif ins Aufbauende,
in die reine, unbekümmerte Bejahung. Das Blut ist
nodr zu sdrwer mit Fremdkörpern beladen. Ein halber
Held, geht Martin Daudf an der Welf zugrunde,
die ihm nie ganze Erfüllung gab. Ein Erstlingswerk
ist es, da fehlt dem Dichter leidrf die Distanz zum
Ganzen. Ihm scheint alles gleidr widrfig; und Bitter-
keit und Groll wird zur Ironie. Bekenntnis quillt über
die Ufer der Gestaltung. Aber das große Verspredren
ist da. Und die Wahrheit des Mensdren, die über
alles geht. Denn nidif das Allgemeine sdiledifhin gilt.
Wie aus Persönlidiem das Allgemeine spridit, darin
steckt das Ethos des Neuen, wenn es Kunst sein will.
Und je größer die Vitalität des Mensdien ist, desto
tiefer muß diese Wendung den Mifgehenden packen.
Da aber die neue Kunst in erster Linie zu der Be-
rufung sidi bekennt, die Erweckung des Mensdien
herbeizuführen, muß es dem Dichter liegen, gerade im
großen Künstler den Durdibruch zur Mensdiheif dar-
zusfellen. Und wiederum: da in Blut und Geist die
Frau dem Mensdilichen näher steht als der Mann,
ist es nidif verwunderlich, daß gerade die Künstlerin
im Roman so oft den enfsdieidenden Weg des Mensdien
wandert.
Sdion Bahr stellte in den Romanen »Die Rah!« und
»Theater« das Problem der Sdiauspielerin heraus.
Ganz psydiologisch: Die Unberedienbarkeif des Vam-
pyrs. Wassermanns »Christian Wahnsdiaffe«
kommt mit der Gestalt der Tänzerin Eva nicht weiter.
Bedeutungsvoll vvädisf Barfsdi in der »Elisabeth
Köft« darüber hinaus: Opfer Leibes und der Seele
für die geahnte Kraft zur Höhe der Kunst — wie die
Sdiauspielerin Francoise Oudon in Rollands »Johann
Christof«; Verzidif auf persönlidien Ruhm; Kunst als
Ruf an die in der Diaspora ersdiüfferfe deufsdie Seele.
Höher Edschmids »Adiafene Kugeln«. Mensdi-
sein ist mehr als Künstler sein. Tiefer als Kunst faßt
Vorbild das Leiden lindernden, ungebrochenen Lebens
in die Seele des Mensdien. Aber Edsdimid biegt ab.
714
kann, lieben könnte, was er verspottet; der helfen
möchte; der Ernst und Selbsterkenntnis und einen guten
Schuß Humor besitzt. Und das finde idr in A. M. Freys
»Solnemann der Unsidrfbare«, mit 14 Holzschnitten
von Otto Nückel (Delphin-Verlag). Das Thema: wie
neugieriges, beschränktes, gegen Ausnahme miß-
trauisches und feindseliges Bürgertum auf genialische
Exzentrizität reagiert. Geistreidi und humoristisch
zwingend in allen Situationen, boshaft und sdiarf er-
fassend Lädrerlichkeif und Blöße, schonungslos und
dodi nie aufdringlich, menschlich ernst im Grund und
voll Spott in der Ersdreinung, voll von drängender
Phantasie; technisch absolut gekonnt, doch ohne Pose
und Eitelkeit gehört das Budi zu den besten der
grotesken Literatur. Idr verdanke ihm ein paar guter
Stunden.
Unmut der Jugend freilidr, stöhnender Kampf gegen
die Mühlsfeinwirkung des Lebens, Tragik in Kraff-
fiille liegt nkhf in diesem Budi. Es ist reif und fertig.
Es läßt ausruhn wie Weisheit, die von oben sdiauf.
Diese Objektivität ist nicht Sadre der Jungen. Sie
wollen sidr selbst, stellen sidr als Thesis dem alten
Weltbild entgegen, türmen Leiden pyramidisch auf
ihre Seelen. So wird ihr Leben Sinnbild des Geistes;
ihre Existenz Spiegel des Mensdilidien. Leidensdiaft-
lidies Bekennerfum ist das Zeidicn der Wahrhaftigsten
und Edifesfen unter dieser Jugend. Ihnen allen gelten
die Worte, die Emil Sinclair seinem »Demian« der
»Gesdiidife einer Jugend« voranseßfe: „Ich wollte ja
nidifs als das zu leben versuchen, was von selber aus
mir herauswollfe. Warum war das so sehr schwer ?“
Aus dem Zwang heraus, rücksichtslos dies eigene Leben
in Ideal und Irrung, Glauben und skeptisdicr Resig-
nation, Glanz und Trübheit zu sdrildern, schrieb Hanns
Johsf seinen »Anfang«, schrieb Ludwig Beil den
»Martin« (S. Fisdier). Das Budi eines deutschen Idea-
listen. Der Idealismus ist das Wesen des deutschen
Geistes, ist zugleich seine größte Gefahr. Wie er,
als lebendige Kraft gefühlt, ganze Realität zu sein
vermag, so wird er trauriges Zerrbild und Spiegel
plattester Hohlheit, wenn er als Marktware und Draperie
für faulen Leichnam in die Hände der Immerferfigen,
der Abgestandenen und Schwäßer gerät. Nidifs kann
für uns wescnflidier sein, als der Angriff gegen diesen
Idealismus der Vereinsmeierei, und nichts ist für den
leidend Berufenen leidvoller als die Wunden, die seinem
der Mehrheit hingegebenen Leben dieser Antichrist
schlägt. Da heißLs nicht: Hie Bürger! Hie Revolution! —
ich kenne keinen Kampfruf, der blödsichfiger ist als
dieser. Da gilf's: Hie Wahrheit! Hie Lüge! Hie Mensch!
Hie Maschine! Rücksichtslosigkeit der Seele gegen
Schabion der Phrase! Ahasverische Ruhelosigkeit gegen
selbstzufriedene Wohlansfändigkeif. Alle Werte ver-
wandeln sidi in den Händen eines solchen Menschen,
der Wahrheit bis ins leßfe, Lebensbcredifigung bis in
die Wurzeln prüft, zur Entsagung. Kraft der Ent-
scheidung, Urlauf des Bekenntnisses glüht ihn zum
Künder der Menschheit, Aufruf durch Leiden an der
Idee; Wille des Mannes, in seinem Geschick einen
Spiegel seinen Brüdern vorzuhalfen! Das ist der Weg,
auf dem wir weiferkommen! Deshalb ist Beils Roman
so wesenflidi; deshalb sollte jeder Junge ihn lesen.
Nodr reidrf seine lebendige Kraft nidif ins Aufbauende,
in die reine, unbekümmerte Bejahung. Das Blut ist
nodr zu sdrwer mit Fremdkörpern beladen. Ein halber
Held, geht Martin Daudf an der Welf zugrunde,
die ihm nie ganze Erfüllung gab. Ein Erstlingswerk
ist es, da fehlt dem Dichter leidrf die Distanz zum
Ganzen. Ihm scheint alles gleidr widrfig; und Bitter-
keit und Groll wird zur Ironie. Bekenntnis quillt über
die Ufer der Gestaltung. Aber das große Verspredren
ist da. Und die Wahrheit des Mensdren, die über
alles geht. Denn nidif das Allgemeine sdiledifhin gilt.
Wie aus Persönlidiem das Allgemeine spridit, darin
steckt das Ethos des Neuen, wenn es Kunst sein will.
Und je größer die Vitalität des Mensdien ist, desto
tiefer muß diese Wendung den Mifgehenden packen.
Da aber die neue Kunst in erster Linie zu der Be-
rufung sidi bekennt, die Erweckung des Mensdien
herbeizuführen, muß es dem Dichter liegen, gerade im
großen Künstler den Durdibruch zur Mensdiheif dar-
zusfellen. Und wiederum: da in Blut und Geist die
Frau dem Mensdilichen näher steht als der Mann,
ist es nidif verwunderlich, daß gerade die Künstlerin
im Roman so oft den enfsdieidenden Weg des Mensdien
wandert.
Sdion Bahr stellte in den Romanen »Die Rah!« und
»Theater« das Problem der Sdiauspielerin heraus.
Ganz psydiologisch: Die Unberedienbarkeif des Vam-
pyrs. Wassermanns »Christian Wahnsdiaffe«
kommt mit der Gestalt der Tänzerin Eva nicht weiter.
Bedeutungsvoll vvädisf Barfsdi in der »Elisabeth
Köft« darüber hinaus: Opfer Leibes und der Seele
für die geahnte Kraft zur Höhe der Kunst — wie die
Sdiauspielerin Francoise Oudon in Rollands »Johann
Christof«; Verzidif auf persönlidien Ruhm; Kunst als
Ruf an die in der Diaspora ersdiüfferfe deufsdie Seele.
Höher Edschmids »Adiafene Kugeln«. Mensdi-
sein ist mehr als Künstler sein. Tiefer als Kunst faßt
Vorbild das Leiden lindernden, ungebrochenen Lebens
in die Seele des Mensdien. Aber Edsdimid biegt ab.
714