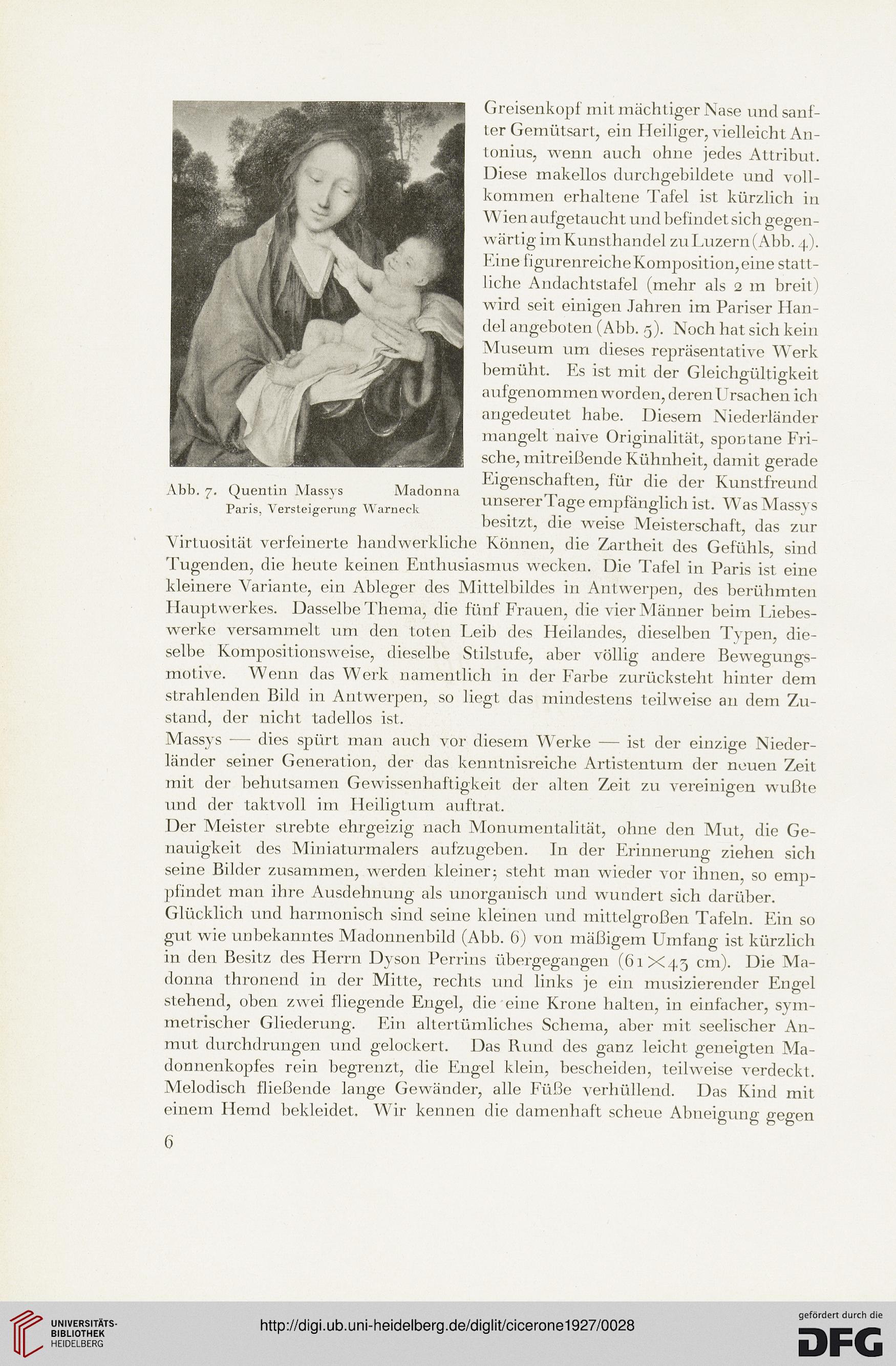Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0028
DOI Heft:
Heft 1
DOI Artikel:Friedländer, Max J.: Neues zu Quentin Massys
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0028
Abb. 7. Quentin Massys Madonna
Paris, Versteigerung Warneck
Greisenkopf mit mächtiger Nase und sanf-
ter Gemütsart, ein Heiliger, vielleicht An-
tonius, wenn auch ohne jedes Attribut.
Diese makellos durchgebildete und voll-
kommen erhaltene Tafel ist kürzlich in
Wien aufgetaucht und befindet sich gegen-
wärtig im Kunsthandel zu Luzern (Abb. 4).
Eine figurenreicheKomposition,eine statt-
liche Andachtstafel (mehr als 2 m breit)
wird seit einigen Jahren im Pariser Han-
del angeboten (Abb. 5). Noch hat sich kein
Museum um dieses repräsentative Werk
bemüht. Es ist mit der Gleichgültigkeit
aufgenommen worden, derenUrsachen ich
angedeutet habe. Diesem Niederländer
mangelt naive Originalität, spontane Fri-
sche, mitreißende Kühnheit, damit gerade
Eigenschaften, für die der Kunstfreund
unserer Tage empf änglich ist. Was Massys
besitzt, die weise Meisterschaft, das zur
Virtuosität verfeinerte handwerkliche Können, die Zartheit des Gefühls, sind
Tugenden, die heute keinen Enthusiasmus wecken. Die Tafel in Paris ist eine
kleinere Variante, ein Ableger des Mittelbildes in Antwerpen, des berühmten
Elauptwerkes. Dasselbe Thema, die fünf Frauen, die vier Männer beim Liebes-
werke versammelt um den toten Leib des Heilandes, dieselben Typen, die-
selbe Kompositionsweise, dieselbe Stilstufe, aber völlig andere Bewegungs-
motive. Wenn das Werk namentlich in der Farbe zurücksteht hinter dem
strahlenden Bild in Antwerpen, so liegt das mindestens teilweise an dem Zu-
stand, der nicht tadellos ist.
Massys — dies spürt man auch vor diesem Werke — ist der einzige Nieder-
länder seiner Generation, der das kenntnisreiche Artistentum der neuen Zeit
mit der behutsamen Gewissenhaftigkeit der alten Zeit zu vereinigen wußte
und der taktvoll im Heiligtum auftrat.
Der Meister strebte ehrgeizig nach Monumentalität, ohne den Mut, die Ge-
nauigkeit des Miniaturmalers aufzugeben. In der Erinnerung ziehen sich
seine Bilder zusammen, werden kleiner^ steht man wieder vor ihnen, so emp-
pfindet man ihre Ausdehnung als unorganisch und wundert sich darüber.
Glücklich und harmonisch sind seine kleinen und mittelgroßen Tafeln. Ein so
gut wie unbekanntes Madonnenbild (Abb. 6) von mäßigem Umfang ist kürzlich
in den Besitz des Herrn Dyson Perrins übergegangen (61X45 cm). Die Ma-
donna thronend in der Mitte, rechts und links je ein musizierender Engel
stehend, oben zwei fliegende Engel, die eine Krone halten, in einfacher, sym-
metrischer Gliederung. Ein altertümliches Schema, aber mit seelischer An-
mut durchdrungen und gelockert. Das Rund des ganz leicht geneigten Ma-
donnenkopfes rein begrenzt, die Engel klein, bescheiden, teilweise verdeckt.
Melodisch fließende lange Gewänder, alle Füße verhüllend. Das Kind mit
einem Hemd bekleidet. Wir kennen die damenhaft scheue Abneigung gegen
6