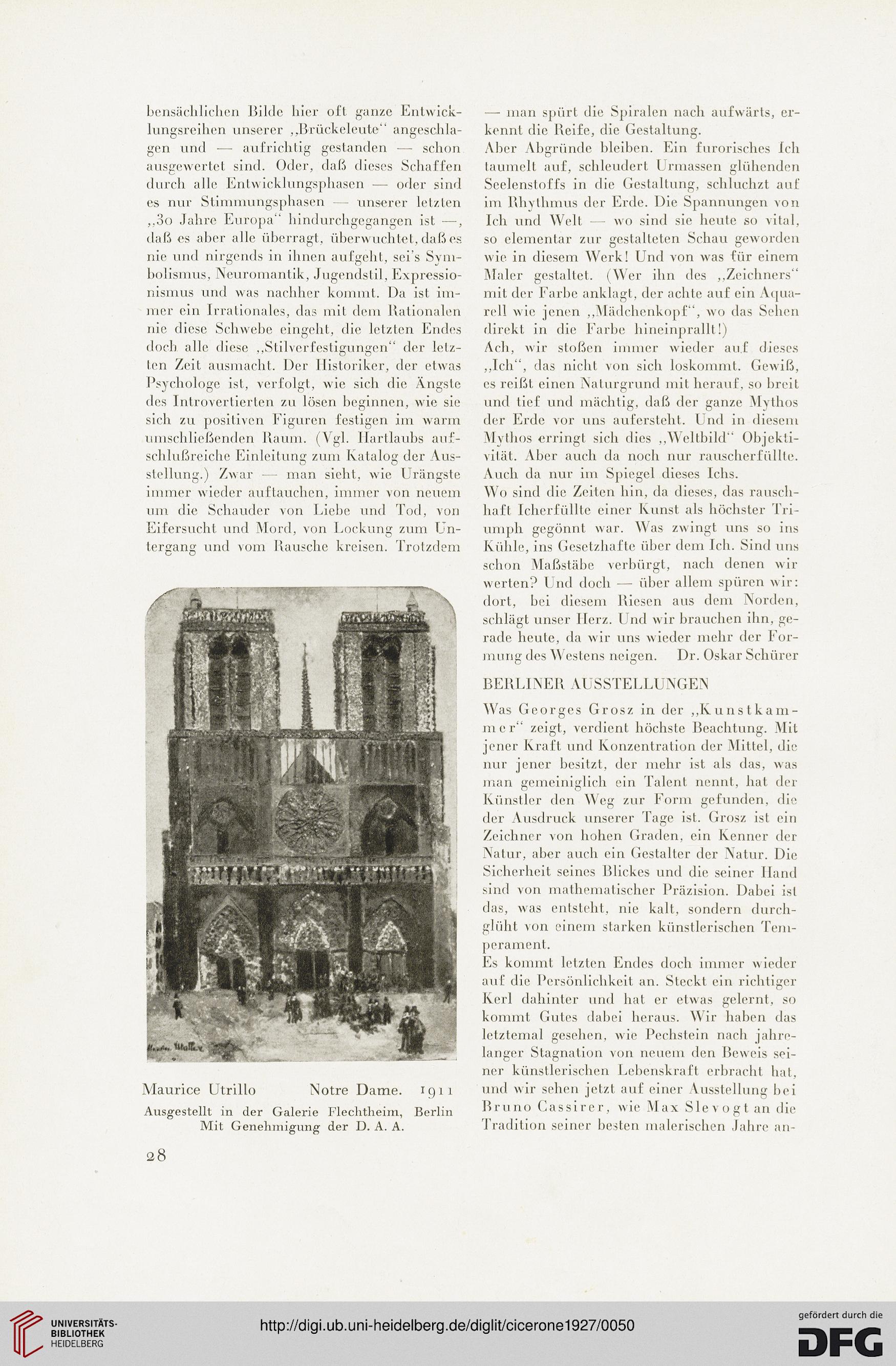bensächlichen Bilde hier oft ganze Entwick-
lungsreihen unserer „Brückeleute“ angeschla-
gen und — aufrichtig gestanden — schon
ausgewertet sind. Oder, daß dieses Schaffen
durch alle Entwicklungsphasen — oder sind
es nur Stimmungsphasen — unserer letzten
„3o Jahre Europa" hindurchgegangen ist —,
daß es aber alle überragt, überwuchtet, daß es
nie und nirgends in ihnen aufgeht, sei’s Sym-
bolismus, Neuromantik, Jugendstil, Expressio-
nismus und was nachher kommt. Da ist im-
mer ein Irrationales, das mit dem Rationalen
nie diese Schwebe eingeht, die letzten Endes
doch alle diese „Stilverfestigungen" der letz-
ten Zeit ausmacht. Der Historiker, der etwas
Psychologe ist, verfolgt, wie sich die Ängste
des Introvertierten zu lösen beginnen, wie sie
sich zu positiven Figuren festigen im warm
umschließenden Raum. (Vgl. Hartlaubs auf-
schlußreiche Einleitung zum Katalog der Aus-
stellung.) Zwar — man sieht, wie Urängste
immer wieder auftauchen, immer von neuem
um die Schauder von Liebe und Tod, von
Eifersucht und Mord, von Lockung zum Un-
tergang und vom Rausche kreisen. Trotzdem
Maurice Utrillo Notre Dame. 1911
Ausgestellt in der Galerie Flechtheim, Berlin
Mit Genehmigung der D. A. A.
— man spürt die Spiralen nach aufwärts, er-
kennt die Reife, die Gestaltung.
Aber Abgründe bleiben. Ein furorisches Ich
taumelt auf, schleudert Urmassen glühenden
Seelenstoffs in die Gestaltung, schluchzt auf
im Rhythmus der Erde. Die Spannungen von
Ich und Welt — wo sind sie heute so vital,
so elementar zur gestalteten Schau geworden
wie in diesem Work! Und von was für einem
Maler gestaltet. (Wer ihn des „Zeichners“
mit der Farbe anklagt, der achte auf ein Aqua-
rell wie jenen „Mädchenkopf“, wo das Sehen
direkt in die Farbe hineinprallt!)
Ach, wir stoßen immer wieder auf dieses
„Ich“, das nicht von sich loskommt. Gewiß,
cs reißt einen Naturgrund mit herauf, so breit
und tief und mächtig, daß der ganze Mythos
der Erde vor uns aufersteht. Und in diesem
Mythos erringt sich dies „Weltbild“ Objekti-
vität. Aber auch da noch nur rauscherfüllte.
Auch da nur im Spiegel dieses Ichs.
Wo sind die Zeiten hin, da dieses, das rausch-
haft Icherfüllte einer Kunst als höchster Tri-
umph gegönnt war. Was zwingt uns so ins
Kühle, ins Gesetzhafte über dem Ich. Sind uns
schon Maßstäbe verbürgt, nach denen wir
werten? Und doch — über allem spüren wir:
dort, bei diesem Riesen aus dem Norden,
schlägt unser Herz. Und wir brauchen ihn, ge-
rade heute, da wir uns wieder mehr der For-
mung des Westens neigen. Dr. Oskar Schürer
BERLINER AUSSTELLUNGEN
Was Georges Grosz in der „Kunstkam-
mer“ zeigt, verdient höchste Beachtung. Mit
jener Kraft und Konzentration der Mittel, die
nur jener besitzt, der mehr ist als das, was
man gemeiniglich ein Talent nennt, hat der
Künstler den Weg zur Form gefunden, die
der Ausdruck unserer Tage ist. Grosz ist ein
Zeichner von hohen Graden, ein Kenner der
Natur, aber auch ein Gestalter der Natur. Die
Sicherheit seines Blickes und die seiner Hand
sind von mathematischer Präzision. Dabei ist
das, was entsteht, nie kalt, sondern durch-
glüht von einem starken künstlerischen Tem-
perament.
Es kommt letzten Endes doch immer wieder
auf die Persönlichkeit an. Steckt ein richtiger
Kerl dahinter und hat er etwas gelernt, so
kommt Gutes dabei heraus. Wir haben das
letztemal gesehen, wie Pechstein nach jahre-
langer Stagnation von neuem den Beweis sei-
ner künstlerischen Lebenskraft erbracht hat,
und wir sehen jetzt auf einer Ausstellung bei
Bruno Cassirer, wie Max Slevogt an die
Tradition seiner besten malerischen Jahre an-
28
lungsreihen unserer „Brückeleute“ angeschla-
gen und — aufrichtig gestanden — schon
ausgewertet sind. Oder, daß dieses Schaffen
durch alle Entwicklungsphasen — oder sind
es nur Stimmungsphasen — unserer letzten
„3o Jahre Europa" hindurchgegangen ist —,
daß es aber alle überragt, überwuchtet, daß es
nie und nirgends in ihnen aufgeht, sei’s Sym-
bolismus, Neuromantik, Jugendstil, Expressio-
nismus und was nachher kommt. Da ist im-
mer ein Irrationales, das mit dem Rationalen
nie diese Schwebe eingeht, die letzten Endes
doch alle diese „Stilverfestigungen" der letz-
ten Zeit ausmacht. Der Historiker, der etwas
Psychologe ist, verfolgt, wie sich die Ängste
des Introvertierten zu lösen beginnen, wie sie
sich zu positiven Figuren festigen im warm
umschließenden Raum. (Vgl. Hartlaubs auf-
schlußreiche Einleitung zum Katalog der Aus-
stellung.) Zwar — man sieht, wie Urängste
immer wieder auftauchen, immer von neuem
um die Schauder von Liebe und Tod, von
Eifersucht und Mord, von Lockung zum Un-
tergang und vom Rausche kreisen. Trotzdem
Maurice Utrillo Notre Dame. 1911
Ausgestellt in der Galerie Flechtheim, Berlin
Mit Genehmigung der D. A. A.
— man spürt die Spiralen nach aufwärts, er-
kennt die Reife, die Gestaltung.
Aber Abgründe bleiben. Ein furorisches Ich
taumelt auf, schleudert Urmassen glühenden
Seelenstoffs in die Gestaltung, schluchzt auf
im Rhythmus der Erde. Die Spannungen von
Ich und Welt — wo sind sie heute so vital,
so elementar zur gestalteten Schau geworden
wie in diesem Work! Und von was für einem
Maler gestaltet. (Wer ihn des „Zeichners“
mit der Farbe anklagt, der achte auf ein Aqua-
rell wie jenen „Mädchenkopf“, wo das Sehen
direkt in die Farbe hineinprallt!)
Ach, wir stoßen immer wieder auf dieses
„Ich“, das nicht von sich loskommt. Gewiß,
cs reißt einen Naturgrund mit herauf, so breit
und tief und mächtig, daß der ganze Mythos
der Erde vor uns aufersteht. Und in diesem
Mythos erringt sich dies „Weltbild“ Objekti-
vität. Aber auch da noch nur rauscherfüllte.
Auch da nur im Spiegel dieses Ichs.
Wo sind die Zeiten hin, da dieses, das rausch-
haft Icherfüllte einer Kunst als höchster Tri-
umph gegönnt war. Was zwingt uns so ins
Kühle, ins Gesetzhafte über dem Ich. Sind uns
schon Maßstäbe verbürgt, nach denen wir
werten? Und doch — über allem spüren wir:
dort, bei diesem Riesen aus dem Norden,
schlägt unser Herz. Und wir brauchen ihn, ge-
rade heute, da wir uns wieder mehr der For-
mung des Westens neigen. Dr. Oskar Schürer
BERLINER AUSSTELLUNGEN
Was Georges Grosz in der „Kunstkam-
mer“ zeigt, verdient höchste Beachtung. Mit
jener Kraft und Konzentration der Mittel, die
nur jener besitzt, der mehr ist als das, was
man gemeiniglich ein Talent nennt, hat der
Künstler den Weg zur Form gefunden, die
der Ausdruck unserer Tage ist. Grosz ist ein
Zeichner von hohen Graden, ein Kenner der
Natur, aber auch ein Gestalter der Natur. Die
Sicherheit seines Blickes und die seiner Hand
sind von mathematischer Präzision. Dabei ist
das, was entsteht, nie kalt, sondern durch-
glüht von einem starken künstlerischen Tem-
perament.
Es kommt letzten Endes doch immer wieder
auf die Persönlichkeit an. Steckt ein richtiger
Kerl dahinter und hat er etwas gelernt, so
kommt Gutes dabei heraus. Wir haben das
letztemal gesehen, wie Pechstein nach jahre-
langer Stagnation von neuem den Beweis sei-
ner künstlerischen Lebenskraft erbracht hat,
und wir sehen jetzt auf einer Ausstellung bei
Bruno Cassirer, wie Max Slevogt an die
Tradition seiner besten malerischen Jahre an-
28