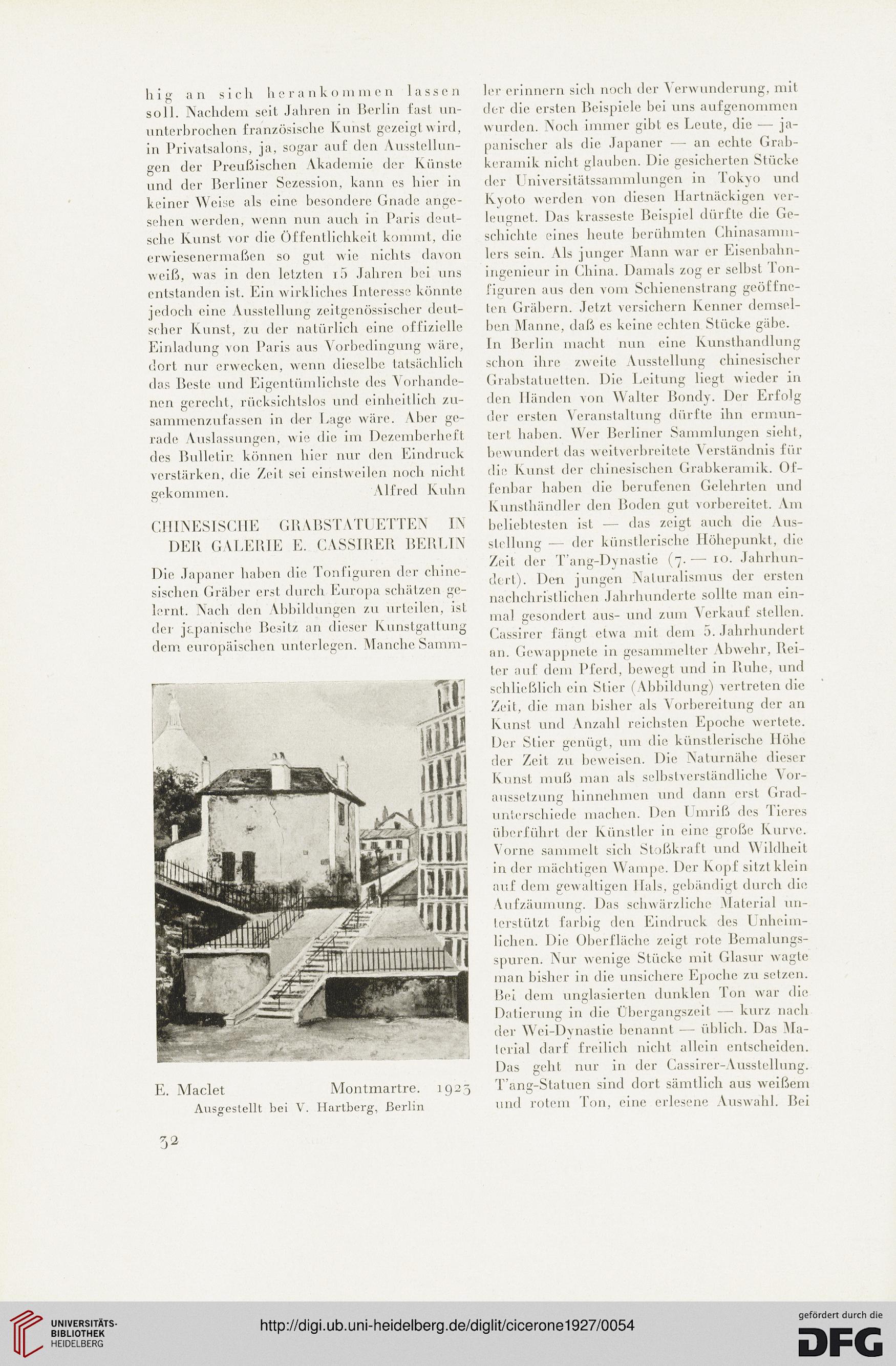h i g an sich herankommen lassen
soll. Nachdem seit Jahren in Berlin East un-
unterbrochen französische Kunst gezeigt wird,
in Privatsalons, ja, sogar auf den Ausstellun-
gen der Preußischen Akademie der Künste
und der Berliner Sezession, kann es hier in
keiner Weise als eine besondere Gnade ange-
sehen werden, wenn nun auch in Paris deut-
sche Kunst vor die Öffentlichkeit kommt, die
erwiesenermaßen so gut wie nichts davon
weiß, was in den letzten i5 Jahren bei uns
entstanden ist. Ein wirkliches Interesse könnte
jedoch eine Ausstellung zeitgenössischer deut-
scher Kunst, zu der natürlich eine offizielle
Einladung von Paris aus Vorbedingung wäre,
dort nur erwecken, wenn dieselbe tatsächlich
das Beste und Eigentümlichste des Vorhande-
nen gerecht, rücksichtslos und einheitlich zu-
sammenzufassen in der Lage wäre. Aber ge-
rade Auslassungen, wie die im Dezemberheft
des Bulletin können hier nur den Eindruck
verstärken, die Zeit sei einstweilen noch nicht
gekommen. Alfred Kuhn
CHINESISCHE GRABSTATUETTEN IN
DER GALERIE E. CASSIRER BERLIN
Die Japaner haben die Tonfiguren der chine-
sischen Gräber erst durch Europa schätzen ge-
lernt. Nach den Abbildungen zu urteilen, ist
der japanische Besitz an dieser Kunstgattung
dem europäischen unterlegen. Manche Samm-
E. Maclet Montmartre. 1923
Ausgestellt bei V. Hartberg, Berlin
ler erinnern sich noch der Verwunderung, mit
der die ersten Beispiele bei uns aufgenommen
wurden. Noch immer gibt es Leute, die ■— ja-
panischer als die Japaner — an echte Grab-
keramik nicht glauben. Die gesicherten Stücke
der Universitätssammlungen in Tokyo und
Kyoto werden von diesen Hartnäckigen ver-
leugnet. Das krasseste Beispiel dürfte die Ge-
schichte eines heute berühmten Chinasamm-
lers sein. Als junger Mann war er Eisenbahn-
ingenieur in China. Damals zog er selbst Ton-
figuren aus den vom Schienenstrang geöffne-
ten Gräbern. Jetzt versichern Kenner demsel-
ben Manne, daß es keine echten Stücke gäbe.
In Berlin macht nun eine Kunsthandlung
schon ihre zweite Ausstellung chinesischer
Grabstatuetten. Die Leitung liegt wieder in
den Händen von Walter Bondy. Der Erfolg
der ersten Veranstaltung dürfte ihn ermun-
tert haben. Wer Berliner Sammlungen sieht,
bewundert das weitverbreitete Verständnis für
die Kunst der chinesischen Grabkeramik. Of-
fenbar haben die berufenen Gelehrten und
Kunsthändler den Boden gut vorbereitet. Am
beliebtesten ist -— das zeigt auch die Aus-
stellung — der künstlerische Höhepunkt, die
Zeit der T’ang-Dynastie (7. •— 10. Jahrhun-
dert). Den jungen Naturalismus der ersten
nachchristlichen Jahrhunderte sollte man ein-
mal gesondert aus- und zum Verkauf stellen.
Cassirer fängt etwa mit dem 5. Jahrhundert
an. Gewappnete in gesammelter Abwehr, Rei-
ter auf dem Pferd, bewegt und in Ruhe, und
schließlich ein Stier (Abbildung) vertreten die
Zeit, die man bisher als Vorbereitung der an
Kunst und Anzahl reichsten Epoche wertete.
Der Stier genügt, um die künstlerische Höhe
der Zeit zu beweisen. Die Naturnähe dieser
Kunst muß man als selbstverständliche Vor-
aussetzung hinnehmen und dann erst Grad-
unterschiede machen. Den Umriß des Tieres
überführt der Künstler in eine große Kurve.
Vorne sammelt sich Stoßkraft und Wildheit
in der mächtigen Wampe. Der Kopf sitzt klein
auf dem gewaltigen Hals, gebändigt durch die
Aufzäumung. Das schwärzliche Material un-
terstützt farbig den Eindruck des Unheim-
lichen. Die Oberfläche zeigt rote Bemalungs-
spuren. Nur wenige Stücke mit Glasur wagte
man bisher in die unsichere Epoche zu setzen.
Bei dem unglasierten dunklen Ton war die
Datierung in die Übergangszeit — kurz nach
der Wei-Dynastie benannt — üblich. Das Ma-
lerial darf freilich nicht allein entscheiden.
Das seht nur in der Cassirer-Ausstelluns.
o . D
T’ang-Statuen sind dort sämtlich aus weißem
und rotem Ton, eine erlesene Auswahl. Bei
52
soll. Nachdem seit Jahren in Berlin East un-
unterbrochen französische Kunst gezeigt wird,
in Privatsalons, ja, sogar auf den Ausstellun-
gen der Preußischen Akademie der Künste
und der Berliner Sezession, kann es hier in
keiner Weise als eine besondere Gnade ange-
sehen werden, wenn nun auch in Paris deut-
sche Kunst vor die Öffentlichkeit kommt, die
erwiesenermaßen so gut wie nichts davon
weiß, was in den letzten i5 Jahren bei uns
entstanden ist. Ein wirkliches Interesse könnte
jedoch eine Ausstellung zeitgenössischer deut-
scher Kunst, zu der natürlich eine offizielle
Einladung von Paris aus Vorbedingung wäre,
dort nur erwecken, wenn dieselbe tatsächlich
das Beste und Eigentümlichste des Vorhande-
nen gerecht, rücksichtslos und einheitlich zu-
sammenzufassen in der Lage wäre. Aber ge-
rade Auslassungen, wie die im Dezemberheft
des Bulletin können hier nur den Eindruck
verstärken, die Zeit sei einstweilen noch nicht
gekommen. Alfred Kuhn
CHINESISCHE GRABSTATUETTEN IN
DER GALERIE E. CASSIRER BERLIN
Die Japaner haben die Tonfiguren der chine-
sischen Gräber erst durch Europa schätzen ge-
lernt. Nach den Abbildungen zu urteilen, ist
der japanische Besitz an dieser Kunstgattung
dem europäischen unterlegen. Manche Samm-
E. Maclet Montmartre. 1923
Ausgestellt bei V. Hartberg, Berlin
ler erinnern sich noch der Verwunderung, mit
der die ersten Beispiele bei uns aufgenommen
wurden. Noch immer gibt es Leute, die ■— ja-
panischer als die Japaner — an echte Grab-
keramik nicht glauben. Die gesicherten Stücke
der Universitätssammlungen in Tokyo und
Kyoto werden von diesen Hartnäckigen ver-
leugnet. Das krasseste Beispiel dürfte die Ge-
schichte eines heute berühmten Chinasamm-
lers sein. Als junger Mann war er Eisenbahn-
ingenieur in China. Damals zog er selbst Ton-
figuren aus den vom Schienenstrang geöffne-
ten Gräbern. Jetzt versichern Kenner demsel-
ben Manne, daß es keine echten Stücke gäbe.
In Berlin macht nun eine Kunsthandlung
schon ihre zweite Ausstellung chinesischer
Grabstatuetten. Die Leitung liegt wieder in
den Händen von Walter Bondy. Der Erfolg
der ersten Veranstaltung dürfte ihn ermun-
tert haben. Wer Berliner Sammlungen sieht,
bewundert das weitverbreitete Verständnis für
die Kunst der chinesischen Grabkeramik. Of-
fenbar haben die berufenen Gelehrten und
Kunsthändler den Boden gut vorbereitet. Am
beliebtesten ist -— das zeigt auch die Aus-
stellung — der künstlerische Höhepunkt, die
Zeit der T’ang-Dynastie (7. •— 10. Jahrhun-
dert). Den jungen Naturalismus der ersten
nachchristlichen Jahrhunderte sollte man ein-
mal gesondert aus- und zum Verkauf stellen.
Cassirer fängt etwa mit dem 5. Jahrhundert
an. Gewappnete in gesammelter Abwehr, Rei-
ter auf dem Pferd, bewegt und in Ruhe, und
schließlich ein Stier (Abbildung) vertreten die
Zeit, die man bisher als Vorbereitung der an
Kunst und Anzahl reichsten Epoche wertete.
Der Stier genügt, um die künstlerische Höhe
der Zeit zu beweisen. Die Naturnähe dieser
Kunst muß man als selbstverständliche Vor-
aussetzung hinnehmen und dann erst Grad-
unterschiede machen. Den Umriß des Tieres
überführt der Künstler in eine große Kurve.
Vorne sammelt sich Stoßkraft und Wildheit
in der mächtigen Wampe. Der Kopf sitzt klein
auf dem gewaltigen Hals, gebändigt durch die
Aufzäumung. Das schwärzliche Material un-
terstützt farbig den Eindruck des Unheim-
lichen. Die Oberfläche zeigt rote Bemalungs-
spuren. Nur wenige Stücke mit Glasur wagte
man bisher in die unsichere Epoche zu setzen.
Bei dem unglasierten dunklen Ton war die
Datierung in die Übergangszeit — kurz nach
der Wei-Dynastie benannt — üblich. Das Ma-
lerial darf freilich nicht allein entscheiden.
Das seht nur in der Cassirer-Ausstelluns.
o . D
T’ang-Statuen sind dort sämtlich aus weißem
und rotem Ton, eine erlesene Auswahl. Bei
52