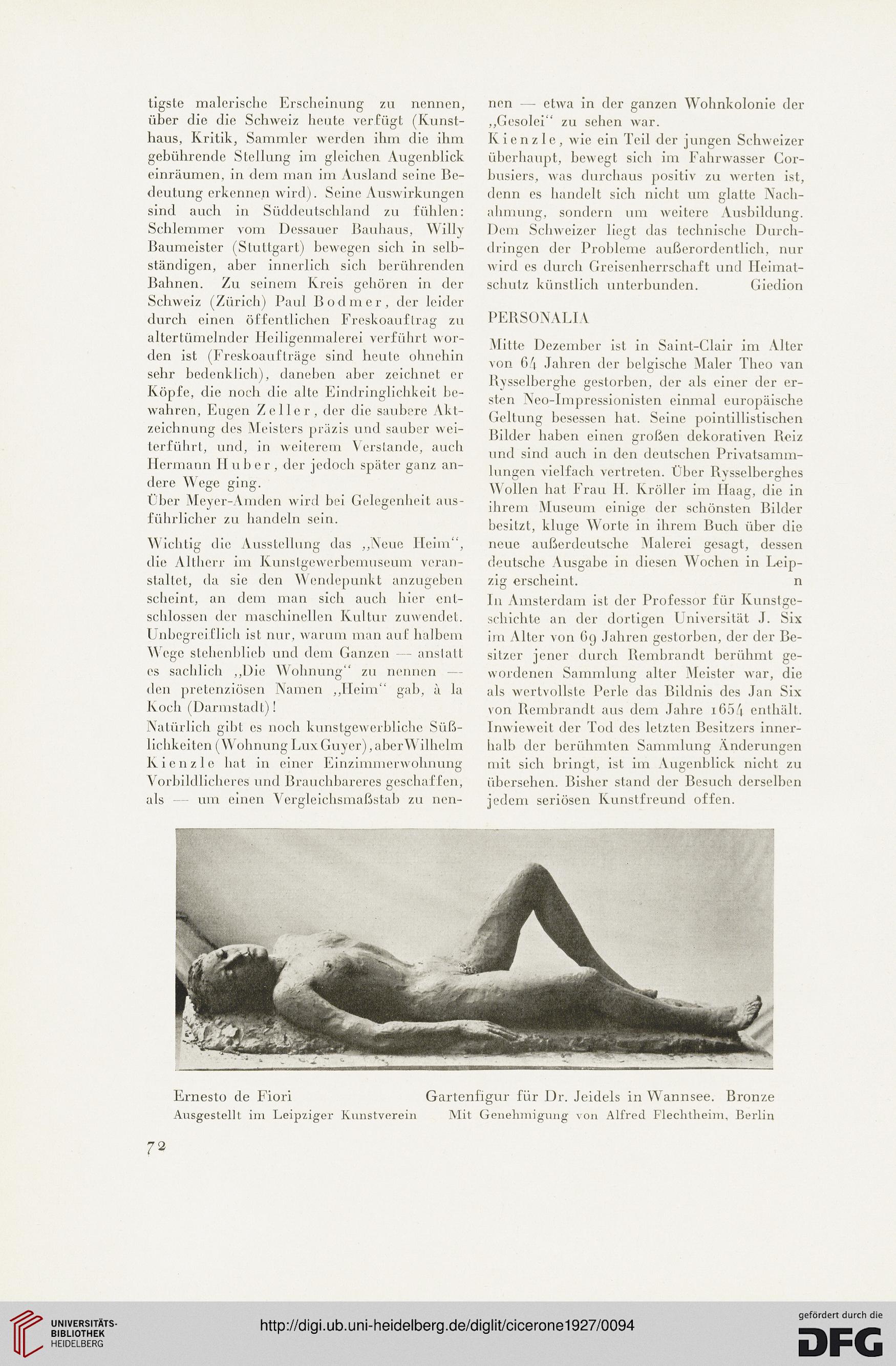tigste malerische Erscheinung zu nennen,
über die die Schweiz heute verfügt (Kunst-
haus, Kritik, Sammler werden ihm die ihm
gebührende Stellung im gleichen Augenblick
einräumen, in dem man im Ausland seine Be-
deutung erkennen wird). Seine Auswirkungen
sind auch in Süddeutschland zu fühlen:
Schlemmer vom Dessauer Bauhaus, Willy
Baumeister (Stuttgart) bewegen sich in selb-
ständigen, aber innerlich sich berührenden
Bahnen. Zu seinem Kreis gehören in der
Schweiz (Zürich) Paul Bodmer, der leider
durch einen öffentlichen Freskoauftrag zu
altertümelnder Heiligenmalerei verführt wor-
den ist (Freskoaufträge sind heute ohnehin
sehr bedenklich), daneben aber zeichnet er
Köpfe, die noch die alte Eindringlichkeit be-
wahren, Eugen Zeller, der die saubere Akt-
zeichnung des Meisters präzis und sauber wei-
terführt, und, in weiterem Verstände, auch
Hermann Huber, der jedoch später ganz an-
dere Wege ging.
Über Meyer-Amden wird bei Gelegenheit aus-
führlicher zu handeln sein.
Wichtig die Ausstellung das „Neue Heim“,
die Altherr im Kunstgewerbemuseum veran-
staltet, da sie den Wendepunkt anzugeben
scheint, an dem man sich auch hier ent-
schlossen der maschinellen Kultur zuwenclet.
Unbegreiflich ist nur, warum man auf halbem
Wege stehenblieb und dem Ganzen — anstatt
es sachlich „Die Wohnung“ zu nennen —
den pretenziösen Namen „Heim“ gab, ä la
Koch (Darmstadt)!
Natürlich gibt es noch kunstgewerbliche Süß-
lichkeiten (Wohnung Lux Guyer), aber Wilhelm
K i e n z 1 e hat in einer Einzimmerwohnung
Vorbildlicheres und Brauchbareres geschaffen,
als — um einen Vergleichsmaßstab zu nen-
nen — etwa in der ganzen Wohnkolonie der
„Gesolei“ zu sehen war.
IC i e n z 1 e, wie ein Teil der jungen Schweizer
überhaupt, bewegt sich im Fahrwasser Cor-
busiers, was durchaus positiv zu werten ist,
denn es handelt sich nicht um glatte Nach-
ahmung, sondern um weitere Ausbildung.
Dem Schweizer liegt das technische Durch-
dringen der Probleme außerordentlich, nur
wird es durch Greisenherrschaft und Heimat-
schutz künstlich unterbunden. Giedion
PERSONALIA
Mitte Dezember ist in Saint-Clair im Alter
von 64 Jahren der belgische Maler Theo van
Rysselberghe gestorben, der als einer der er-
sten Neo-Impressionisten einmal europäische
Geltung besessen hat. Seine pointillistischen
Bilder haben einen großen dekorativen Reiz
und sind auch in den deutschen Privatsamm-
lungen vielfach vertreten. Über Rysselberghes
Wollen hat Frau II. ICröller im Haag, die in
ihrem Museum einige der schönsten Bilder
besitzt, kluge Worte in ihrem Buch über die
neue außerdeutsche Malerei gesagt, dessen
deutsche Ausgabe in diesen Wochen in Leip-
zig erscheint. n
In Amsterdam ist der Professor für Kunstge-
schichte an der dortigen Universität ,1. Six
im Alter von 69 Jahren gestorben, der der Be-
sitzer jener durch Rembrandt berühmt ge-
wordenen Sammlung alter Meister war, die
als wertvollste Perle das Bildnis des Jan Six
von Rembrandt aus dem Jahre 1654 enthält.
Inwieweit der Tod des letzten Besitzers inner-
halb der berühmten Sammlung Änderungen
mit sich bringt, ist im Augenblick nicht zu
übersehen. Bisher stand der Besuch derselben
jedem seriösen Kunstfreund offen.
Ernesto de Fiori Gartenfigur für Dr. Jeidels in Wannsee. Bronze
Ausgestellt im Leipziger Kunstverein Mit Genehmigung von Alfred Flechtheim, Berlin
72
über die die Schweiz heute verfügt (Kunst-
haus, Kritik, Sammler werden ihm die ihm
gebührende Stellung im gleichen Augenblick
einräumen, in dem man im Ausland seine Be-
deutung erkennen wird). Seine Auswirkungen
sind auch in Süddeutschland zu fühlen:
Schlemmer vom Dessauer Bauhaus, Willy
Baumeister (Stuttgart) bewegen sich in selb-
ständigen, aber innerlich sich berührenden
Bahnen. Zu seinem Kreis gehören in der
Schweiz (Zürich) Paul Bodmer, der leider
durch einen öffentlichen Freskoauftrag zu
altertümelnder Heiligenmalerei verführt wor-
den ist (Freskoaufträge sind heute ohnehin
sehr bedenklich), daneben aber zeichnet er
Köpfe, die noch die alte Eindringlichkeit be-
wahren, Eugen Zeller, der die saubere Akt-
zeichnung des Meisters präzis und sauber wei-
terführt, und, in weiterem Verstände, auch
Hermann Huber, der jedoch später ganz an-
dere Wege ging.
Über Meyer-Amden wird bei Gelegenheit aus-
führlicher zu handeln sein.
Wichtig die Ausstellung das „Neue Heim“,
die Altherr im Kunstgewerbemuseum veran-
staltet, da sie den Wendepunkt anzugeben
scheint, an dem man sich auch hier ent-
schlossen der maschinellen Kultur zuwenclet.
Unbegreiflich ist nur, warum man auf halbem
Wege stehenblieb und dem Ganzen — anstatt
es sachlich „Die Wohnung“ zu nennen —
den pretenziösen Namen „Heim“ gab, ä la
Koch (Darmstadt)!
Natürlich gibt es noch kunstgewerbliche Süß-
lichkeiten (Wohnung Lux Guyer), aber Wilhelm
K i e n z 1 e hat in einer Einzimmerwohnung
Vorbildlicheres und Brauchbareres geschaffen,
als — um einen Vergleichsmaßstab zu nen-
nen — etwa in der ganzen Wohnkolonie der
„Gesolei“ zu sehen war.
IC i e n z 1 e, wie ein Teil der jungen Schweizer
überhaupt, bewegt sich im Fahrwasser Cor-
busiers, was durchaus positiv zu werten ist,
denn es handelt sich nicht um glatte Nach-
ahmung, sondern um weitere Ausbildung.
Dem Schweizer liegt das technische Durch-
dringen der Probleme außerordentlich, nur
wird es durch Greisenherrschaft und Heimat-
schutz künstlich unterbunden. Giedion
PERSONALIA
Mitte Dezember ist in Saint-Clair im Alter
von 64 Jahren der belgische Maler Theo van
Rysselberghe gestorben, der als einer der er-
sten Neo-Impressionisten einmal europäische
Geltung besessen hat. Seine pointillistischen
Bilder haben einen großen dekorativen Reiz
und sind auch in den deutschen Privatsamm-
lungen vielfach vertreten. Über Rysselberghes
Wollen hat Frau II. ICröller im Haag, die in
ihrem Museum einige der schönsten Bilder
besitzt, kluge Worte in ihrem Buch über die
neue außerdeutsche Malerei gesagt, dessen
deutsche Ausgabe in diesen Wochen in Leip-
zig erscheint. n
In Amsterdam ist der Professor für Kunstge-
schichte an der dortigen Universität ,1. Six
im Alter von 69 Jahren gestorben, der der Be-
sitzer jener durch Rembrandt berühmt ge-
wordenen Sammlung alter Meister war, die
als wertvollste Perle das Bildnis des Jan Six
von Rembrandt aus dem Jahre 1654 enthält.
Inwieweit der Tod des letzten Besitzers inner-
halb der berühmten Sammlung Änderungen
mit sich bringt, ist im Augenblick nicht zu
übersehen. Bisher stand der Besuch derselben
jedem seriösen Kunstfreund offen.
Ernesto de Fiori Gartenfigur für Dr. Jeidels in Wannsee. Bronze
Ausgestellt im Leipziger Kunstverein Mit Genehmigung von Alfred Flechtheim, Berlin
72