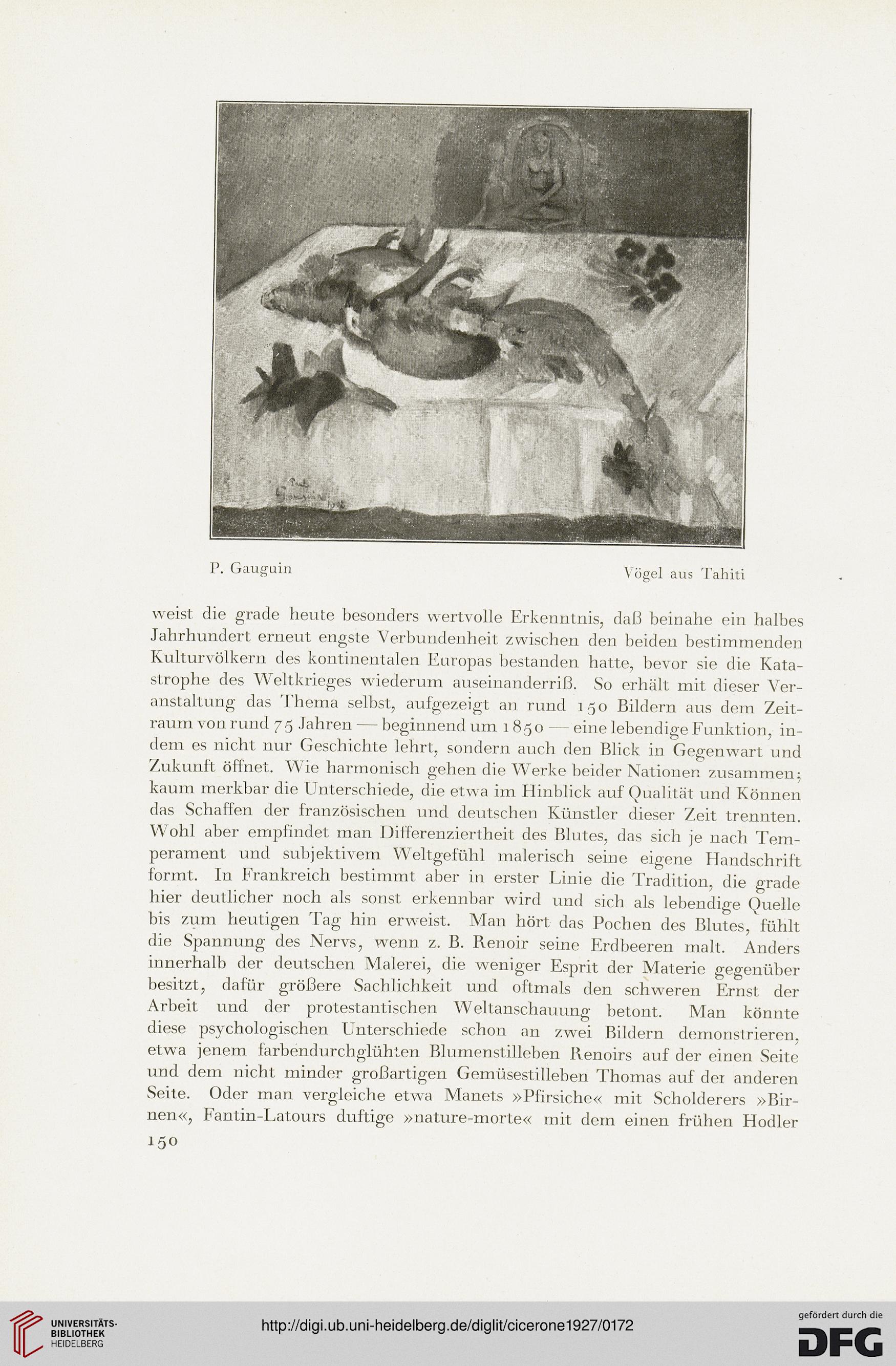Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0172
DOI issue:
Heft 5
DOI article:Biermann, Georg: Das Stillleben in der deutschen und französischen Malerei
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0172
P. Gauguin Vögel aus Tahiti
weist die grade heute besonders wertvolle Erkenntnis, daß beinahe ein halbes
Jahrhundert erneut engste Verbundenheit zwischen den beiden bestimmenden
Kulturvölkern des kontinentalen Europas bestanden hatte, bevor sie die Kata-
strophe des Weltkrieges wiederum auseinanderriß. So erhält mit dieser Ver-
anstaltung das Thema selbst, aufgezeigt an rund 150 Bildern aus dem Zeit-
raum von rund 75 Jahren — beginnend um 1850 — eine lebendige Funktion, in-
dem es nicht nur Geschichte lehrt, sondern auch den Blick in Gegenwart und
Zukunft öffnet. Wie harmonisch gehen die Werke beider Nationen zusammen 5
kaum merkbar die Unterschiede, die etwa im Hinblick auf Qualität und Können
das Schaffen der französischen und deutschen Künstler dieser Zeit trennten.
Wohl aber empfindet man Differenziertheit des Blutes, das sich je nach Tem-
perament und subjektivem Weltgefühl malerisch seine eigene Handschrift
formt. In Frankreich bestimmt aber in erster Linie die Tradition, die grade
hier deutlicher noch als sonst erkennbar wird und sich als lebendige Quelle
bis zum heutigen Tag hin erweist. Man hört das Pochen des Blutes, fühlt
die Spannung des Nervs, wenn z. B. Renoir seine Erdbeeren malt. Anders
innerhalb der deutschen Malerei, die weniger Esprit der Materie gegenüber
besitzt, dafür größere Sachlichkeit und oftmals den schweren Ernst der
Arbeit und der protestantischen Weltanschauung betont. Man könnte
diese psychologischen Unterschiede schon an zwei Bildern demonstrieren,
etwa jenem farbendurchglühten Blumenstilleben Renoirs auf der einen Seite
und dem nicht minder großartigen Gemüsestilleben Thomas auf dei anderen
Seite. Oder man vergleiche etwa Manets »Pfirsiche« mit Scholderers »Bir-
nen«, Fantin-Latours duftige »nature-morte« mit dem einen frühen Hodler
150