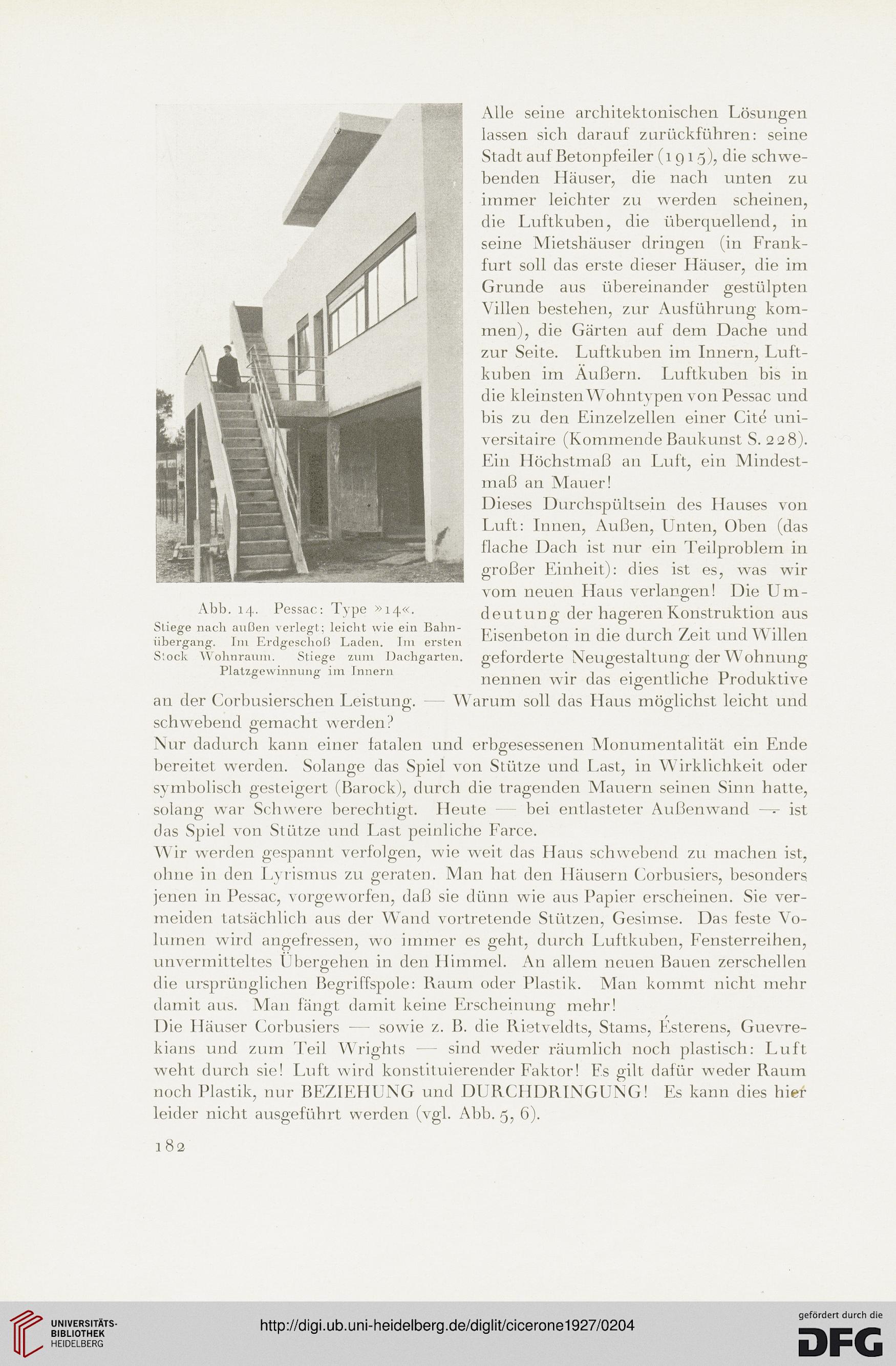Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0204
DOI issue:
Heft 6
DOI article:Giedion, Sigfried: Zur Situation der französischen Architektur, 2
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0204
Alle seine architektonischen Lösungen
lassen sich darauf zurückführen: seine
Stadt auf ßetonpfeiler (1915), die schwe-
benden Häuser, die nach unten zu
immer leichter zu werden scheinen,
die Luftkuben, die überquellend, in
seine Mietshäuser dringen (in Frank-
furt soll das erste dieser Häuser, die im
Grunde aus übereinander gestülpten
Villen bestehen, zur Ausführung kom-
men), die Gärten auf dem Dache und
zur Seite. Luftkuben im Innern, Luft-
kuben im Äußern. Luftkuben bis in
die kleinsten Wohntypen von Pessac und
bis zu den Einzelzellen einer Cite uni-
versitaire (Kommende Baukunst S. 228).
Ein Höchstmaß an Luft, ein Mindest-
maß an Mauer!
Dieses Durchspültsein des Hauses von
Luft: Innen, Außen, Unten, Oben (das
flache Dach ist nur ein Teilproblem in
großer Einheit): dies ist es, was wir
vom neuen Haus verlangen! Die Um-
deutung der hageren Konstruktion aus
Eisenbeton in die durch Zeit und Willen
geforderte Neugestaltung der Wohnung
nennen wir das eigentliche Produktive
an der Corbusierschen Leistung. -— Warum soll das Haus möglichst leicht und
schwebend gemacht werden?
Nur dadurch kann einer fatalen und erbgesessenen Monumentalität ein Ende
bereitet werden. Solange das Spiel von Stütze und Last, in Wirklichkeit oder
symbolisch gesteigert (Barock), durch die tragenden Mauern seinen Sinn hatte,
solang war Schwere berechtigt. Heute — bei entlasteter Außenwand —- ist
das Spiel von Stütze und Last peinliche Farce.
Wir werden gespannt verfolgen, wie weit das Haus schwebend zu machen ist,
ohne in den Lyrismus zu geraten. Man hat den Häusern Corbusiers, besonders
jenen in Pessac, vorgeworfen, daß sie dünn wie aus Papier erscheinen. Sie ver-
meiden tatsächlich aus der Wand vortretende Stützen, Gesimse. Das feste Vo-
lumen wird angefressen, wo immer es geht, durch Luftkuben, Fensterreihen,
unvermitteltes Übergehen in den Himmel. An allem neuen Bauen zerschellen
die ursprünglichen Begriffspole: Raum oder Plastik. Man kommt nicht mehr
damit aus. Man fängt damit keine Erscheinung mehr!
Die Häuser Corbusiers — sowie z. B. die Rietveldts, Stams, Esterens, Guevre-
kians und zum Teil Wrighls — sind weder räumlich noch plastisch: Luft
weht durch sie! Luft wird konstituierender Faktor! Fs gilt dafür weder Raum
noch Plastik, nur BEZIEHUNG und DURCHDRINGUNG! Es kann dies hier
leider nicht ausgeführt werden (vgl. Abb. 5, 6).
Abb. 14. Pessac: Type »L4«.
Stiege nach außen verlegt; leicht wie ein Bahn-
übergang. Im Erdgeschoß Laden. Im ersten
Stock Wohnraum. Stiege zum Dachgarten.
Platzgewinnung im Innern
lassen sich darauf zurückführen: seine
Stadt auf ßetonpfeiler (1915), die schwe-
benden Häuser, die nach unten zu
immer leichter zu werden scheinen,
die Luftkuben, die überquellend, in
seine Mietshäuser dringen (in Frank-
furt soll das erste dieser Häuser, die im
Grunde aus übereinander gestülpten
Villen bestehen, zur Ausführung kom-
men), die Gärten auf dem Dache und
zur Seite. Luftkuben im Innern, Luft-
kuben im Äußern. Luftkuben bis in
die kleinsten Wohntypen von Pessac und
bis zu den Einzelzellen einer Cite uni-
versitaire (Kommende Baukunst S. 228).
Ein Höchstmaß an Luft, ein Mindest-
maß an Mauer!
Dieses Durchspültsein des Hauses von
Luft: Innen, Außen, Unten, Oben (das
flache Dach ist nur ein Teilproblem in
großer Einheit): dies ist es, was wir
vom neuen Haus verlangen! Die Um-
deutung der hageren Konstruktion aus
Eisenbeton in die durch Zeit und Willen
geforderte Neugestaltung der Wohnung
nennen wir das eigentliche Produktive
an der Corbusierschen Leistung. -— Warum soll das Haus möglichst leicht und
schwebend gemacht werden?
Nur dadurch kann einer fatalen und erbgesessenen Monumentalität ein Ende
bereitet werden. Solange das Spiel von Stütze und Last, in Wirklichkeit oder
symbolisch gesteigert (Barock), durch die tragenden Mauern seinen Sinn hatte,
solang war Schwere berechtigt. Heute — bei entlasteter Außenwand —- ist
das Spiel von Stütze und Last peinliche Farce.
Wir werden gespannt verfolgen, wie weit das Haus schwebend zu machen ist,
ohne in den Lyrismus zu geraten. Man hat den Häusern Corbusiers, besonders
jenen in Pessac, vorgeworfen, daß sie dünn wie aus Papier erscheinen. Sie ver-
meiden tatsächlich aus der Wand vortretende Stützen, Gesimse. Das feste Vo-
lumen wird angefressen, wo immer es geht, durch Luftkuben, Fensterreihen,
unvermitteltes Übergehen in den Himmel. An allem neuen Bauen zerschellen
die ursprünglichen Begriffspole: Raum oder Plastik. Man kommt nicht mehr
damit aus. Man fängt damit keine Erscheinung mehr!
Die Häuser Corbusiers — sowie z. B. die Rietveldts, Stams, Esterens, Guevre-
kians und zum Teil Wrighls — sind weder räumlich noch plastisch: Luft
weht durch sie! Luft wird konstituierender Faktor! Fs gilt dafür weder Raum
noch Plastik, nur BEZIEHUNG und DURCHDRINGUNG! Es kann dies hier
leider nicht ausgeführt werden (vgl. Abb. 5, 6).
Abb. 14. Pessac: Type »L4«.
Stiege nach außen verlegt; leicht wie ein Bahn-
übergang. Im Erdgeschoß Laden. Im ersten
Stock Wohnraum. Stiege zum Dachgarten.
Platzgewinnung im Innern