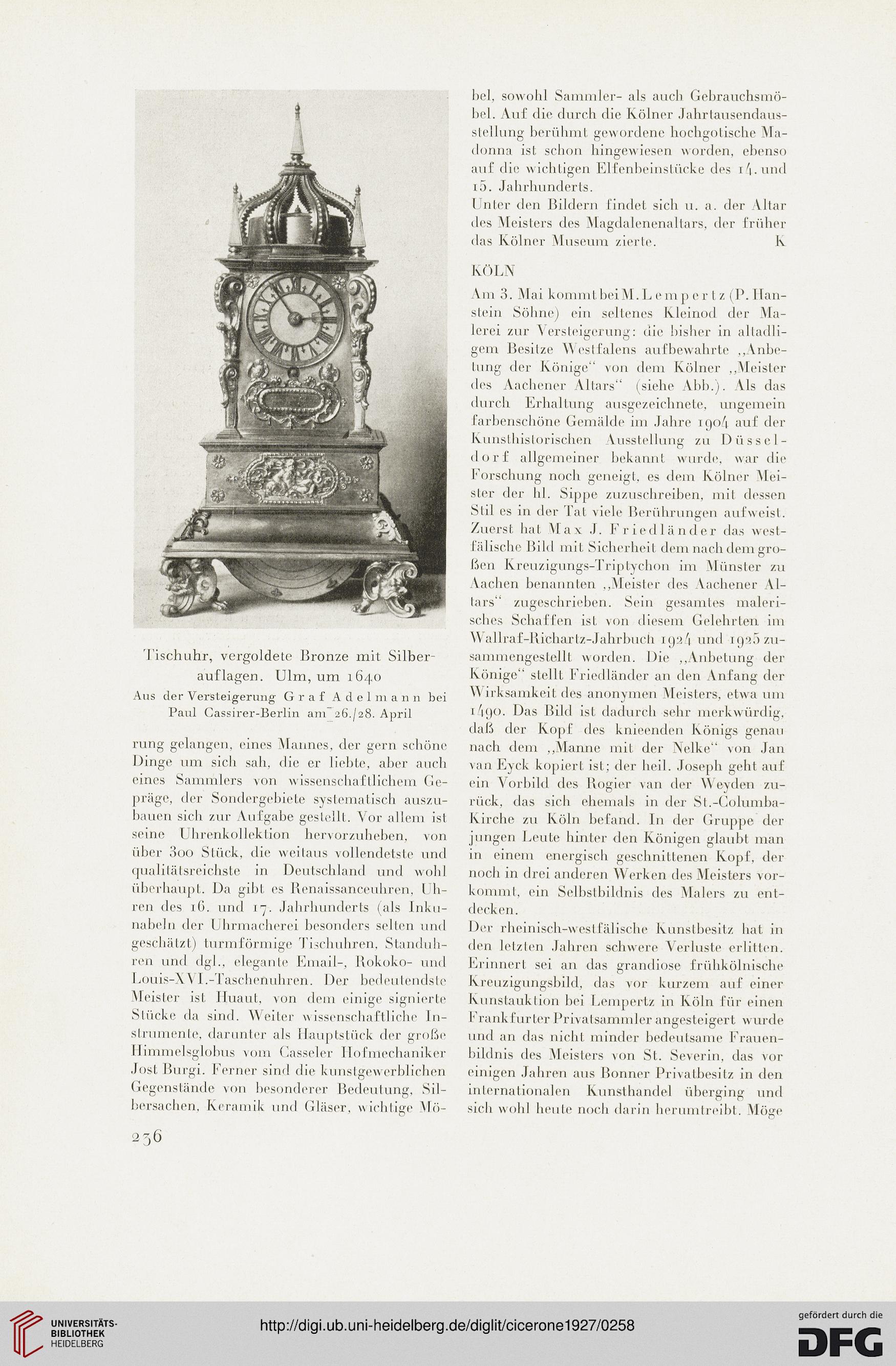!
Tischuhr, vergoldete Bronze mit Silber-
auflagen. Ulm, um 1640
Aus der Versteigerung Graf Adelmann bei
Paul Cassirer-Berlin am 26.)28. April
rung gelangen, eines Mannes, der gern schöne
Dinge um sich sah, die er liebte, aber auch
eines Sammlers von wissenschaftlichem Ge-
präge, der Sondergebiete systematisch auszu-
bauen sich zur Aufgabe gestellt. Vor allem ist
seine Uhrenkollektion hervorzuheben, von
über 3oo Stück, die weitaus vollendetste und
qualitätsreichste in Deutschland und wohl
überhaupt. Da gibt es Renaissanceuhren, Uh-
ren des 16. und 17. Jahrhunderts (als Inku-
nabeln der Uhrmacherei besonders selten und
geschätzt) turmförmige Tischuhren, Standuh-
ren und dgl., elegante Email-, Rokoko- und
Louis-XVI.-Taschenuhren. Der bedeutendste
Meister ist Huaut, von dem einige signierte
Stücke da sind. Weiter wissenschaftliche In-
strumente, darunter als Hauptstück der große
Himmelsglobus vom Casseler Hofmechaniker
Jost Burgi. Ferner sind die kunstgewerblichen
Gegenstände von besonderer Bedeutung, Sil-
bersachen, Keramik und Gläser, wichtige Mö-
bel, sowohl Sammler- als auch Gebrauchsmö-
bel. Auf die durch die Kölner Jahrtausendaus-
stellung berühmt gewordene hochgotische Ma-
donna ist schon hingewiesen worden, ebenso
auf die wichtigen Elfenbeinstücke des i4.und
i5. Jahrhunderts.
Unter den Bildern findet sich u. a. der Altar
des Meisters des Magdalenenaltars, der früher
das Kölner Museum zierte. K
KÖLN
Am 3. Mai kommt bei M. L empertz (P. Han-
stein Söhne) ein seltenes Kleinod der Ma-
lerei zur Versteigerung: die bisher in alladli-
gem Besitze Westfalens aufbewahrte „Anbe-
tung der Könige“ von dem Kölner „Meister
des Aachener Altars“ (siehe Abb.). Als das
durch Erhaltung ausgezeichnete, ungemein
farbenschöne Gemälde im Jahre 1904 auf der
Kunstlos torischen Ausstellung zu Düssel-
dorf allgemeiner bekannt wurde, war die
Forschung noch geneigt, es dem Kölner Mei-
ster der hl. Sippe zuzuschreiben, mit dessen
Stil es in der Tat viele Berührungen aufweist.
Zuerst hat Max J. Friedländer das west-
fälische Bild mit Sicherheit dem nach dem gro-
ßen Kreuzigungs-Triptychon im Münster zu
Aachen benannten „Meister des Aachener Al-
tars“ zugeschrieben. Sein gesamtes maleri-
sches Schaffen ist von diesem Gelehrten im
Wallraf-Bichartz-Jahr buch 192/1 und igaö zu-
sammengestellt worden. Die „Anbetung der
Könige“ stellt Friedländer an den Anfang der
Wirksamkeit des anonymen Meisters, etwa um
1)90. Das Bild ist dadurch sehr merkwürdig,
daß der Kopf des knieenden Königs genau
nach dem „Manne mit der Nelke“ von Jan
van Eyck kopiert ist; der heil. Joseph geht auf
ein Vorbild des Bogier van der Weyden zu-
rück, das sich ehemals in der St.-Cölumba-
Ivirche zu Köln befand. In der Gruppe der
jungen Leute hinter den Königen glaubt man
in einem energisch geschnittenen Kopf, der
noch in drei anderen Werken des Meisters vor-
kommt, ein Selbstbildnis des Malers zu ent-
decken.
Der rheinisch-westfälische Kunstbesitz hat in
den letzten Jahren schwere Verluste erlitten.
Erinnert sei an das grandiose frühkölnische
Kreuzigungsbild, das vor kurzem auf einer
Kunstauktion bei Lempertz in Köln für einen
Frankfurter Privatsammler angesteigert wurde
und an das nicht minder bedeutsame Frauen-
bildnis des Meisters von St. Severin, das vor
einigen Jahren aus Bonner Privatbesitz in den
internationalen Kunsthandel überging und
sich wohl heute noch darin herumtreibt. Möge
Tischuhr, vergoldete Bronze mit Silber-
auflagen. Ulm, um 1640
Aus der Versteigerung Graf Adelmann bei
Paul Cassirer-Berlin am 26.)28. April
rung gelangen, eines Mannes, der gern schöne
Dinge um sich sah, die er liebte, aber auch
eines Sammlers von wissenschaftlichem Ge-
präge, der Sondergebiete systematisch auszu-
bauen sich zur Aufgabe gestellt. Vor allem ist
seine Uhrenkollektion hervorzuheben, von
über 3oo Stück, die weitaus vollendetste und
qualitätsreichste in Deutschland und wohl
überhaupt. Da gibt es Renaissanceuhren, Uh-
ren des 16. und 17. Jahrhunderts (als Inku-
nabeln der Uhrmacherei besonders selten und
geschätzt) turmförmige Tischuhren, Standuh-
ren und dgl., elegante Email-, Rokoko- und
Louis-XVI.-Taschenuhren. Der bedeutendste
Meister ist Huaut, von dem einige signierte
Stücke da sind. Weiter wissenschaftliche In-
strumente, darunter als Hauptstück der große
Himmelsglobus vom Casseler Hofmechaniker
Jost Burgi. Ferner sind die kunstgewerblichen
Gegenstände von besonderer Bedeutung, Sil-
bersachen, Keramik und Gläser, wichtige Mö-
bel, sowohl Sammler- als auch Gebrauchsmö-
bel. Auf die durch die Kölner Jahrtausendaus-
stellung berühmt gewordene hochgotische Ma-
donna ist schon hingewiesen worden, ebenso
auf die wichtigen Elfenbeinstücke des i4.und
i5. Jahrhunderts.
Unter den Bildern findet sich u. a. der Altar
des Meisters des Magdalenenaltars, der früher
das Kölner Museum zierte. K
KÖLN
Am 3. Mai kommt bei M. L empertz (P. Han-
stein Söhne) ein seltenes Kleinod der Ma-
lerei zur Versteigerung: die bisher in alladli-
gem Besitze Westfalens aufbewahrte „Anbe-
tung der Könige“ von dem Kölner „Meister
des Aachener Altars“ (siehe Abb.). Als das
durch Erhaltung ausgezeichnete, ungemein
farbenschöne Gemälde im Jahre 1904 auf der
Kunstlos torischen Ausstellung zu Düssel-
dorf allgemeiner bekannt wurde, war die
Forschung noch geneigt, es dem Kölner Mei-
ster der hl. Sippe zuzuschreiben, mit dessen
Stil es in der Tat viele Berührungen aufweist.
Zuerst hat Max J. Friedländer das west-
fälische Bild mit Sicherheit dem nach dem gro-
ßen Kreuzigungs-Triptychon im Münster zu
Aachen benannten „Meister des Aachener Al-
tars“ zugeschrieben. Sein gesamtes maleri-
sches Schaffen ist von diesem Gelehrten im
Wallraf-Bichartz-Jahr buch 192/1 und igaö zu-
sammengestellt worden. Die „Anbetung der
Könige“ stellt Friedländer an den Anfang der
Wirksamkeit des anonymen Meisters, etwa um
1)90. Das Bild ist dadurch sehr merkwürdig,
daß der Kopf des knieenden Königs genau
nach dem „Manne mit der Nelke“ von Jan
van Eyck kopiert ist; der heil. Joseph geht auf
ein Vorbild des Bogier van der Weyden zu-
rück, das sich ehemals in der St.-Cölumba-
Ivirche zu Köln befand. In der Gruppe der
jungen Leute hinter den Königen glaubt man
in einem energisch geschnittenen Kopf, der
noch in drei anderen Werken des Meisters vor-
kommt, ein Selbstbildnis des Malers zu ent-
decken.
Der rheinisch-westfälische Kunstbesitz hat in
den letzten Jahren schwere Verluste erlitten.
Erinnert sei an das grandiose frühkölnische
Kreuzigungsbild, das vor kurzem auf einer
Kunstauktion bei Lempertz in Köln für einen
Frankfurter Privatsammler angesteigert wurde
und an das nicht minder bedeutsame Frauen-
bildnis des Meisters von St. Severin, das vor
einigen Jahren aus Bonner Privatbesitz in den
internationalen Kunsthandel überging und
sich wohl heute noch darin herumtreibt. Möge