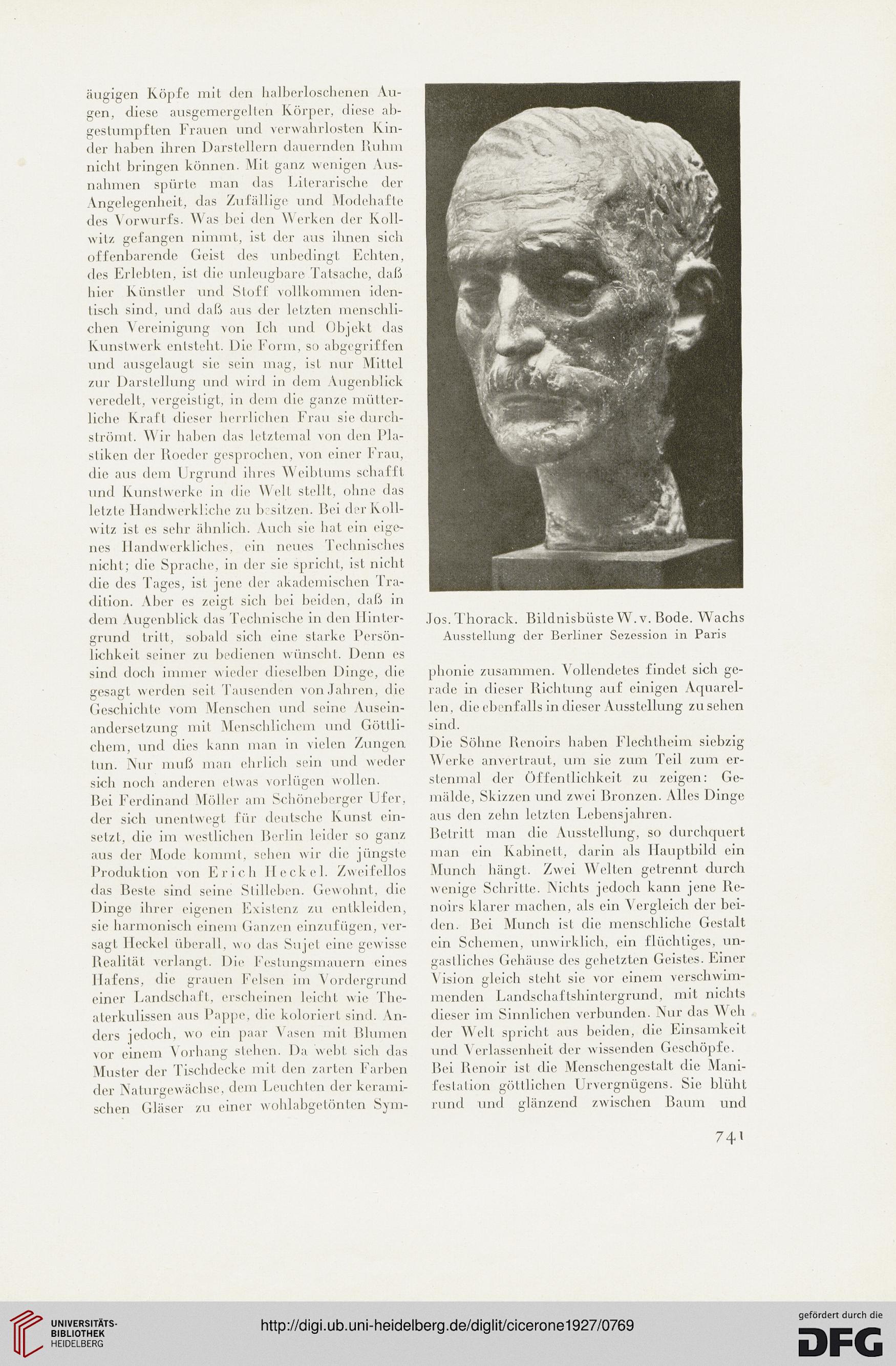äugigen Köpfe mit den halberloschenen Au-
gen, diese ausgemergelten Körper, diese ab-
gestumpften Frauen und verwahrlosten Kin-
der haben ihren Darstellern dauernden Ruhm
nicht bringen können. Mit ganz wenigen Aus-
nahmen spürte man das Literarische der
Angelegenheit, das Zufällige und Modehafte
des Vorwurfs. Was bei den Werken der Ivoll-
witz gefangen nimmt, ist der aus ihnen sich
offenbarende Geist des unbedingt Echten,
des Erlebten, ist die unleugbare Tatsache, daß
hier Künstler und Stoff vollkommen iden-
tisch sind, und daß aus der letzten menschli-
chen Vereinigung von Ich und Objekt das
Kunstwerk entsteht. Die Form, so abgegriffen
und ausgelaugt sie sein mag, ist nur Mittel
zur Darstellung und wird in dem Augenblick
veredelt, vergeistigt, in dem die ganze mütter-
liche Kraft dieser herrlichen Frau sie durch-
strömt. Wir haben das letztemal von den Pla-
stiken der Roeder gesprochen, von einer Frau,
die aus dem Urgrund ihres Weibtums schafft
und Kunstwerke; in die Welt stellt, ohne das
letzte Handwerkliche zu besitzen. Bei derKoll-
witz ist es sehr ähnlich. Auch sie hat ein eige-
nes Handwerkliches, ein neues Technisches
nicht; die Sprache, in der sie spricht, ist nicht
die des Tages, ist jene der akademischen Tra-
dition. Aber es zeigt sich bei beiden, daß in
dem Augenblick das Technische in den Hinter-
grund tritt, sobald sich eine starke Persön-
lichkeit seiner zu bedienen wünscht. Denn es
sind doch immer wieder dieselben Dinge, die
gesagt werden seit Tausenden von Jahren, die
Geschichte vom Menschen und seine Ausein-
andersetzung mit Menschlichem und Göttli-
chem, und dies kann man in vielen Zungen
tun. Nur muß man ehrlich sein und weder
sich noch anderen etwas vorlügen wollen.
Bei Ferdinand Möller am Schöneberger Ufer,
der sich unentwegt für deutsche Kunst cin-
setzt, die im westlichen Berlin leider so ganz
aus der Mode kommt, sehen wir die jüngste
Produktion von Erich Heckei. Zweifellos
das Beste sind seine Stilleben. Gewohnt, die
Dinge ihrer eigenen Existenz zu entkleiden,
sie harmonisch einem Ganzen einzufügen, ver-
sagt Heckei überall, wo das Sujet eine gewisse
Realität verlangt. Die Festungsmauern eines
Hafens, die grauen Felsen im Vordergrund
einer Landschaft, erscheinen leicht wie The-
aterkulissen aus Pappe, die koloriert sind. An-
ders jedoch, wo ein paar Vasen mit Blumen
vor einem Vorhang stehen. Da webt sich das
Muster der Tischdecke mit den zarten Farben
der Naturgewächse, dem Leuchten der kerami-
schen Gläser zu einer wohlabgetönten Sym-
.los. Thorack. Bildnisbüste W.v. Bode. Wachs
Ausstellung der Berliner Sezession in Paris
phonie zusammen. Vollendetes findet sich ge-
rade in dieser Richtung auf einigen Aquarel-
len, die ebenfalls in dieser Ausstellung zusehen
sind.
Die Söhne Renoirs haben Flechtheim siebzig
Werke anvertraut, um sie zum Teil zum er-
stenmal der Öffentlichkeit zu zeigen: Ge-
mälde, Skizzen und zwei Bronzen. Alles Dinge
aus den zehn letzten Lebensjahren.
Betritt man die Ausstellung, so durchquert
man ein Kabinett, darin als Hauptbild ein
Munch hängt. Zwei Welten getrennt durch
wenige Schritte. Nichts jedoch kann jene Re-
noirs klarer machen, als ein Vergleich der bei-
den. Bei Munch ist clie menschliche Gestalt
ein Schemen, unwirklich, ein flüchtiges, un-
gastliches Gehäuse des gehetzten Geistes. Einer
Vision gleich steht sie vor einem verschwim-
menden Landschaftshintergrund, mit nichts
dieser im Sinnlichen verbunden. Nur das Weh
der Welt spricht aus beiden, die Einsamkeit
und Verlassenheit der wissenden Geschöpfe.
Bei Renoir ist die Menschengestalt die Mani-
festation göttlichen Urvergnügens. Sie blüht
rund und glänzend zwischen Baum und
gen, diese ausgemergelten Körper, diese ab-
gestumpften Frauen und verwahrlosten Kin-
der haben ihren Darstellern dauernden Ruhm
nicht bringen können. Mit ganz wenigen Aus-
nahmen spürte man das Literarische der
Angelegenheit, das Zufällige und Modehafte
des Vorwurfs. Was bei den Werken der Ivoll-
witz gefangen nimmt, ist der aus ihnen sich
offenbarende Geist des unbedingt Echten,
des Erlebten, ist die unleugbare Tatsache, daß
hier Künstler und Stoff vollkommen iden-
tisch sind, und daß aus der letzten menschli-
chen Vereinigung von Ich und Objekt das
Kunstwerk entsteht. Die Form, so abgegriffen
und ausgelaugt sie sein mag, ist nur Mittel
zur Darstellung und wird in dem Augenblick
veredelt, vergeistigt, in dem die ganze mütter-
liche Kraft dieser herrlichen Frau sie durch-
strömt. Wir haben das letztemal von den Pla-
stiken der Roeder gesprochen, von einer Frau,
die aus dem Urgrund ihres Weibtums schafft
und Kunstwerke; in die Welt stellt, ohne das
letzte Handwerkliche zu besitzen. Bei derKoll-
witz ist es sehr ähnlich. Auch sie hat ein eige-
nes Handwerkliches, ein neues Technisches
nicht; die Sprache, in der sie spricht, ist nicht
die des Tages, ist jene der akademischen Tra-
dition. Aber es zeigt sich bei beiden, daß in
dem Augenblick das Technische in den Hinter-
grund tritt, sobald sich eine starke Persön-
lichkeit seiner zu bedienen wünscht. Denn es
sind doch immer wieder dieselben Dinge, die
gesagt werden seit Tausenden von Jahren, die
Geschichte vom Menschen und seine Ausein-
andersetzung mit Menschlichem und Göttli-
chem, und dies kann man in vielen Zungen
tun. Nur muß man ehrlich sein und weder
sich noch anderen etwas vorlügen wollen.
Bei Ferdinand Möller am Schöneberger Ufer,
der sich unentwegt für deutsche Kunst cin-
setzt, die im westlichen Berlin leider so ganz
aus der Mode kommt, sehen wir die jüngste
Produktion von Erich Heckei. Zweifellos
das Beste sind seine Stilleben. Gewohnt, die
Dinge ihrer eigenen Existenz zu entkleiden,
sie harmonisch einem Ganzen einzufügen, ver-
sagt Heckei überall, wo das Sujet eine gewisse
Realität verlangt. Die Festungsmauern eines
Hafens, die grauen Felsen im Vordergrund
einer Landschaft, erscheinen leicht wie The-
aterkulissen aus Pappe, die koloriert sind. An-
ders jedoch, wo ein paar Vasen mit Blumen
vor einem Vorhang stehen. Da webt sich das
Muster der Tischdecke mit den zarten Farben
der Naturgewächse, dem Leuchten der kerami-
schen Gläser zu einer wohlabgetönten Sym-
.los. Thorack. Bildnisbüste W.v. Bode. Wachs
Ausstellung der Berliner Sezession in Paris
phonie zusammen. Vollendetes findet sich ge-
rade in dieser Richtung auf einigen Aquarel-
len, die ebenfalls in dieser Ausstellung zusehen
sind.
Die Söhne Renoirs haben Flechtheim siebzig
Werke anvertraut, um sie zum Teil zum er-
stenmal der Öffentlichkeit zu zeigen: Ge-
mälde, Skizzen und zwei Bronzen. Alles Dinge
aus den zehn letzten Lebensjahren.
Betritt man die Ausstellung, so durchquert
man ein Kabinett, darin als Hauptbild ein
Munch hängt. Zwei Welten getrennt durch
wenige Schritte. Nichts jedoch kann jene Re-
noirs klarer machen, als ein Vergleich der bei-
den. Bei Munch ist clie menschliche Gestalt
ein Schemen, unwirklich, ein flüchtiges, un-
gastliches Gehäuse des gehetzten Geistes. Einer
Vision gleich steht sie vor einem verschwim-
menden Landschaftshintergrund, mit nichts
dieser im Sinnlichen verbunden. Nur das Weh
der Welt spricht aus beiden, die Einsamkeit
und Verlassenheit der wissenden Geschöpfe.
Bei Renoir ist die Menschengestalt die Mani-
festation göttlichen Urvergnügens. Sie blüht
rund und glänzend zwischen Baum und