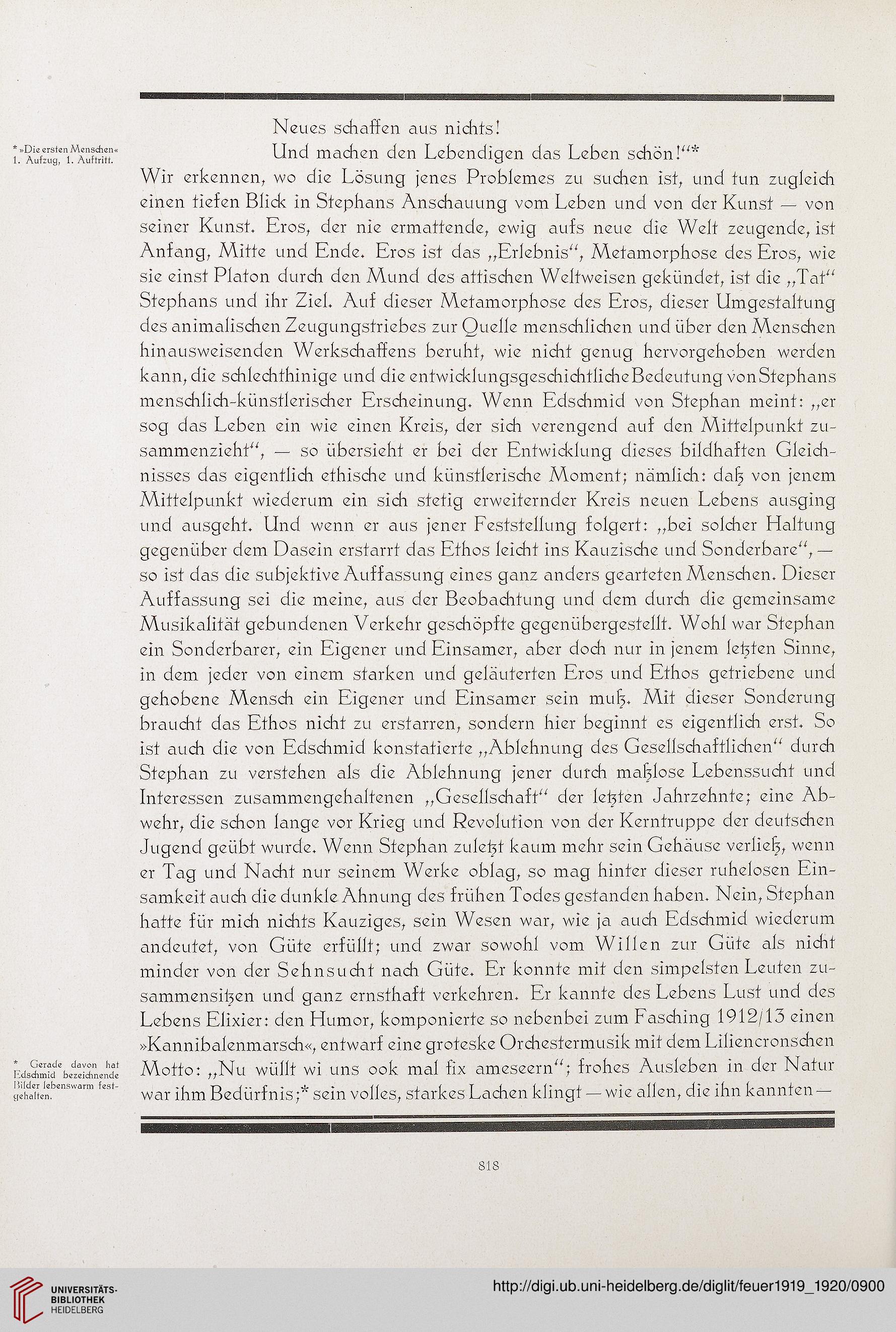Feuer: Monatsschrift für Kunst und künstlerische Kultur — 1.1919/1920
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.29152#0900
DOI Heft:
August-Heft
DOI Artikel:Holl, Karl: Rudi Stephan, Teil 2
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.29152#0900
* »Die ersten Menschen«
1. Aufzug, 1. Auftritt.
* Gerade davon hat
Edschmid bezeidinende
Bilder lebenswarm fest-
gehalten.
Neues schaffen aus nichts!
Und machen den Lebendigen das Leben schön!“*
Wir erkennen, wo die Lösung jenes Problemes zu suchen ist, und tun zugfeidr
einen tiefen Blick in Stephans Anschauung vom Leben und von der Kunst — von
seiner Kunst* Eros, der nie ermattende, ewig aufs neue die Welf zeugende, ist
Anfang, Mitte und Ende* Eros ist das „Erlebnis“, Metamorphose des Eros, wie
sie einst Platon durch den Mund des atfisdren Welfweisen gekündet, ist die „Tat“
Stephans und ihr Ziel* Auf dieser Metamorphose des Eros, dieser Umgestaltung
des animalischen Zeugungsfriebes zur Quelle menschlichen und über den Menschen
hinausweisenden Werkschaffens beruht, wie nicht genug hervorgehoben werden
kann, die schlechfhinige und die enfwicklungsgeschichfliche Bedeutung von Stephans
menschlich-künstlerischer Erscheinung. Wenn Edschmid von Stephan meint: „er
sog das Leben ein wie einen Kreis, der sich verengend auf den Mittelpunkt zu-
sammenziehf“, — so übersieht er bei der Entwicklung dieses bildhaften Gleidr-
nisses das eigentlich ethische und künstlerische Moment; nämlich: daf> von jenem
Mittelpunkt wiederum ein sidr stetig erweiternder Kreis neuen Lebens ausging
und ausgeht* Und wenn er aus jener Feststellung folgert: „bei solcher Haltung
gegenüber dem Dasein erstarrt das Ethos leicht ins Kauzische und Sonderbare“,—
so ist das die subjektive Auffassung eines ganz anders gearteten Menschen* Dieser
Auffassung sei die meine, aus der Beobadrtung und dem durch die gemeinsame
Musikalität gebundenen Verkehr geschöpfte gegenübergesfeilt. Wohl war Stephan
ein Sonderbarer, ein Eigener und Einsamer, aber doch nur in jenem lebten Sinne,
in dem jeder von einem starken und geläuterten Eros und Ethos getriebene und
gehobene Mensch ein Eigener und Einsamer sein mul^* Mit dieser Sonderung
braucht das Ethos nicht zu erstarren, sondern hier beginnt es eigentlich erst* So
ist auch die von Edsdimid konstatierte „Ablehnung des Gesellschaftlichen“ durch
Stephan zu verstehen als che Ablehnung jener durch maßlose Lebenssucht und
Interessen zusammengehalfenen „Gesellschaft“ der lebten Jahrzehnte; eine Ab-
wehr, die schon lange vor Krieg und Revolution von der Kernfruppe der deutschen
Jugend geübt wurde* Wenn Stephan zulebt kaum mehr sein Gehäuse verlief wenn
er Tag und Nacht nur seinem Werke oblag, so mag hinter dieser ruhelosen Ein-
samkeit audr die dunkle Ahnung des frühen Todes gestanden haben* Nein, Stephan
hafte für mich nichts Kauziges, sein Wesen war, wie ja audr Edschmid wiederum
andeutet, von Güte erfüllt; und zwar sowohl vom Willen zur Güte als nidrt
minder von der Sehnsucht nach Güte* Er konnte mit den simpelsten Leuten zu-
sammensihen und ganz ernsthaft verkehren. Er kannte des Lebens Lust und des
Lebens Elixier: den Humor, komponierte so nebenbei zum Fasching 1912/13 einen
»Kannibalenmarsch«, entwarf eine groteske Ordrestermusik mit dem Liliencronschen
Motto: „Nu wüllt wi uns ook mal fix ameseern“; frohes Ausleben in der Natur
war ihm Bedürfnis;* sein volles, starkes Lachen klingt — wie allen, die ihn kannten —
SIS
1. Aufzug, 1. Auftritt.
* Gerade davon hat
Edschmid bezeidinende
Bilder lebenswarm fest-
gehalten.
Neues schaffen aus nichts!
Und machen den Lebendigen das Leben schön!“*
Wir erkennen, wo die Lösung jenes Problemes zu suchen ist, und tun zugfeidr
einen tiefen Blick in Stephans Anschauung vom Leben und von der Kunst — von
seiner Kunst* Eros, der nie ermattende, ewig aufs neue die Welf zeugende, ist
Anfang, Mitte und Ende* Eros ist das „Erlebnis“, Metamorphose des Eros, wie
sie einst Platon durch den Mund des atfisdren Welfweisen gekündet, ist die „Tat“
Stephans und ihr Ziel* Auf dieser Metamorphose des Eros, dieser Umgestaltung
des animalischen Zeugungsfriebes zur Quelle menschlichen und über den Menschen
hinausweisenden Werkschaffens beruht, wie nicht genug hervorgehoben werden
kann, die schlechfhinige und die enfwicklungsgeschichfliche Bedeutung von Stephans
menschlich-künstlerischer Erscheinung. Wenn Edschmid von Stephan meint: „er
sog das Leben ein wie einen Kreis, der sich verengend auf den Mittelpunkt zu-
sammenziehf“, — so übersieht er bei der Entwicklung dieses bildhaften Gleidr-
nisses das eigentlich ethische und künstlerische Moment; nämlich: daf> von jenem
Mittelpunkt wiederum ein sidr stetig erweiternder Kreis neuen Lebens ausging
und ausgeht* Und wenn er aus jener Feststellung folgert: „bei solcher Haltung
gegenüber dem Dasein erstarrt das Ethos leicht ins Kauzische und Sonderbare“,—
so ist das die subjektive Auffassung eines ganz anders gearteten Menschen* Dieser
Auffassung sei die meine, aus der Beobadrtung und dem durch die gemeinsame
Musikalität gebundenen Verkehr geschöpfte gegenübergesfeilt. Wohl war Stephan
ein Sonderbarer, ein Eigener und Einsamer, aber doch nur in jenem lebten Sinne,
in dem jeder von einem starken und geläuterten Eros und Ethos getriebene und
gehobene Mensch ein Eigener und Einsamer sein mul^* Mit dieser Sonderung
braucht das Ethos nicht zu erstarren, sondern hier beginnt es eigentlich erst* So
ist auch die von Edsdimid konstatierte „Ablehnung des Gesellschaftlichen“ durch
Stephan zu verstehen als che Ablehnung jener durch maßlose Lebenssucht und
Interessen zusammengehalfenen „Gesellschaft“ der lebten Jahrzehnte; eine Ab-
wehr, die schon lange vor Krieg und Revolution von der Kernfruppe der deutschen
Jugend geübt wurde* Wenn Stephan zulebt kaum mehr sein Gehäuse verlief wenn
er Tag und Nacht nur seinem Werke oblag, so mag hinter dieser ruhelosen Ein-
samkeit audr die dunkle Ahnung des frühen Todes gestanden haben* Nein, Stephan
hafte für mich nichts Kauziges, sein Wesen war, wie ja audr Edschmid wiederum
andeutet, von Güte erfüllt; und zwar sowohl vom Willen zur Güte als nidrt
minder von der Sehnsucht nach Güte* Er konnte mit den simpelsten Leuten zu-
sammensihen und ganz ernsthaft verkehren. Er kannte des Lebens Lust und des
Lebens Elixier: den Humor, komponierte so nebenbei zum Fasching 1912/13 einen
»Kannibalenmarsch«, entwarf eine groteske Ordrestermusik mit dem Liliencronschen
Motto: „Nu wüllt wi uns ook mal fix ameseern“; frohes Ausleben in der Natur
war ihm Bedürfnis;* sein volles, starkes Lachen klingt — wie allen, die ihn kannten —
SIS