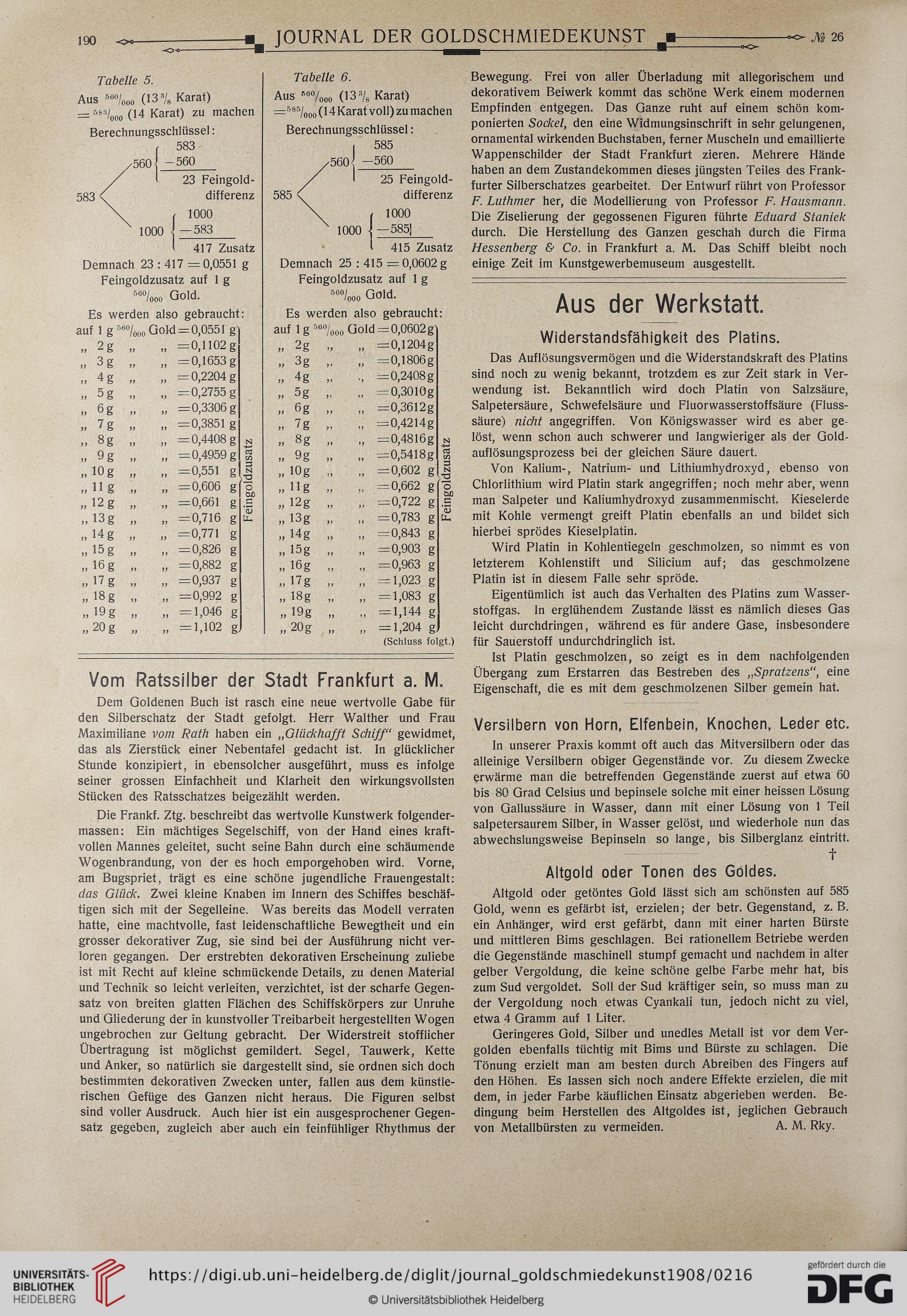« JOURNAL DER GOLDSCHMIEDEKUNST j
Ns 26
190
Tabelle 5.
Aus 660
000 (l*-
7s
Karat)
= B87000 (14 Karat) zu machen
Berechnungsschlüssel:
583
/560
560_
23 Feingold-
583
differenz
( 1000
1000
— 583
417 Zusatz
Demnach 23
417 =0,0551 g
Feingoldzusatz auf 1 g
B67ooo Gold.
Es werden also gebraucht
auf 1 g 560/ooo Gold=0,0551 g l
„ 2g
n
ff
=0,1102 g
„3g
ff
= 0,1653 g
„ 4g
h
ff
=0,2204 g
„5g
ff
=0,2755 g
„6g
,,
ff
= 0,3306 g
„ 7g
ff
ff
= 0,3851 g
„ 8g
ff
ff
= 0,4408 g
N
„9g
ff
ff
=0,4959 g
cn
„ 10 g
ff
ff
= 0,551 g
□
„Hg
ff
ff
= 0,606 g
"o
ÖZ)
„ 12 g
ff
ff
=0,661 g
„13g
ff
ff
=0,716 g
LU
„ 14 g
ff
ff
= 0,771 g
„ 15 g
ff
ff
= 0,826 g
„ 16 g
ff
ff
= 0,882 g
„ 17 g
ff
ff
= 0,937 g
„ 18 g
ff
ff
= 0,992 g
„ 19 g
ff
ff
= 1,046 g
„ 20 g
ff
ff
= 1,102 g
Tabelle 6.
Aus ß60/000 (133/8 Karat)
=585/000 (14 Karat voll) zu machen
Berechnungsschlüssel:
585
• 585
560 -560
I 25 Feingold-
differenz
| 1000
1000 1 — 585|
I 415 Zusatz
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g>
C
Demnach 25 : 415 = 0,0602 g
Feingoldzusatz auf 1 g
56O/ooo Gold.
Es werden also gebraucht:
auf 1 g 56%Oo Gold = 0,0602 g
„ 2g „ „ =0,1204g
„ 3g „ „ =0,1806g
„ 4g „ ., = 0,2408 g
„ 5g „ „ =0,3010g
„ 6g „ „ =0,3612g
„ 7g „ „ =0,4214g
„ 8g „ „ =0,4816g n
„ 9g „ „ =0,5418g 5
„ 10g „ „ =0,602
„11g „ „ =0,662
„12g „ „ =0,722
„13g „ „ =0,783
„14g „ „ =0,843
„15g „ „ =0,903
„16g „ „ =0,963
„17g „ „ =1,023
„ 18 g „ „ =1,083
„19g „ „ =1,144
„20g „ „ =1,204
(Schluss folgt.)
Vom Ratssilber der Stadt Frankfurt a. M.
Dem Goldenen Buch ist rasch eine neue wertvolle Gabe für
den Silberschatz der Stadt gefolgt. Herr Walther und Frau
Maximiliane vom Rath haben ein „Glückhafft Schiff“ gewidmet,
das als Zierstück einer Nebentafel gedacht ist. In glücklicher
Stunde konzipiert, in ebensolcher ausgeführt, muss es infolge
seiner grossen Einfachheit und Klarheit den wirkungsvollsten
Stücken des Ratsschatzes beigezählt werden.
Die Frankf. Ztg. beschreibt das wertvolle Kunstwerk folgender-
massen: Ein mächtiges Segelschiff, von der Hand eines kraft-
vollen Mannes geleitet, sucht seine Bahn durch eine schäumende
Wogenbrandung, von der es hoch emporgehoben wird. Vorne,
am Bugspriet, trägt es eine schöne jugendliche Frauengestalt:
das Glück. Zwei kleine Knaben im Innern des Schiffes beschäf-
tigen sich mit der Segelleine. Was bereits das Modell verraten
hatte, eine machtvolle, fast leidenschaftliche Bewegtheit und ein
grosser dekorativer Zug, sie sind bei der Ausführung nicht ver-
loren gegangen. Der erstrebten dekorativen Erscheinung zuliebe
ist mit Recht auf kleine schmückende Details, zu denen Material
und Technik so leicht verleiten, verzichtet, ist der scharfe Gegen-
satz von breiten glatten Flächen des Schiffskörpers zur Unruhe
und Gliederung der in kunstvoller Treibarbeit hergestellten Wogen
ungebrochen zur Geltung gebracht. Der Widerstreit stofflicher
Übertragung ist möglichst gemildert. Segel, Tauwerk, Kette
und Anker, so natürlich sie dargestellt sind, sie ordnen sich doch
bestimmten dekorativen Zwecken unter, fallen aus dem künstle-
rischen Gefüge des Ganzen nicht heraus. Die Figuren selbst
sind voller Ausdruck. Auch hier ist ein ausgesprochener Gegen-
satz gegeben, zugleich aber auch ein feinfühliger Rhythmus der
Bewegung. Frei von aller Überladung mit allegorischem und
dekorativem Beiwerk kommt das schöne Werk einem modernen
Empfinden entgegen. Das Ganze ruht auf einem schön kom-
ponierten Sockel, den eine Widmungsinschrift in sehr gelungenen,
ornamental wirkenden Buchstaben, ferner Muscheln und emaillierte
Wappenschilder der Stadt Frankfurt zieren. Mehrere Hände
haben an dem Zustandekommen dieses jüngsten Teiles des Frank-
furter Silberschatzes gearbeitet. Der Entwurf rührt von Professor
F. Luthmer her, die Modellierung von Professor F. Hausmann.
Die Ziselierung der gegossenen Figuren führte Eduard Staniek
durch. Die Herstellung des Ganzen geschah durch die Firma
Hessenberg & Co. in Frankfurt a. M. Das Schiff bleibt noch
einige Zeit im Kunstgewerbemuseum ausgestellt.
Aus der Werkstatt.
Widerstandsfähigkeit des Platins.
Das Auflösungsvermögen und die Widerstandskraft des Platins
sind noch zu wenig bekannt, trotzdem es zur Zeit stark in Ver-
wendung ist. Bekanntlich wird doch Platin von Salzsäure,
Salpetersäure, Schwefelsäure und Fluorwasserstoffsäure (Fluss-
säure) nicht angegriffen. Von Königswasser wird es aber ge-
löst, wenn schon auch schwerer und langwieriger als der Gold-
auflösungsprozess bei der gleichen Säure dauert.
Von Kalium-, Natrium- und Lithiumhydroxyd, ebenso von
Chlorlithium wird Platin stark angegriffen; noch mehr aber, wenn
man Salpeter und Kaliumhydroxyd zusammenmischt. Kieselerde
mit Kohle vermengt greift Platin ebenfalls an und bildet sich
hierbei sprödes Kieselplatin.
Wird Platin in Kohlentiegeln geschmolzen, so nimmt es von
letzterem Kohlenstift und Silicium auf; das geschmolzene
Platin ist in diesem Falle sehr spröde.
Eigentümlich ist auch das Verhalten des Platins zum Wasser-
stoffgas. In erglühendem Zustande lässt es nämlich dieses Gas
leicht durchdringen, während es für andere Gase, insbesondere
für Sauerstoff undurchdringlich ist.
Ist Platin geschmolzen, so zeigt es in dem nachfolgenden
Übergang zum Erstarren das Bestreben des „Spratzens“, eine
Eigenschaft, die es mit dem geschmolzenen Silber gemein hat.
Versilbern von Horn, Elfenbein, Knochen, Leder etc.
In unserer Praxis kommt oft auch das Mitversilbern oder das
alleinige Versilbern obiger Gegenstände vor. Zu diesem Zwecke
erwärme man die betreffenden Gegenstände zuerst auf etwa 60
bis 80 Grad Celsius und bepinsele solche mit einer heissen Lösung
von Gallussäure in Wasser, dann mit einer Lösung von 1 Teil
salpetersaurem Silber, in Wasser gelöst, und wiederhole nun das
abwechslungsweise Bepinseln so lange, bis Silberglanz eintritt.
- t
Altgold oder Tonen des Goldes.
Altgold oder getöntes Gold lässt sich am schönsten auf 585
Gold, wenn es gefärbt ist, erzielen; der betr. Gegenstand, z. B.
ein Anhänger, wird erst gefärbt, dann mit einer harten Bürste
und mittleren Bims geschlagen. Bei rationellem Betriebe werden
die Gegenstände maschinell stumpf gemacht und nachdem in alter
gelber Vergoldung, die keine schöne gelbe Farbe mehr hat, bis
zum Sud vergoldet. Soll der Sud kräftiger sein, so muss man zu
der Vergoldung noch etwas Cyankali tun, jedoch nicht zu viel,
etwa 4 Gramm auf 1 Liter.
Geringeres Gold, Silber und unedles Metall ist vor dem Ver-
golden ebenfalls tüchtig mit Bims und Bürste zu schlagen. Die
Tönung erzielt man am besten durch Abreiben des Fingers auf
den Höhen. Es lassen sich noch andere Effekte erzielen, die mit
dem, in jeder Farbe käuflichen Einsatz abgerieben werden. Be-
dingung beim Herstellen des Altgoldes ist, jeglichen Gebrauch
von Metallbürsten zu vermeiden. A. M. Rky.
Ns 26
190
Tabelle 5.
Aus 660
000 (l*-
7s
Karat)
= B87000 (14 Karat) zu machen
Berechnungsschlüssel:
583
/560
560_
23 Feingold-
583
differenz
( 1000
1000
— 583
417 Zusatz
Demnach 23
417 =0,0551 g
Feingoldzusatz auf 1 g
B67ooo Gold.
Es werden also gebraucht
auf 1 g 560/ooo Gold=0,0551 g l
„ 2g
n
ff
=0,1102 g
„3g
ff
= 0,1653 g
„ 4g
h
ff
=0,2204 g
„5g
ff
=0,2755 g
„6g
,,
ff
= 0,3306 g
„ 7g
ff
ff
= 0,3851 g
„ 8g
ff
ff
= 0,4408 g
N
„9g
ff
ff
=0,4959 g
cn
„ 10 g
ff
ff
= 0,551 g
□
„Hg
ff
ff
= 0,606 g
"o
ÖZ)
„ 12 g
ff
ff
=0,661 g
„13g
ff
ff
=0,716 g
LU
„ 14 g
ff
ff
= 0,771 g
„ 15 g
ff
ff
= 0,826 g
„ 16 g
ff
ff
= 0,882 g
„ 17 g
ff
ff
= 0,937 g
„ 18 g
ff
ff
= 0,992 g
„ 19 g
ff
ff
= 1,046 g
„ 20 g
ff
ff
= 1,102 g
Tabelle 6.
Aus ß60/000 (133/8 Karat)
=585/000 (14 Karat voll) zu machen
Berechnungsschlüssel:
585
• 585
560 -560
I 25 Feingold-
differenz
| 1000
1000 1 — 585|
I 415 Zusatz
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g>
C
Demnach 25 : 415 = 0,0602 g
Feingoldzusatz auf 1 g
56O/ooo Gold.
Es werden also gebraucht:
auf 1 g 56%Oo Gold = 0,0602 g
„ 2g „ „ =0,1204g
„ 3g „ „ =0,1806g
„ 4g „ ., = 0,2408 g
„ 5g „ „ =0,3010g
„ 6g „ „ =0,3612g
„ 7g „ „ =0,4214g
„ 8g „ „ =0,4816g n
„ 9g „ „ =0,5418g 5
„ 10g „ „ =0,602
„11g „ „ =0,662
„12g „ „ =0,722
„13g „ „ =0,783
„14g „ „ =0,843
„15g „ „ =0,903
„16g „ „ =0,963
„17g „ „ =1,023
„ 18 g „ „ =1,083
„19g „ „ =1,144
„20g „ „ =1,204
(Schluss folgt.)
Vom Ratssilber der Stadt Frankfurt a. M.
Dem Goldenen Buch ist rasch eine neue wertvolle Gabe für
den Silberschatz der Stadt gefolgt. Herr Walther und Frau
Maximiliane vom Rath haben ein „Glückhafft Schiff“ gewidmet,
das als Zierstück einer Nebentafel gedacht ist. In glücklicher
Stunde konzipiert, in ebensolcher ausgeführt, muss es infolge
seiner grossen Einfachheit und Klarheit den wirkungsvollsten
Stücken des Ratsschatzes beigezählt werden.
Die Frankf. Ztg. beschreibt das wertvolle Kunstwerk folgender-
massen: Ein mächtiges Segelschiff, von der Hand eines kraft-
vollen Mannes geleitet, sucht seine Bahn durch eine schäumende
Wogenbrandung, von der es hoch emporgehoben wird. Vorne,
am Bugspriet, trägt es eine schöne jugendliche Frauengestalt:
das Glück. Zwei kleine Knaben im Innern des Schiffes beschäf-
tigen sich mit der Segelleine. Was bereits das Modell verraten
hatte, eine machtvolle, fast leidenschaftliche Bewegtheit und ein
grosser dekorativer Zug, sie sind bei der Ausführung nicht ver-
loren gegangen. Der erstrebten dekorativen Erscheinung zuliebe
ist mit Recht auf kleine schmückende Details, zu denen Material
und Technik so leicht verleiten, verzichtet, ist der scharfe Gegen-
satz von breiten glatten Flächen des Schiffskörpers zur Unruhe
und Gliederung der in kunstvoller Treibarbeit hergestellten Wogen
ungebrochen zur Geltung gebracht. Der Widerstreit stofflicher
Übertragung ist möglichst gemildert. Segel, Tauwerk, Kette
und Anker, so natürlich sie dargestellt sind, sie ordnen sich doch
bestimmten dekorativen Zwecken unter, fallen aus dem künstle-
rischen Gefüge des Ganzen nicht heraus. Die Figuren selbst
sind voller Ausdruck. Auch hier ist ein ausgesprochener Gegen-
satz gegeben, zugleich aber auch ein feinfühliger Rhythmus der
Bewegung. Frei von aller Überladung mit allegorischem und
dekorativem Beiwerk kommt das schöne Werk einem modernen
Empfinden entgegen. Das Ganze ruht auf einem schön kom-
ponierten Sockel, den eine Widmungsinschrift in sehr gelungenen,
ornamental wirkenden Buchstaben, ferner Muscheln und emaillierte
Wappenschilder der Stadt Frankfurt zieren. Mehrere Hände
haben an dem Zustandekommen dieses jüngsten Teiles des Frank-
furter Silberschatzes gearbeitet. Der Entwurf rührt von Professor
F. Luthmer her, die Modellierung von Professor F. Hausmann.
Die Ziselierung der gegossenen Figuren führte Eduard Staniek
durch. Die Herstellung des Ganzen geschah durch die Firma
Hessenberg & Co. in Frankfurt a. M. Das Schiff bleibt noch
einige Zeit im Kunstgewerbemuseum ausgestellt.
Aus der Werkstatt.
Widerstandsfähigkeit des Platins.
Das Auflösungsvermögen und die Widerstandskraft des Platins
sind noch zu wenig bekannt, trotzdem es zur Zeit stark in Ver-
wendung ist. Bekanntlich wird doch Platin von Salzsäure,
Salpetersäure, Schwefelsäure und Fluorwasserstoffsäure (Fluss-
säure) nicht angegriffen. Von Königswasser wird es aber ge-
löst, wenn schon auch schwerer und langwieriger als der Gold-
auflösungsprozess bei der gleichen Säure dauert.
Von Kalium-, Natrium- und Lithiumhydroxyd, ebenso von
Chlorlithium wird Platin stark angegriffen; noch mehr aber, wenn
man Salpeter und Kaliumhydroxyd zusammenmischt. Kieselerde
mit Kohle vermengt greift Platin ebenfalls an und bildet sich
hierbei sprödes Kieselplatin.
Wird Platin in Kohlentiegeln geschmolzen, so nimmt es von
letzterem Kohlenstift und Silicium auf; das geschmolzene
Platin ist in diesem Falle sehr spröde.
Eigentümlich ist auch das Verhalten des Platins zum Wasser-
stoffgas. In erglühendem Zustande lässt es nämlich dieses Gas
leicht durchdringen, während es für andere Gase, insbesondere
für Sauerstoff undurchdringlich ist.
Ist Platin geschmolzen, so zeigt es in dem nachfolgenden
Übergang zum Erstarren das Bestreben des „Spratzens“, eine
Eigenschaft, die es mit dem geschmolzenen Silber gemein hat.
Versilbern von Horn, Elfenbein, Knochen, Leder etc.
In unserer Praxis kommt oft auch das Mitversilbern oder das
alleinige Versilbern obiger Gegenstände vor. Zu diesem Zwecke
erwärme man die betreffenden Gegenstände zuerst auf etwa 60
bis 80 Grad Celsius und bepinsele solche mit einer heissen Lösung
von Gallussäure in Wasser, dann mit einer Lösung von 1 Teil
salpetersaurem Silber, in Wasser gelöst, und wiederhole nun das
abwechslungsweise Bepinseln so lange, bis Silberglanz eintritt.
- t
Altgold oder Tonen des Goldes.
Altgold oder getöntes Gold lässt sich am schönsten auf 585
Gold, wenn es gefärbt ist, erzielen; der betr. Gegenstand, z. B.
ein Anhänger, wird erst gefärbt, dann mit einer harten Bürste
und mittleren Bims geschlagen. Bei rationellem Betriebe werden
die Gegenstände maschinell stumpf gemacht und nachdem in alter
gelber Vergoldung, die keine schöne gelbe Farbe mehr hat, bis
zum Sud vergoldet. Soll der Sud kräftiger sein, so muss man zu
der Vergoldung noch etwas Cyankali tun, jedoch nicht zu viel,
etwa 4 Gramm auf 1 Liter.
Geringeres Gold, Silber und unedles Metall ist vor dem Ver-
golden ebenfalls tüchtig mit Bims und Bürste zu schlagen. Die
Tönung erzielt man am besten durch Abreiben des Fingers auf
den Höhen. Es lassen sich noch andere Effekte erzielen, die mit
dem, in jeder Farbe käuflichen Einsatz abgerieben werden. Be-
dingung beim Herstellen des Altgoldes ist, jeglichen Gebrauch
von Metallbürsten zu vermeiden. A. M. Rky.