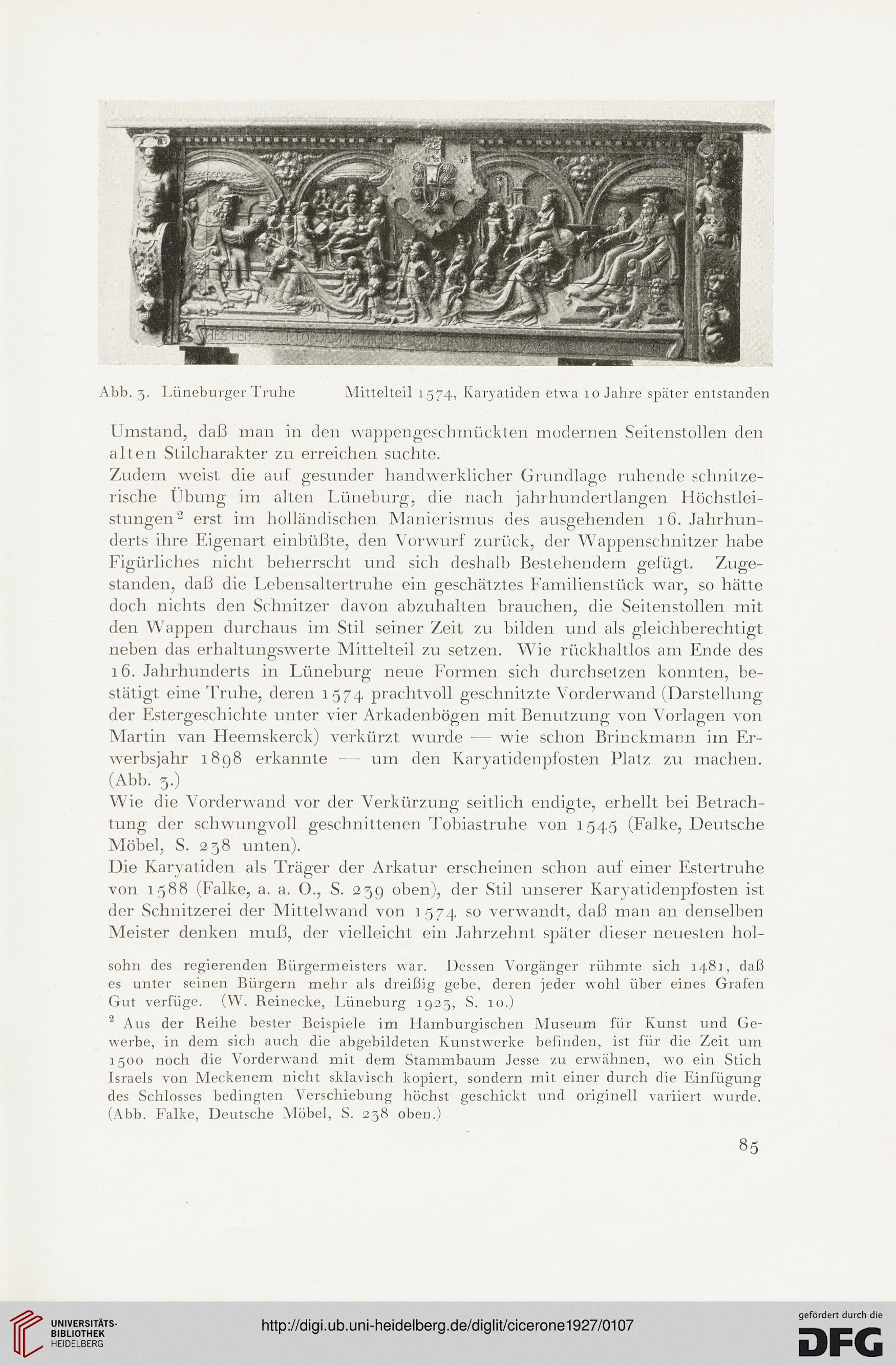Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0107
DOI Heft:
Heft 3
DOI Artikel:Kohlhaussen, Heinrich: Über eine gotische Lüneburger Truhe
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0107
Abb. 3. Lüneburger Truhe Mittelteil 1574, Karyatiden etwa 10 Jahre später entstanden
Umstand, daß man in den wappengeschmückten modernen Seitenstollen den
alten Stilcharakter zu erreichen suchte.
Zudem weist die auf gesunder handwerklicher Grundlage ruhende schnitze-
rische Übung im allen Lüneburg, die nach jahrhundertlangen Höchstlei-
stungen2 erst im holländischen Manierismus des ausgehenden 16. Jahrhun-
derts ihre Eigenart einbüßte, den Vorwurf zurück, der Wappenschnitzer habe
Figürliches nicht beherrscht und sich deshalb Bestehendem gefügt. Zuge-
standen, daß die Lebensaltertruhe ein geschätztes Familienstück war, so hätte
doch nichts den Schnitzer davon abzuhalten brauchen, die Seitenstollen mit
den Wappen durchaus im Stil seiner Zeit zu bilden und als gleichberechtigt
neben das erhaltungswerte Mittelteil zu setzen. Wie rückhaltlos am Ende des
16. Jahrhunderts in Lüneburg neue Formen sich durchsetzen konnten, be-
stätigt eine Truhe, deren 1574 prachtvoll geschnitzte Vorderwand (Darstellung
der Estergeschichte unter vier Arkadenbögen mit Benutzung von Vorlagen von
Martin van Heemskerck) verkürzt wurde — wie schon Brinckmann im Er-
werbsjahr 1898 erkannte — um den Karyatidenpfosten Platz zu machen.
(Abb. 3.)
Wie die Vorderwand vor der Verkürzung seitlich endigte, erhellt bei Betrach-
tung der schwungvoll geschnittenen Tobiastruhe von 1545 (Falke, Deutsche
Möbel, S. 238 unten).
Die Karyatiden als Träger der Arkatur erscheinen schon auf einer Estertruhe
von 1588 (Falke, a. a. O., S. 23g oben), der Stil unserer Karyatidenpfosten ist
der Schnitzerei der Mittelwand von 1574 so verwandt, daß man an denselben
Meister denken muß, der vielleicht ein Jahrzehnt später dieser neuesten hol-
sohn des regierenden Bürgermeisters war. Dessen Vorgänger rühmte sich 1481, daß
es unter seinen Bürgern mehr als dreißig gebe, deren jeder wohl über eines Grafen
Gut verfüge. (W. Reinecke, Lüneburg 1923, S. 10.)
2 Aus der Reihe bester Beispiele im Hamburgischen Museum für Kunst und Ge-
werbe, in dem sich auch die abgebildeten Kunstwerke befinden, ist für die Zeit um
1500 noch die Vorderwand mit dem Stammbaum Jesse zu erwähnen, wo ein Stich
Israels von Meckenem nicht sklavisch kopiert, sondern mit einer durch die Einfügung
des Schlosses bedingten Verschiebung höchst geschickt und originell variiert wurde.
(Abb. Falke, Deutsche Möbel, S. 238 oben.)
85