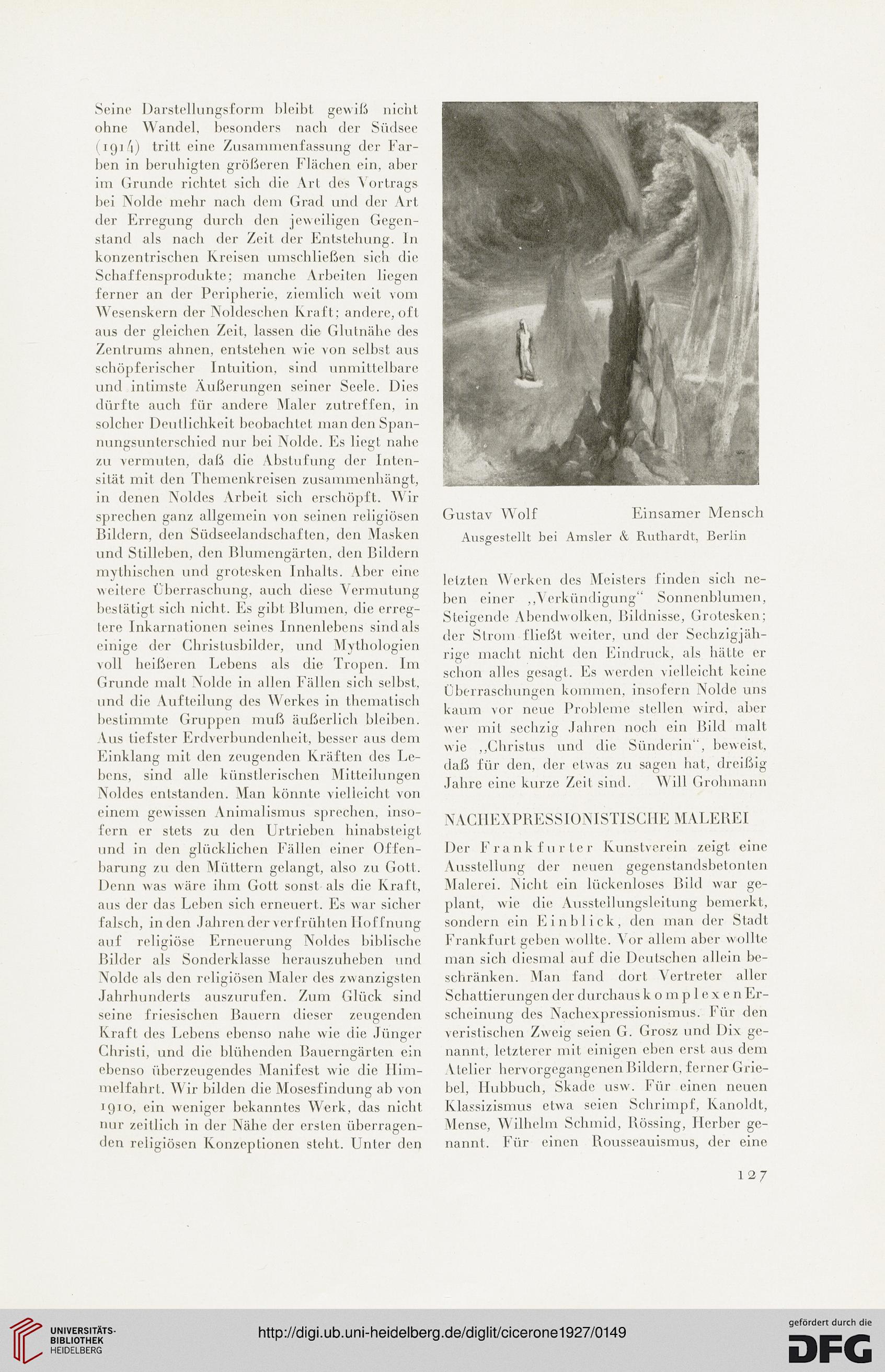Seine Darstellungsform bleibt gewiß nicht
ohne Wandel, besonders nach der Südsee
(1911\) tritt eine Zusammenfassung der Far-
ben in beruhigten größeren Flächen ein, aber
im Grunde richtet sich die Art des Vortrags
bei Nolde mehr nach dem Grad und der Art
der Erregung durch den jeweiligen Gegen-
stand als nach der Zeit der Entstehung, ln
konzentrischen Kreisen umschließen sich die
Schaffensprodukte; manche Arbeiten liegen
ferner an der Peripherie, ziemlich weit vom
Wesenskern der Noldeschen Kraft; andere, oft
aus der gleichen Zeit, lassen die Glutnähe des
Zentrums ahnen, entstehen wie von selbst aus
schöpferischer Intuition, sind unmittelbare
und intimste Äußerungen seiner Seele. Dies
dürfte auch für andere Maler zutreffen, in
solcher Deutlichkeit beobachtet man den Span-
nungsunterschied nur bei Nolde. Es liegt nahe
zu vermuten, daß die Abstufung der Inten-
sität mit den Themenkreisen zusammenhängt,
in denen Noldes Arbeit sich erschöpft. Wir
sprechen ganz allgemein von seinen religiösen
Bildern, den Südseelandschaften, den Masken
und Stilleben, den Blumengärten, den Bildern
mythischen und grotesken Inhalts. Aber eine
w eitere Überraschung, auch diese Vermutung
bestätigt sich nicht. Es gibt Blumen, die erreg-
tere Inkarnationen seines Innenlebens sind als
einige der Christusbilder, und Mythologien
voll heißeren Lebens als die Tropen. Im
Grunde malt Nolde in allen Fällen sich selbst,
und die Aufteilung des Werkes in thematisch
bestimmte Gruppen muß äußerlich bleiben.
Aus tiefster Erdverbundenheit, besser aus dem
Einklang mit den zeugenden Kräften des Le-
bens, sind alle künstlerischen Mitteilungen
Noldes entstanden. Man könnte vielleicht von
einem gewissen Animalismus sprechen, inso-
fern er stets zu den Urtrieben hinabsteigt
und in den glücklichen Fällen einer Offen-
barung zu den Müttern gelangt, also zu Gott.
Denn was wäre ihm Gott sonst als die Kraft,
aus der das Leben sich erneuert. Es war sicher
falsch, in den Jahren der verfrühten Hoffnung
auf religiöse Erneuerung Noldes biblische
Bilder als Sonderklasse herauszuheben und
Nolde als den religiösen Maler des zwanzigsten
Jahrhunderts auszurufen. Zum Glück sind
seine friesischen Bauern dieser zeugenden
Kraft des Lebens ebenso nahe wie die Jünger
Christi, und die blühenden Bauerngärten ein
ebenso überzeugendes Manifest wie die Him-
melfahrt. Wir bilden die Mosesfindung ab von
1910, ein weniger bekanntes Werk, das nicht
nur zeitlich in der Nähe der ersten überragen-
den religiösen Konzeptionen steht. Unter den
Gustav Wolf Einsamer Mensch
Ausgestellt bei Amsler & Ruthardt, Berlin
letzten Werken des Meisters finden sich ne-
ben einer „Verkündigung“ Sonnenblumen,
Steigende Abendwolken, Bildnisse, Grotesken;
der Strom fließt weiter, und der Sechzigjäh-
rige macht nicht den Eindruck, als hätte er
schon alles gesagt. Es werden vielleicht keine
Überraschungen kommen, insofern Nolde uns
kaum vor neue Probleme stellen wird, aber
wer mit sechzig Jahren noch ein Bild malt
wie „Christus und die Sünderin“, beweist,
daß für den, der etwas zu sagen hat, dreißig
Jahre eine kurze Zeit sind. Will Grohmann
NACH EXPRESSIONISTISCHE MALEREI
Der Frank f urter Kunstverein zeigt eine
Ausstellung der neuen gegenstandsbetonten
Malerei. Nicht ein lückenloses Bild war ge-
plant, wie die Ausstellungsleitung bemerkt,
sondern ein Einblick, den man der Stadt
Frankfurt geben wollte. Vor allem aber wollte
man sich diesmal auf die Deutschen allein be-
schränken. Man fand dort Vertreter aller
Schattierungen der durchaus komplexen Er-
scheinung des Nachexpressionismus. Für den
veristischen Zweig seien G. Grosz und Dix ge-
nannt, letzterer mit einigen eben erst aus dem
Atelier hervorgegangenen Bildern, ferner Grie-
bel, Hubbuch, Skade usw. Für einen neuen
Klassizismus etwa seien Schrimpf, Kanoldt,
Mense, Wilhelm Schmid, Rössing, Herber ge-
nannt. Für einen Rousseauismus, der eine
127
ohne Wandel, besonders nach der Südsee
(1911\) tritt eine Zusammenfassung der Far-
ben in beruhigten größeren Flächen ein, aber
im Grunde richtet sich die Art des Vortrags
bei Nolde mehr nach dem Grad und der Art
der Erregung durch den jeweiligen Gegen-
stand als nach der Zeit der Entstehung, ln
konzentrischen Kreisen umschließen sich die
Schaffensprodukte; manche Arbeiten liegen
ferner an der Peripherie, ziemlich weit vom
Wesenskern der Noldeschen Kraft; andere, oft
aus der gleichen Zeit, lassen die Glutnähe des
Zentrums ahnen, entstehen wie von selbst aus
schöpferischer Intuition, sind unmittelbare
und intimste Äußerungen seiner Seele. Dies
dürfte auch für andere Maler zutreffen, in
solcher Deutlichkeit beobachtet man den Span-
nungsunterschied nur bei Nolde. Es liegt nahe
zu vermuten, daß die Abstufung der Inten-
sität mit den Themenkreisen zusammenhängt,
in denen Noldes Arbeit sich erschöpft. Wir
sprechen ganz allgemein von seinen religiösen
Bildern, den Südseelandschaften, den Masken
und Stilleben, den Blumengärten, den Bildern
mythischen und grotesken Inhalts. Aber eine
w eitere Überraschung, auch diese Vermutung
bestätigt sich nicht. Es gibt Blumen, die erreg-
tere Inkarnationen seines Innenlebens sind als
einige der Christusbilder, und Mythologien
voll heißeren Lebens als die Tropen. Im
Grunde malt Nolde in allen Fällen sich selbst,
und die Aufteilung des Werkes in thematisch
bestimmte Gruppen muß äußerlich bleiben.
Aus tiefster Erdverbundenheit, besser aus dem
Einklang mit den zeugenden Kräften des Le-
bens, sind alle künstlerischen Mitteilungen
Noldes entstanden. Man könnte vielleicht von
einem gewissen Animalismus sprechen, inso-
fern er stets zu den Urtrieben hinabsteigt
und in den glücklichen Fällen einer Offen-
barung zu den Müttern gelangt, also zu Gott.
Denn was wäre ihm Gott sonst als die Kraft,
aus der das Leben sich erneuert. Es war sicher
falsch, in den Jahren der verfrühten Hoffnung
auf religiöse Erneuerung Noldes biblische
Bilder als Sonderklasse herauszuheben und
Nolde als den religiösen Maler des zwanzigsten
Jahrhunderts auszurufen. Zum Glück sind
seine friesischen Bauern dieser zeugenden
Kraft des Lebens ebenso nahe wie die Jünger
Christi, und die blühenden Bauerngärten ein
ebenso überzeugendes Manifest wie die Him-
melfahrt. Wir bilden die Mosesfindung ab von
1910, ein weniger bekanntes Werk, das nicht
nur zeitlich in der Nähe der ersten überragen-
den religiösen Konzeptionen steht. Unter den
Gustav Wolf Einsamer Mensch
Ausgestellt bei Amsler & Ruthardt, Berlin
letzten Werken des Meisters finden sich ne-
ben einer „Verkündigung“ Sonnenblumen,
Steigende Abendwolken, Bildnisse, Grotesken;
der Strom fließt weiter, und der Sechzigjäh-
rige macht nicht den Eindruck, als hätte er
schon alles gesagt. Es werden vielleicht keine
Überraschungen kommen, insofern Nolde uns
kaum vor neue Probleme stellen wird, aber
wer mit sechzig Jahren noch ein Bild malt
wie „Christus und die Sünderin“, beweist,
daß für den, der etwas zu sagen hat, dreißig
Jahre eine kurze Zeit sind. Will Grohmann
NACH EXPRESSIONISTISCHE MALEREI
Der Frank f urter Kunstverein zeigt eine
Ausstellung der neuen gegenstandsbetonten
Malerei. Nicht ein lückenloses Bild war ge-
plant, wie die Ausstellungsleitung bemerkt,
sondern ein Einblick, den man der Stadt
Frankfurt geben wollte. Vor allem aber wollte
man sich diesmal auf die Deutschen allein be-
schränken. Man fand dort Vertreter aller
Schattierungen der durchaus komplexen Er-
scheinung des Nachexpressionismus. Für den
veristischen Zweig seien G. Grosz und Dix ge-
nannt, letzterer mit einigen eben erst aus dem
Atelier hervorgegangenen Bildern, ferner Grie-
bel, Hubbuch, Skade usw. Für einen neuen
Klassizismus etwa seien Schrimpf, Kanoldt,
Mense, Wilhelm Schmid, Rössing, Herber ge-
nannt. Für einen Rousseauismus, der eine
127