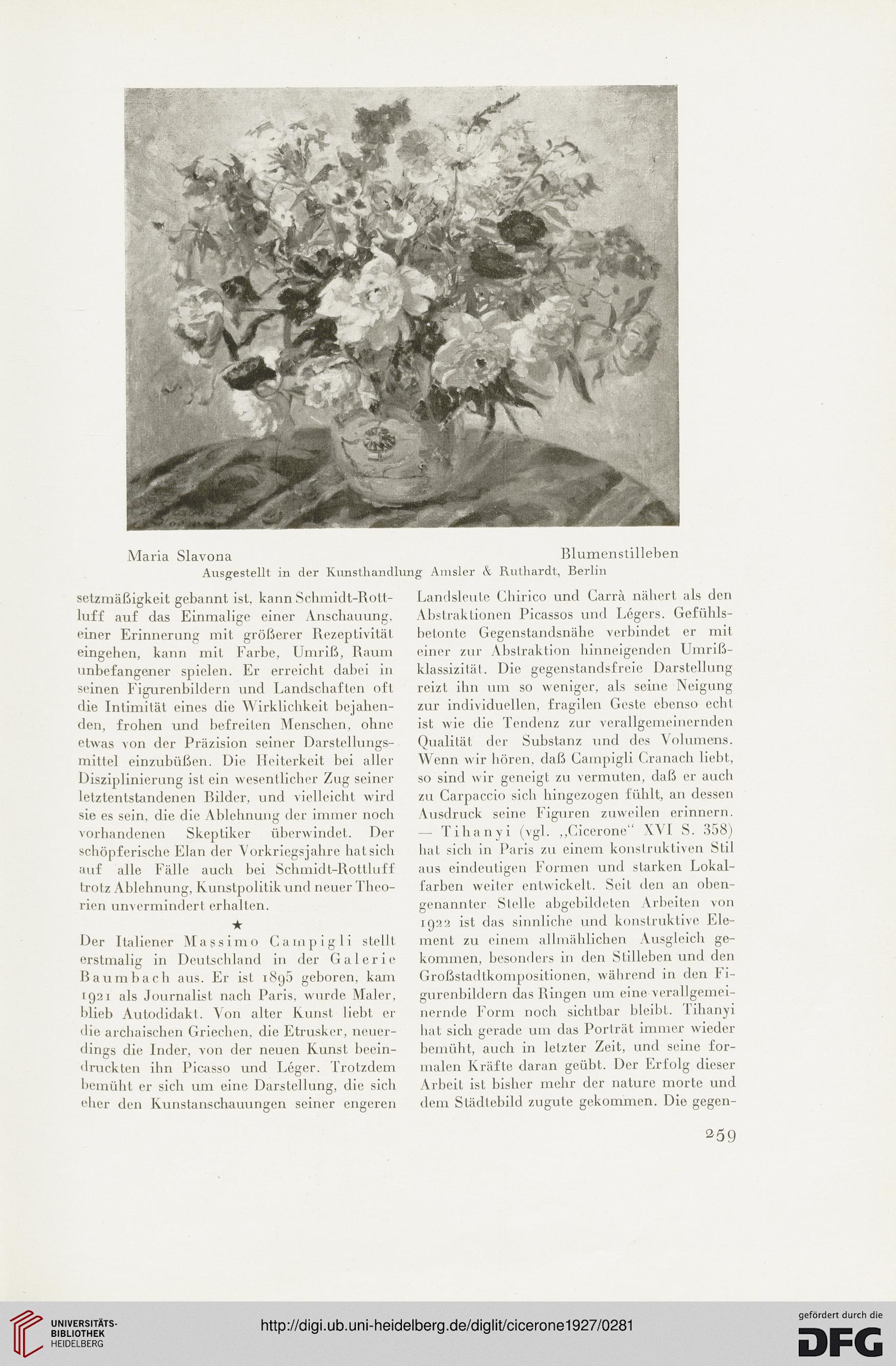Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0281
DOI issue:
Heft 8
DOI article:Rundschau
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0281
Maria Slavona Blumenstilleben
Ausgestellt in der Kunsthandlung Amsler & Ruthardt, Berlin
setzmäßigkeit gebannt ist, kann Schmidt-Rott-
luff auf das Einmalige einer Anschauung,
einer Erinnerung mit größerer Rezeptivität
entgehen, kann mit Farbe, Umriß, Raum
unbefangener spielen. Er erreicht dabei in
seinen Figurenbildern und Landschaften oft
die Intimität eines die Wirklichkeit bejahen-
den, frohen und befreiten Menschen, ohne
etwas von der Präzision seiner Darstellungs-
mittel einzubüßen. Die Heiterkeit bei aller
Disziplinierung ist ein wesentlicher Zug seiner
letztentstandenen Bilder, und vielleicht wird
sie es sein, die die Ablehnung der immer noch
vorhandenen Skeptiker überwindet. Der
schöpferische Elan der 'Vorkriegsjahre hat sich
auf alle Fälle auch bei Schmidt-Rottluff
trotz Ablehnung, Kunstpolitik und neuer Theo-
rien unvermindert erhalten.
★
Der Italiener Massimo Campigli stellt
erstmalig in Deutschland in der Galerie
Baumbach aus. Er ist i8g5 geboren, kam
1921 als Journalist nach Paris, wurde Maler,
blieb Autodidakt. Von alter Kunst liebt er
die archaischen Griechen, die Etrusker, neuer-
dings die Inder, von der neuen Kunst beein-
druckten ihn Picasso und Leger. Trotzdem
bemüht er sich um eine Darstellung, die sich
eher den Kunstanschauungen seiner engeren
Landsleute Chirico und Carrä nähert als den
Abstraktionen Picassos und Legers. Gefühls-
betonte Gegenstandsnähe verbindet er mit
einer zur Abstraktion hinneigenden Umriß-
klassizität. Die gegenstandsfreie Darstellung
reizt ihn um so weniger, als seine Neigung
zur individuellen, fragilen Geste ebenso echt
ist wie die Tendenz zur verallgemeinernden
Qualität der Substanz und des Volumens.
Wenn wir hören, daß Campigli Cranach liebt,
so sind wir geneigt zu vermuten, daß er auch
zu Carpaccio sich hingezogen fühlt, an dessen
Ausdruck seine Figuren zuweilen erinnern.
— Tihanyi (vgl. „Cicerone“ XVI S. 358)
hat sich in Paris zu einem konstruktiven Stil
aus eindeutigen Formen und starken Lokal-
farben weiter entwickelt. Seit den an oben-
genannter Stelle abgebildeten Arbeiten von
1922 ist das sinnliche und konstruktive Ele-
ment zu einem allmählichen Ausgleich ge-
kommen, besonders in den Stilleben und den
Großstadtkompositionen, während in den Fi-
gurenbildern das Ringen um eine verallgemei-
nernde Form noch sichtbar bleibt. Tihanyi
hat sich gerade um das Porträt immer wieder
bemüht, auch in letzter Zeit, und seine for-
malen Kräfte daran geübt. Der Erfolg dieser
Arbeit ist bisher mehr der nature morte und
dem Städlebild zugute gekommen. Die gegen-