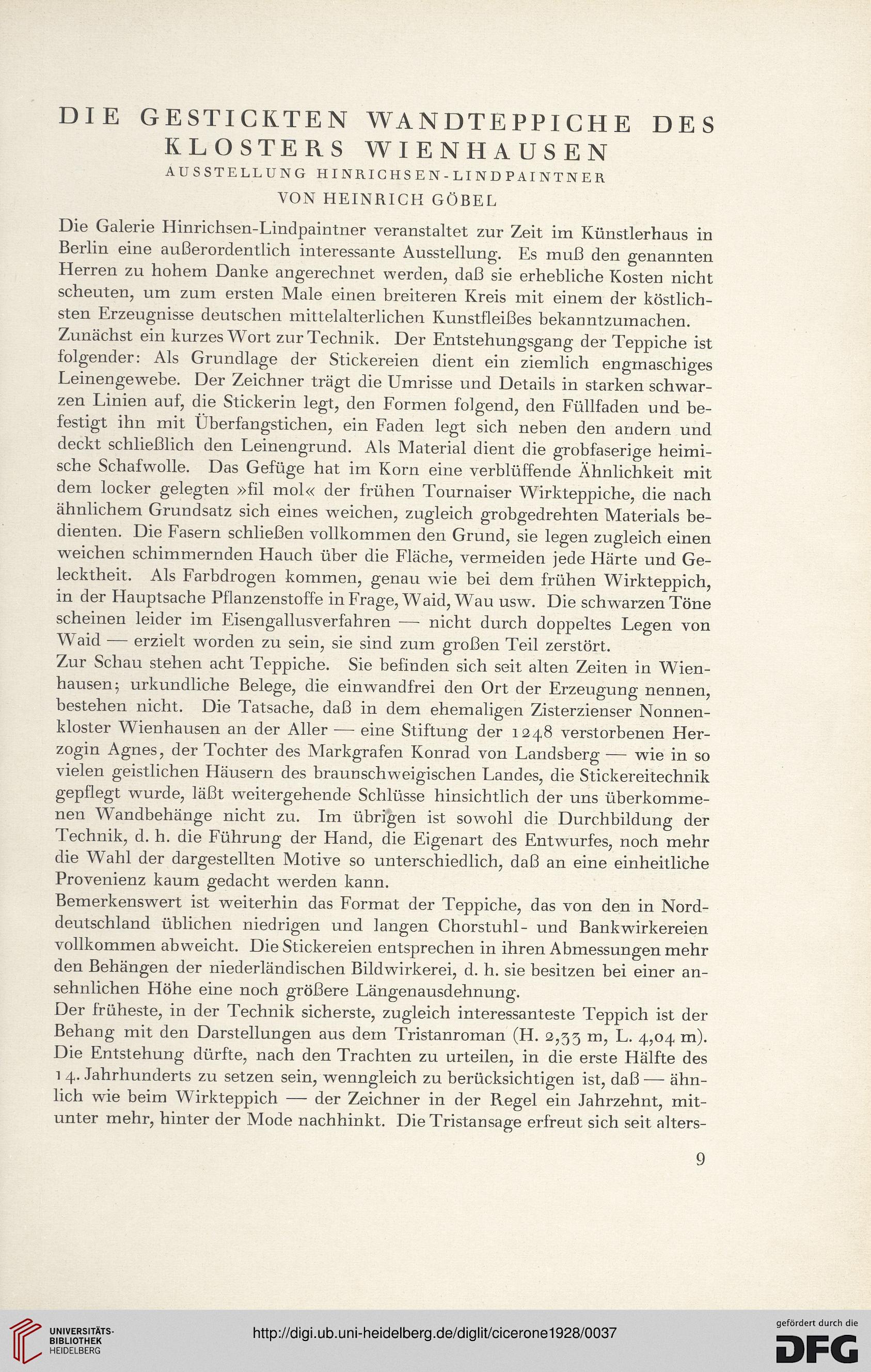DIE GESTICKTEN WANDTEPPICHE DES
KLOSTERS WIENHAUSEN
AUSSTELLUNG HINRICHSEN-LINDPAINTNER
VON HEINRICH GÖBEL
Die Galerie Hinrichsen-Lindpaintner veranstaltet zur Zeit im Künstlerhaus in
Berlin eine außerordentlich interessante Ausstellung. Es muß den genannten
Herren zu hohem Danke angerechnet werden, daß sie erhebliche Kosten nicht
scheuten, um zum ersten Male einen breiteren Kreis mit einem der köstlich-
sten Erzeugnisse deutschen mittelalterlichen Kunstfleißes bekanntzumachen.
Zunächst ein kurzes Wort zur Technik. Der Entstehungsgang der Teppiche ist
folgender: Als Grundlage der Stickereien dient ein ziemlich engmaschiges
Leinen ge webe. Der Zeichner trägt die Umrisse und Details in starken schwar-
zen Linien auf, die Stickerin legt, den Formen folgend, den Füllfaden und be-
festigt ihn mit Überfangstichen, ein Faden legt sich neben den andern und
deckt schließlich den Leinengrund. Als Material dient die grobfaserige heimi-
sche Schafwolle. Das Gefüge hat im Korn eine verblüffende Ähnlichkeit mit
dem locker gelegten »fil mol« der frühen Tournaiser Wirkteppiche, die nach
ähnlichem Grundsatz sich eines weichen, zugleich grobgedrehten Materials be-
dienten. Die Fasern schließen vollkommen den Grund, sie legen zugleich einen
weichen schimmernden Hauch über die Fläche, vermeiden jede Härte und Ge-
lecktheit. Als Farbdrogen kommen, genau wie bei dem frühen Wirkteppich,
in der Hauptsache Pflanzenstoffe in Frage, Waid, Wau usw. Die schwarzen Töne
scheinen leider im Eisengallusverfahren — nicht durch doppeltes Legen von
Waid — erzielt worden zu sein, sie sind zum großen Teil zerstört.
Zur Schau stehen acht Teppiche. Sie befinden sich seit alten Zeiten in Wien-
hausen 5 urkundliche Belege, die einwandfrei den Ort der Erzeugung nennen,
bestehen nicht. Die Tatsache, daß in dem ehemaligen Zisterzienser Nonnen-
kloster Wienhausen an der Aller — eine Stiftung der 1248 verstorbenen Her-
zogin Agnes, der Tochter des Markgrafen Konrad von Landsberg — wie in so
vielen geistlichen Häusern des braunschweigischen Landes, die Stickereitechnik
gepflegt wurde, läßt weitergehende Schlüsse hinsichtlich der uns überkomme-
nen Wandbehänge nicht zu. Im übrigen ist sowohl die Durchbildung der
Technik, d. h. die Führung der Hand, die Eigenart des Entwurfes, noch mehr
die Wahl der dargestellten Motive so unterschiedlich, daß an eine einheitliche
Provenienz kaum gedacht werden kann.
Bemerkenswert ist weiterhin das Format der Teppiche, das von den in Nord-
deutschland üblichen niedrigen und langen Chorstuhl- und Bankwirkereien
vollkommen ab weicht. Die Stickereien entsprechen in ihren A bmessungen mehr
den Behängen der niederländischen Bildwirkerei, d. h. sie besitzen bei einer an-
sehnlichen Höhe eine noch größere Längenausdehnung.
Der früheste, in der Technik sicherste, zugleich interessanteste Teppich ist der
Behang mit den Darstellungen aus dem Tristanroman (H. 2,53 m, L. 4,04 m).
Die Entstehung dürfte, nach den Trachten zu urteilen, in die erste Hälfte des
l 4. Jahrhunderts zu setzen sein, wenngleich zu berücksichtigen ist, daß — ähn-
lich wie beim Wirkteppich — der Zeichner in der Regel ein Jahrzehnt, mit-
unter mehr, hinter der Mode nachhinkt. Die Tristansage erfreut sich seit alters-
9
KLOSTERS WIENHAUSEN
AUSSTELLUNG HINRICHSEN-LINDPAINTNER
VON HEINRICH GÖBEL
Die Galerie Hinrichsen-Lindpaintner veranstaltet zur Zeit im Künstlerhaus in
Berlin eine außerordentlich interessante Ausstellung. Es muß den genannten
Herren zu hohem Danke angerechnet werden, daß sie erhebliche Kosten nicht
scheuten, um zum ersten Male einen breiteren Kreis mit einem der köstlich-
sten Erzeugnisse deutschen mittelalterlichen Kunstfleißes bekanntzumachen.
Zunächst ein kurzes Wort zur Technik. Der Entstehungsgang der Teppiche ist
folgender: Als Grundlage der Stickereien dient ein ziemlich engmaschiges
Leinen ge webe. Der Zeichner trägt die Umrisse und Details in starken schwar-
zen Linien auf, die Stickerin legt, den Formen folgend, den Füllfaden und be-
festigt ihn mit Überfangstichen, ein Faden legt sich neben den andern und
deckt schließlich den Leinengrund. Als Material dient die grobfaserige heimi-
sche Schafwolle. Das Gefüge hat im Korn eine verblüffende Ähnlichkeit mit
dem locker gelegten »fil mol« der frühen Tournaiser Wirkteppiche, die nach
ähnlichem Grundsatz sich eines weichen, zugleich grobgedrehten Materials be-
dienten. Die Fasern schließen vollkommen den Grund, sie legen zugleich einen
weichen schimmernden Hauch über die Fläche, vermeiden jede Härte und Ge-
lecktheit. Als Farbdrogen kommen, genau wie bei dem frühen Wirkteppich,
in der Hauptsache Pflanzenstoffe in Frage, Waid, Wau usw. Die schwarzen Töne
scheinen leider im Eisengallusverfahren — nicht durch doppeltes Legen von
Waid — erzielt worden zu sein, sie sind zum großen Teil zerstört.
Zur Schau stehen acht Teppiche. Sie befinden sich seit alten Zeiten in Wien-
hausen 5 urkundliche Belege, die einwandfrei den Ort der Erzeugung nennen,
bestehen nicht. Die Tatsache, daß in dem ehemaligen Zisterzienser Nonnen-
kloster Wienhausen an der Aller — eine Stiftung der 1248 verstorbenen Her-
zogin Agnes, der Tochter des Markgrafen Konrad von Landsberg — wie in so
vielen geistlichen Häusern des braunschweigischen Landes, die Stickereitechnik
gepflegt wurde, läßt weitergehende Schlüsse hinsichtlich der uns überkomme-
nen Wandbehänge nicht zu. Im übrigen ist sowohl die Durchbildung der
Technik, d. h. die Führung der Hand, die Eigenart des Entwurfes, noch mehr
die Wahl der dargestellten Motive so unterschiedlich, daß an eine einheitliche
Provenienz kaum gedacht werden kann.
Bemerkenswert ist weiterhin das Format der Teppiche, das von den in Nord-
deutschland üblichen niedrigen und langen Chorstuhl- und Bankwirkereien
vollkommen ab weicht. Die Stickereien entsprechen in ihren A bmessungen mehr
den Behängen der niederländischen Bildwirkerei, d. h. sie besitzen bei einer an-
sehnlichen Höhe eine noch größere Längenausdehnung.
Der früheste, in der Technik sicherste, zugleich interessanteste Teppich ist der
Behang mit den Darstellungen aus dem Tristanroman (H. 2,53 m, L. 4,04 m).
Die Entstehung dürfte, nach den Trachten zu urteilen, in die erste Hälfte des
l 4. Jahrhunderts zu setzen sein, wenngleich zu berücksichtigen ist, daß — ähn-
lich wie beim Wirkteppich — der Zeichner in der Regel ein Jahrzehnt, mit-
unter mehr, hinter der Mode nachhinkt. Die Tristansage erfreut sich seit alters-
9